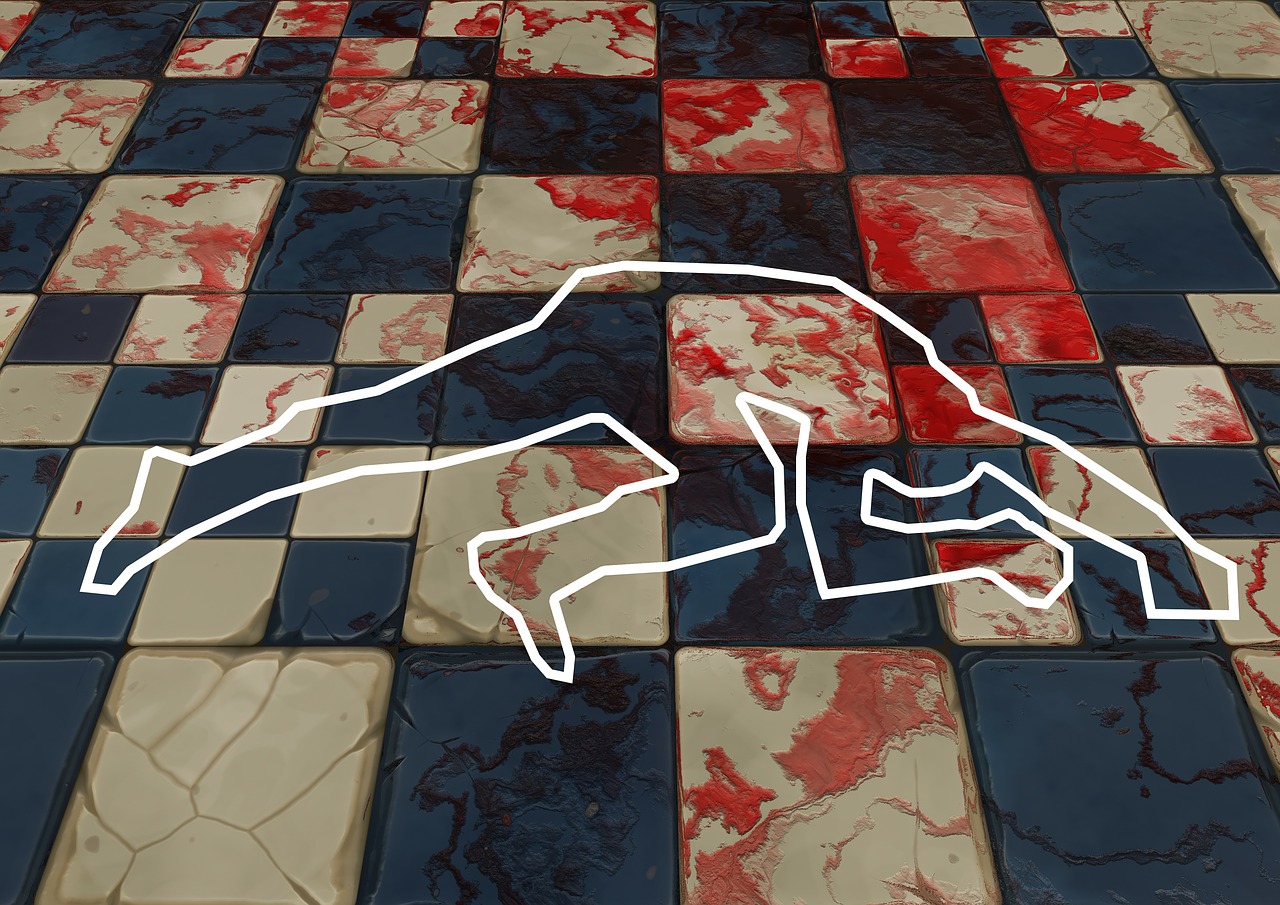Corona, Klimawandel, ein zunehmend dysfunktionales Bildungssystem – an gesellschaftlichen Problemlagen, die vor allen Dingen der jungen Generation einen Start ins Leben erschweren, mangelt es nicht. Dazu kommen jetzt noch die vermeintlichen oder wirklichen Bedrohungslagen von außen, die als Begründung für neue Wehr- und Pflichtdienste herhalten müssen. Ein weiteres Mal droht die Gefahr, dass der kommenden Generation das Recht genommen wird, über ihren Lebensweg mitentscheiden zu können bzw., dass über ihren Kopf hinweg entschieden wird. Das darf so nicht einfach hingenommen werden.
Über Krieg und Frieden entscheidet die Demokratie im Namen aller – aber nicht über die körperliche Unversehrtheit oder das Leben einer ganzen Generation durch die Mehrheit derer, die selbst nicht mehr in einen möglicherweise nächsten militärischen Einsatz ziehen würden und dies auch gar nicht müssen. Wer das Risiko nicht trägt, darf dieses Risiko für andere nicht diktieren. Sonst entsteht ein moralisches Ungleichgewicht: Eine gesellschaftliche Mehrheit externalisiert Gefahr und Kosten und eine Minderheit von Betroffenen wird zum Objekt fremder Entscheidungen. Grundsätzliche Überlegungen dieser Art tangieren uns auf zweierlei Weise. Nicht nur als Mütter und Väter, Großmütter und Großväter von jungen Menschen, von denen wir hoffen, dass der Kelch eines militärischen Einsatzes an ihnen vorüberziehen mag, sondern auch als Verantwortungsträger für freie Individuen, deren Grundrecht auf Leben und körperliche Unversehrtheit nicht zur Disposition einer Mehrheit von Nicht-Betroffenen stehen sollte.
Die Politik kann in diesen elementaren Fragen Optionen in den Raum stellen und hat das Recht, um Zustimmung gerade auch bei denjenigen zu werben, die davon betroffen sind. Die Politik darf aber nicht durch eine Mehrheit von Nichtbetroffenen und von oben herab eine Pflicht verordnen. Anders gesagt: Zwischen dem Urteil einer Mehrheit und derjenigen, deren Grundrechte auf dem Spiel stehen, muss ein Mindestmaß an Deckungsgleichheit bestehen. Ohne eine solche Abwägung würde der Generationenvertrag einseitig aufgekündigt und die Betroffenen könnten zurecht den Vorwurf erheben, es würde fortan das St. Florian-Prinzip herrschen.
Als die Jusos auf dem SPD-Bundesparteitag im Juni mit Boris Pistorius um einen „Neuen Wehrdienst“ rangen, hatten sie die Freiwilligkeit des Wehrdienstes, angelehnt an das schwedische Modell im Blick. Gerade die Jüngeren in der SPD sind es, die den Dialog mit der betroffenen Generation führen und ihr im Zweifelsfall auch erklären müssen, wie denn ein Interessenausgleich aussehen kann, der sicherheitspolitische Notwendigkeiten mit dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und körperliche Unversehrtheit miteinander verbindet. Boris Pistorius handelte auf dem Parteitag Ende Juni dieses Jahres einen Kompromiss aus, der sich am schwedischen Modell orientiert und die Freiwilligkeit durch Attraktivität des Wehrdienstes deutlich betont.
Der kürzlich veröffentlichte Regierungsentwurf (WDModG) liest sich hingegen ganz anders.
Er macht die Bereitschaftserklärung zur Ableistung des Wehrdiensts zur Rechtspflicht, sanktioniert deren Verweigerung als Ordnungswidrigkeit und führt verpflichtende Musterungen ab dem 1. Juli 2027 ein. Der eigentliche Gesetzeskern ist: Wenn die Anreize nicht rechtzeitig wirken, soll die Bundesregierung per Rechtsverordnung – mit Zustimmung des Bundestags – die verpflichtende Einberufung auslösen können. Damit wird aus „freiwillig“ eine aktivierbare Wehr“pflicht“, sobald die freiwilligen Maßnahmen nicht ausreichen. Das könnte im Übrigen auch passieren, wenn der Bundesverteidigungsminister nicht mehr Boris Pistorius hieße, sondern Roderich Kiesewetter oder gar jemand von der AfD!
Sollte Boris Pistorius versuchen, diesen neuen Weg zu beschreiten und sich über den Parteitagsbeschluss von Berlin hinwegzusetzen, muss die Frage erlaubt sein, inwiefern er sich an die Willensbildung seiner Partei gebunden fühlt und bereit ist, den auf dem Parteitag beschlossenen Kompromiss zur Grundlage seiner Politik zu machen. Auch die SPD-Bundestagsabgeordneten werden sich diese Frage stellen müssen.
Für den Fall, dass sie sich von den eigenen Parteitagsbeschlüssen distanzieren, wird das den Wählerinnen und Wählern nicht entgehen. Eine knappe Mehrheit, nämlich 53 Prozent der 12- bis 18-Jährigen sprechen sich zwar in einer jüngsten Umfrage für einen frei wählbaren Pflichtdienst nach Schule oder Ausbildung aus, 49 Prozent sind jedoch der Meinung, dass dieser Dienst nicht zwingend bei der Bundeswehr geleistet werden sollte. Unter den 18 bis 39-Jährigen, die wohl am ehesten von einer Wehrpflicht betroffen wären, lehnen immerhin 40 Prozent die Wehrpflicht völlig ab. Nach einer Grafik von statista.de sagen sogar 61 Prozent der 18 bis 29-Jährigen nein zu einer Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die Jahrgänge, die künftig einer Wehrpflicht unterliegen würden, könnten ferner darauf verweisen, dass laut einer Forsa-Umfrage eine klare Mehrheit der Deutschen, nämlich 59 Prozent, „wahrscheinlich nicht“ oder „gar nicht“ bereit wäre, ihr Land mit der Waffe zu verteidigen. 16 Prozent wären „auf jeden Fall“ bereit und 22 Prozent würden das „wahrscheinlich“ tun.
Die Entscheidung über die Wiedereinsetzung einer Wehrpflicht gehört unverzüglich in die öffentliche Debatte – vor allem in den Diskurs mit denjenigen, die die Folgen zu tragen haben. Die Betroffenen müssen sich dazu öffentlich äußern können. Dazu muss eine Abstimmung über den nun veröffentlichten Regierungsentwurf um ein Jahr verschoben werden. Es braucht eine strukturierte Debatte, in der Jugendorganisationen der Parteien ebenso zu Wort kommen wie Schüler- und Studierendenvertretungen und weitere Jugendorganisationen, etwa die der Kirchen oder der Gewerkschaften. Sie sind nicht Kulisse, sondern Betroffene. Am Ende muss ein transparentes, überprüfbares Meinungsbild stehen, das weiteres politisches Handeln legitimiert. Zwischen Urteil einer Mehrheit und Betroffenen braucht es Deckungsgleichheit; und die entsteht – wenn überhaupt – nur durch Zustimmung, nicht durch Zwang. Wer die betroffene Generation mit Wortklauberei oder Verfahrentricks hinters Licht führen will, provoziert Abwehr und Ablehnung — erst schleichend, dann offenen Protest. Die Alternative ist einfach: Debatte und Zustimmung – oder ein verschärfter Generationskonflikt.
Zu den Autoren:
Stefan Bone ist Dirigent und Pianist und arbeitet nach vorherigem Musikstudium in Saarbrücken und Freiburg seit 2017 als Kapellmeister am Opernhaus Kiel. Er ist Mitbegründer und Künstlerischer Leiter des Kammerorchesters der Großregion (KOG), eines Ensembles mit Sitz im Saarland und Schwerpunkt auf internationaler Kulturzusammenarbeit. Seit 2002 ist er Mitglied der SPD und engagiert sich im Kulturforum der Sozialdemokratie sowie im Leitungskreis des Erhard-Eppler-Kreises.
Axel Fersen ist Politikwissenschaftler mit Schwerpunkt auf digitaler Transformation und künstlicher Intelligenz. Nach dem Studium der Politikwissenschaften an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz wechselte er in die Technologiebranche. Er lebt und arbeitet in Barcelona. Seit den 1980er Jahren ist er Mitglied der SPD und u.a. auch Kooperationspartner der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien, Koordinator und Mitglied des Leitungskreises des Erhard-Eppler-Kreises, Mitglied im Vorstand des Europa-Instituts für Sozial- und Gesundheitsforschung e.V., einem An-Institut der Alice Salomon Hochschule Berlin, und Mitglied der Studiengruppe Technikfolgenabschätzung der Digitalisierung in der Vereinigung Deutscher Wissenschaftler (VDW).