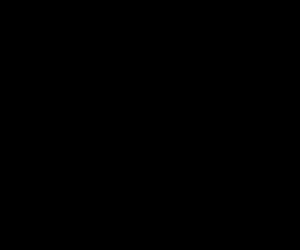Döblins letzter Roman stammt aus dem Jahre 1946 und wurde erst 10 Jahre später veröffentlicht. Er handelt von großen Themen wie Schuld und Verantwortung für den Krieg und – allgemeiner noch – von der Frage, wie das Böse in die Welt kommt. Es fand sich damals kein westdeutscher Verlag, der bereit war, das Buch zu drucken. Als es dann endlich in der damaligen DDR erschien, bestanden die Kulturbürokraten der SED auf einer Änderung des allzu harmonischen Romanschlusses. Döblin musste die letzten vier Seiten des Romans neu schreiben, damit er zur Veröffentlichung freigegeben wurde.
Das Außergewöhnliche der Romankonstruktion besteht darin, dass Döblin sich der komplexen Problematik der Kriegsschuld dadurch nähert, dass er die Mechanismen und Geheimnisse einer bürgerlichen Familie darstellt. Während die politische Verantwortung für den Krieg klar war, suchte Döblin nach Ursachen in den herkömmlichen familiären Strukturen. Damit knüpft er an Erkenntnisse an, die Max Horkheimer und Theodor W. Adorno nach umfangreichen empirischen Studien über den Zusammenhang von „Autorität und Familie“ und die Herausbildung einer „autoritären Persönlichkeit“ gewonnen hatten. Einen ähnlichen Ansatz verfolgte auch der Psychoanalytiker Wilhelm Reich in seiner Arbeit über „Massenpsychologie des Faschismus“. Es wurde davon ausgegangen, dass in der „Familie als Keimzelle des Staates“ durch das Zusammenwirken von Autoritätsformen, unhinterfragten Herrschaftsverhältnissen und Triebunterdrückung, Charaktereigenschaften wie die Bereitschaft zur Unterordnung und Autoritätsgläubigkeit herausgebildet werden, an welche die faschistische Ideologie nahtlos anknüpfen konnte. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Intentionen Döblins an Plausibilität.
Kriegsschuld, Wahrheit, Liebe
Zur Romanhandlung selbst: Der junge britische Soldat Edward Allison kehrt an Leib und Seele schwerstverwundet zurück in sein Elternhaus, wo sich ihm nicht nur Fragen über Fragen nach dem Sinn des Krieges stellen, sondern auch Abgründe in der Familiengeschichte und im Eheleben seiner Eltern Gordon und Alice Allison auftun. Es wird sichtbar, dass dieses auf einer Lebenslüge beruhte, hinter der sich gut gehütete Geheimnisse verbergen; das Zusammenleben kam einem Rollenspiel gleich, inszeniert in einer Scheinwelt der Harmonie, Liebe und Fürsorglichkeit. Nach und nach kommt diese Inszenierung zum Einsturz. Das Schweigekartell wird aufgebrochen über den Umweg von Erzählungen: auf den Vorschlag Gordon Allisons, sich Geschichten (Mythen, Märchen, Fiktionales) zu erzählen, um ins Gespräch zu kommen, lassen sich alle Beteiligten ein. Diese Erzählungen sind von unterschiedlichem Sujet: wie etwa die scheinbar abwegige Geschichte des Troubadourritters Jauffie Rudel de la Blaia aus der Provence und seiner imaginären Liebe zur Prinzessin von Tripoli; oder die vom Knappen, der auf dem Ritt zum Turnier seinen Ring verliert; oder von Shakespears Dramengestalt King Lear – also meist historisch oder historisierend angelegt. Jedoch ist allen der insgesamt acht Erzählungen eines eigen: sie weisen einen spezifischen Symbolgehalt für die aktuellen Krisen und Konflikte der (Nachkriegs-)Zeit und der Familie Allison auf. Sie kreisen zum einen um die Frage nach der Kriegsschuld, nach Wahrheit und Redlichkeit im Umgang mit der Verantwortung dafür; zum anderen geht es immer wieder um die Liebe, die Mann-Frau-Beziehung und den Geschlechterkampf.
Treibende Kraft für den ersten Komplex ist der Sohn, der über sein eigenes Leid hinaus nach den generellen Ursachen des Kriegs fragt. Bevor noch die Erzählungen im Familienkreis einsetzen, heißt es über das Verhältnis von Edward zu seinem Vater:
Gordon Allison besuchte seinen Sprößling selten auf seinem Zimmer, und niemals allein. Er wollte sich offenbar vor unbequemen Fragen schützen. Es gelang nicht. Man konnte Edward nicht ausweichen. Er war von einer berserkerhaften Hartnäckigkeit. Er bohrte und bohrte.
Kindheit und Kriegserfahrung
Es ist dann auch Edward, der in seiner Erzählung auf Kierkegaards Schrift Was ich will? Redlichkeit zurückgreift und sie in Richtung seiner Fragen nach der Kriegsschuld interpretiert. Aber auch ein ungeklärter, latenter Vater-Sohn-Konflikt plagt ihn, für den er nur vage ein immer wieder auftauchendes Schreckensbild heranziehen kann, ein Trauma, das auf einem schlimmen Erlebnis in der Kindheit zu beruhen scheint: Und diesmal verlor er das Bewußtsein, und er lag wie ein Toter – dann verzerrte sich sein Gesicht zur Grimasse, in Schrecken, Qual. In Todesangst, in Raserei, in der Wut der Verzweiflung fletschte er die Zähne. Er ballte die Fäuste. Er schwang beide Arme vor das Gesicht, als ob er einen Schlag erwarte – es könnte der des Vaters gewesen sein. Hieran zeigen sich Döblins Anleihen an die Freudsche Psychoanalyse: das Trauma aus der Kindheit und das aus der Kriegserfahrung – beide müssen aufgearbeitet und therapiert werden. Hier allerdings versagt die Schulmedizin, auch wenn sich sein Arzt Dr. King auf dem richtigen Weg wähnt oder zumindest etwas ahnt. Aber Edward widersetzt sich seiner Therapie:
O nein, Herr Doktor, so kommen wir nicht weiter. Ihre Generalparole ist: Vor Ruhestörung wird gewarnt. – Das predigen dieselben Leute, die, man weiß nicht aus welchen Gründen, zu irgendeiner Zeit auf den guten Einfall kommen, einige Millionen Menschen in den Tod zu treiben. Natürlich sich selbst nicht. Sie selbst sitzen zu Hause und sind empört, wenn die Heizung nicht funktioniert.
Edward verknüpft seine individuelle Heilung mit der ihn bewegenden Frage nach den Verantwortlichen für den Krieg, denen er eine Vertuschung nach der Devise unterstellt: Ruhe und Stillschweigen bewahren, also die Vermeidung von Aufklärung.
Schleier über familiäre Beziehungen
Worin bestand die dramatische Selbstanalyse, der Edward sich selbst unterzieht? Es war ihm aus einem Tiefpunkt der Krise und des Leidens heraus gelungen, Erklärungen für die Kriegsschuld zu finden und gleichzeitig den Schleier, der über den familiären Beziehungen lag, zu lüften: das Drama seiner Existenz, die Geheimnisse und die Lügen aufzudecken, führten zur psychischen Genesung und brachte ihm letztendlich seine Lebensfähigkeit zurück. Doch davor liegt noch ein langer Prozess der Aufdeckung und Ergründung, der sich über den gesamten Roman hinzieht.
Ein Schlüssel liegt in der titelgebenden Hamlet-Figur oder Rolle, die im Roman auf Edward gemünzt ist. In einem Gespräch mit seinem Onkel James Mackenzie, dem Bruder seiner Mutter, einem Intellektuellen mit sehr speziellem Forschungsgebiet und überragender Bildung, geht es um Shakespears Romanhelden; Edward bittet James darum, über Hamlet im Rahmen der Abenderzählungen zu referieren. Als Begründung führt er die Ambivalenz zwischen immer wiederkehrenden Zweifeln am Handeln und die ihn, Hamlet, begünstigenden neuen Umstände an, die ihn dazu befähigen oder gar zwingen zu handeln, eine Bresche zu schlagen. Er müsse es tun.
James: ‚Muß, Edward? Ich wiederhole: Warum muß er?‘
Es wäre Sache der Erzählung, das irgendwie plausibel zu machen, wendet der Neffe ein. Zunächst ahnt er nur. Der Erzähler hätte die Aufgabe; aber es wäre eine interessante, zeitgemäße Aufgabe. Hamlet unter heutigen Umständen. Denn wie Ödipus, Faust oder Don Quichotte nicht veralten, so veraltet auch Hamlet nicht.
(siehe auch: Joke Frerichs: Der Idealist und der Zweifler – Don Quijote und Hamlet, in: Blog der Republik vom 30.12.2016)
Edward erwartet oder verlangt von seinem Onkel eine Aktualisierung des Hamlet-Dramas auf die gegenwärtigen Verhältnisse hin; es sei Aufgabe des Interpreten, diese aktuellen Bezüge herauszuarbeiten. Doch statt über Hamlet zu referieren, wird James dies später über King Lear tun. Und Edward begreift auch den Grund:
In was für einem Haus lebe ich. Hätte ich es für möglich gehalten? So sieht der Hintergrund des Hauses aus. Ich komme langsam dazu, Details zu unterscheiden. Ich ziehe mich selber langsam aus dem Hintergrund hervor. Weil ich im finsteren Hintergrund blieb, habe ich mein Bein verloren und bin krank geworden. Die Natur hat mich gezwungen, den Hamlet zu spielen. Ich verstehe, warum Onkel James mir nicht den Hamlet erzählen wollte. Er überließ es mir, ihn zu spielen. Nein, er sah: es war überflüssig, davon zu sprechen. Es war mir auferlegt, den Hamlet zu leben.
Verpflichtung zum Handeln
Dies kann als eine Schlüsselstelle des Romans gewertet werden. Edward begreift in Folge einer langen Suche nach Erklärung seine Situation: er tritt durch Einsicht und Erkenntnis aus dem Schatten (Hintergrund) ins Licht. Und dabei ist ihm die Hamlet-Figur mehr als ein Objekt der Identifikation oder eine Rolle, die man beliebig wieder ablegen kann. Er fühlt sich in der Pflicht, Hamlet zu leben. Eine Art Mission ist ihm damit aufgetragen oder auferlegt.
Der Hamlet-Figur entlehnt Edward das unerbittliche Nachfragen, das Bohren nach Wahrhaftigkeit oder Wahrheit oder Redlichkeit, die verzweifelte Suche nach Erklärungen für Unrecht, Zerstörung, Gewalt und Tod ebenso wie für die familiären Verstrickungen und Krisen im Elternhaus. Aber auch die Verpflichtung zum Handeln. Hamlets blutiges Schwert macht sich Edward imaginär und symbolhaft als Waffe zu eigen:
Dein Schwert, wie ist’s von Blut so rot! Ich muß noch Geduld haben, dann werde ich wissen. Ich werde wissen, wie Familie gegründet, Kinder in die Welt gesetzt und Ruhm und Ehrbarkeit verbreitet werden. Ich las: Gegen Diktatur und Grausamkeit habe man den Krieg geführt. Man hat die Sache am falschen Ende angefaßt.
Nicht der Krieg ist das Mittel gegen Diktatur und Grausamkeit, sondern, so Edwards Überzeugung, er bringt erst die Grausamkeit hervor, verkörpert sie.
Auch die Geschichten, die Edward Mutters Alice beisteuert, handeln von den Schrecknissen des Krieges und dem, was er bei den Menschen hinterlässt. Geschildert werden die persönlichen Schicksale von Müttern, die vergeblich auf ihre Söhne warten. So in der Geschichte einer Mutter, die eigens nach Paris fuhr, um ihren Sohn dort abzuholen, der aber nicht kam. Oder die der alten Frau, die ihre drei Söhne im Krieg verloren hat und vor dem Dom zu Naumburg, auf einer Bank sitzend, über die Frage nach dem Sinn des Krieges räsoniert. Es sind dies die Fragen, die auch Edward hat, hier dargestellt aus der Perspektive einer leidgeprüften Mutter:
Alles muss einen Sinn haben
‚Warum hat man sie in solche Kriege geführt? Wer hat das ausgedacht? Können Sie mir eine Antwort geben? Alles muß doch einen Sinn haben. Was man den Jungen gesagt hat, haben sie geglaubt. Sie haben nur Krieg, nur Krieg geschrien, und sogar aus dem Feld haben sie so geschrien. Und nun? … Sollten etwa meine Jungen über den Krieg nachdenken? Haben sie ihn angerichtet? Hat sie einer gefragt? Sie hatten zu parieren und durften ja nur Amen sagen. Herr, Sie wollen mich trösten und können sich selbst nicht trösten. Sagen Sie mir, Herr, wer hat den Krieg gemacht?‘
‚Um Himmels willen, was fragen Sie? Das Vaterland rief. Wir folgten unserem Führer!‘
‚Dem Kaiser im ersten Krieg und verloren, dem Führer im zweiten Krieg und verloren. Mein blinder, toter Junge wurde nicht gefragt und die beiden anderen auch nicht. Aber liegenbleiben durften sie.‘
‚Das Vaterland.‘
Bin ich auch. Jawohl, das Vaterland bin ich auch. Meine Jungen sind auch das Vaterland.‘
Erst das Fressen, dann die Moral
Döblin stellt in dieser Geschichte die alte Frau als eine Art Mutter Courage dar, die, wie bei Bert Brecht, erkannt hat, dass hinter der Ideologie von Volk und Vaterland, Treue und Gehorsam mächtige Interessen stecken, deren Repräsentanten den Krieg zu verantworten haben und aus ihm Nutzen ziehen. Sie macht sich auf die Suche nach den Verantwortlichen, ganz konkret vor Ort.
Und da begann die Mutter – Anklägerin, nicht im Amtsrock, sondern im Rock der armen Frau, und nicht mit Paragraphen im Kopf, sondern mit Empörung und Leid im Herzen-, begann die Mutter ihren Weg und wollte Polizei und Staatsanwalt zugleich sein und suchte sie nacheinander in ihrem Häusern auf, die wohl die Schuldigen, die Helfer, die Ausführer, die Nutznießer waren.
Sie geht zu den Vertretern der Obrigkeit: zum Pfarrer, den sie als Mörder anklagt und der sie abweist; zum Industriellen, der seine Hände in Unschuld wäscht, und sogar zum Gewerkschaftsführer, der sich ebenfalls freispricht. Sie wird rüde abgewiesen, hinausgeworfen und selbst noch beschuldigt, Unruhe zu stiften. Danach fragte sie sich, was mit dem Volk, den einfachen Leute los sei:
Es konnte doch nicht möglich sein, daß alle Menschen solch stumpfes Volk seien. Da sollte man noch nicht einer Sache auf den Grund gehen dürfen, wenn man dabei seine Söhne verloren hat? Und sie ging unter die Leute, die in einer Schlange nach Lebensmitteln anstanden. Sie wurde in die Reihe gestoßen.
Da konnte sie sich nicht befreien. Die Leute waren wie wild, sie wollte Kartoffeln, Marmelade, und einige schimpften. Aber die meisten drängten bloß, stumpf und unglücklich. Sie waren so klein und so stumpf, daß sie nicht einmal klagen konnten. … Und da verging der Mutter die Wut und der Haß.
Resigniert sieht sie ein, dass es den kleinen Leuten erst einmal ums Überleben geht und nicht um große Erklärungen für den Grund ihres Elends. Ganz nach Brechts sarkastischer Devise, dass erst das Fressen kommt und dann die Moral.
Vergebliches Ringen um Gerechtigkeit
Diese anrührende Geschichte der alten Frau findet schließlich, da auf Erden keine Gerechtigkeit zu erlangen war, ihre wundersame Fortsetzung im Himmel, wo ein Kundschafter von dem Gemetzel auf Erden berichtet und den Engel Michael auf den Plan ruft. Dieser jedoch ist seiner Mission, für Gerechtigkeit auf Erden zu sorgen, auch nicht mächtig und verbarrikadiert sich hilf- und kraftlos im Dom zu Naumburg. Die alte Frau ist nach wie vor im Spiel. Sie verlangt Einlass, hämmert am Portal, schlägt ihre Thesen an – wie Luther – und fühlte sich so stark, daß sie fast Sankt Michael um sein Pferd und seine Waffen gebeten hätte, um selber zu reiten und sich ihr Recht zu holen.
Das anscheinend vergebliche Ringen um Recht und Gerechtigkeit hat im Fall der alten Frau immerhin zum Erkenntnisgewinn in Sachen Ursachen für und Schuld am Krieg geführt – und das auf eine formal und stilistisch höchst originelle Weise, mit Ironie und Dialektik, Phantasie und bitterem Realismus.
Verhältnis der Geschlechter
Das zweite Schwerpunktthema, das den erzählten Geschichten im Kreise der Allison-Familie zugrundeliegt, ist die Liebe und das Verhältnis der Geschlechter, und zwar in allen möglichen Schattierungen. Wenn etwa der mittelalterliche Knappe, der auf Freiersfüßen wandelt, sich aus heiterem Himmel in ein Madonnenstandbild verliebt und seinen der Angetrauten versprochenen Ring dieser imaginären, heiligen Geliebten anvertraut, so handelt es sich hier um die Versinnbildlichung der reinen Liebe; mit dieser Idealisierung soll möglicherweise und im Kontrast dazu auf den miserablen Zustand des realen Ehelebens bei den Allisons hingewiesen werden. In der Geschichte von Troubadour und der Prinzessin, die als Gleichnis für die ewige Liebe verstanden werden soll, gerade weil sie auf reiner Fiktion beruht, kommen Rollenspiel, Vortäuschung und Verstellung vor, die auch die Ehe der Allisons kennzeichnen. Allein schon, dass Gordon, der Schriftsteller, als Lord Crenshaw auftritt und als vermeintlich Geadelter im Reich der Phantasie seinen Wahrnehmungshorizont erweitert, kommt einer Art Versteckspiel und Flucht aus der Realität gleich, für die auch das Arbeitszimmer als Refugium und Schutzraum dient. Wenn Gordon die Liebeslyrik von Michelangelo interpretiert und dabei auf die Tragik von dessen Leben verweist, niemals die Liebe gelebt zu haben und dennoch voller Sehnsucht danach gewesen zu sein, so scheint er damit auch auf sein eigenes Unglück zu verweisen. Einem späten Eingeständnis gegenüber seinem Schwager James Mackenzie ist zu entnehmen, dass seine große Liebe zu Alice – seine Vergötterung – von ihr nie recht erkannt und angenommen wurde. Stattdessen steht er in der Schuld, die Liebe und das Leben der Alice zerstört zu haben. Wenn Alice von der Theodora im alten Ägypten erzählt, deren Gatte Philippus verschollen geglaubt war und die vom Verehrer Titus bedrängt wird, so spiegelt sich in dieser Konstellation ihr eigenes Lebens- und Liebesdrama: ihre Liebe habe immer nur dem verschollenen Marinesoldaten Glenn gegolten und nicht Gordon; das Phantasma dieser Liebe, die einem Wahn gleichkommt, gipfelt in der Behauptung, Edward sei nicht Gordons Sohn, sondern der von Glenn.
Offener Kampf der Eheleute
Es kommt zum offenen Kampf der Eheleute – mit gegenseitigen Beschuldigungen, Anklagen, Vorwürfen; aber es kommen auch Wahrheiten auf den Tisch, die sonst vertuscht, vermieden, verleugnet wurden. Alice will sich aus der als Einengung, Beschränkung und Zwang empfundenen Ehe befreien.
‚Du sollst mich freigeben.‘
‚Warum gehst du nicht, wenn die Tür offensteht?‘
‚Du sollst mich freigeben.‘
‚Du kannst nicht, weil du an mir hängst.‘
‚Ich an dir, ich an Gordon Allison?‘
‚So wie er an dir. Wir sind eins. Du bist eine Bestie wie ich.‘
‚Ich wie du?‘
‚Ja, kleine Bestie, darum hängst du an mir. Du bist froh, daß ich dich hinter deiner Maske hervorgeholt habe. Ich hab dich befreit. Ja, starr mich nur an, ich dich. Du warst eine Fiktion, eine Rolle, zu der du dich verdammt hattest. Ich gab dir das Leben.‘
Sie kreischt: ‚Ich hatte vorher keins?‘
‚Kein echtes, kein wahres, ehrliches, menschliches.‘
‚Viehisch mit dir heißt menschlich sein.‘
‚Man soll sich nichts vormachen. Die Lüge ist das Schlimmste von allem. Besser das Vieh, das man ist, als der Engel, der man nicht ist.‘
‚Und warum, du Bösewicht, zeigst du dich den Leuten nicht, wie du bist, Lord Crenshaw? Warum immer neue Masken?‘
Die Maskerade, das Rollenspiel, die Verstellung und die Lüge haben ein Ende: einer nach dem anderen verlässt das Haus. Alices Ausbruch in die Freiheit endet ebenso tragisch wie Gordons finaler Versuch, sie aus neuer Demütigung und Unterdrückung in der Unterwelt durch Gangster und Ganoven zu befreien – und fällt dabei der Gewalt, die Alice angetan wird und der sie sich unterworfen hat, selbst zum Opfer.
Kriegskrüppel und Psychopath
Über den Roman hinweg durchlaufen beide Allisons eine Art Identitätswandel, eine vermeintliche oder tatsächliche Metamorphose: Gordon entwickelt sich vom Wüterich über den Eremit zum Geläuterten; Alice von der treusorgenden Mutter und dem Engel des Hauses über die gefühlskalte Freiheitsverfechterin zum armen Geschöpf und Opfer. Diese Verwandlungen sind allerdings weniger eindeutig und offensichtlich als es hier den Anschein haben mag, denn Döblin setzt häufig das Stilmittel der Projektion ein, womit dem Geschehen eine bewusste und beabsichtigte Mehrdeutigkeit verliehen wird. Von einer Metamorphose kann auch im Fall von Edward gesprochen werden: aus dem jungen Soldaten wird der Kriegskrüppel und Psychopath, der sich zum befreiten Mann mit einer offenen Zukunftsperspektive entwickelt; am Ende seiner radikalen Selbstanalyse gelingt es ihm, sich Gewissheit in Bezug auf die ihn bewegenden Fragen zu erlangen und sich als Person zu emanzipieren.
Der Erkenntniswert des Romans liegt u.E. darin, dass Döblin die Entstehung von Gewalt- und Ausbeutungsverhältnissen bis hinein in die familiären Strukturen untersucht. Damit stellt sich die Frage nach der Stabilität der Gesellschaft, ja der Demokratie insgesamt. Döblin erweist sich in diesen Passagen als skeptischer Realist. Er hat erlebt, wie leicht sich Menschen verführen lassen und wie prekär demokratische Institutionen sind. Das prägt auch seine Sicht der kleinen Leute, von denen er offensichtlich nicht viel erwartet:
Zwei Dinge charakterisieren den kleinen Mann: die Furcht und die Phantasie. Die beiden gehören zusammen; Furcht macht phantastisch. Furcht und Phantasiebilder hindern den Durchschnittsmenschen, zum Dasein zu gelangen, und lähmen ihn so, dass er in die Hände anderer fallen muß, die sich dann seiner bedienen. Jeder, der irgendwo am Steuer steht, weiß, wie folgsam der kleine Mann ist. Im Handumdrehen springt er aus der realen Welt heraus und ergeht sich und delektiert sich an Phantasien … Die Klugen benutzen das. Die Kleinen stürzen sich, wo sie können, in Träumereien und verkaufen ihre Realität und sich dazu. Politiker, Wirtschaftler, Geldmänner und Gauner sind die einzigen Menschen, die es vorziehen, mit Tatsachen umzugehen. Die Wissenschaftler kann ich nicht dazurechnen, denn ich fand: sie sind außerhalb ihrer Arbeit auch nur kleine Leute.
Und weiter heißt es: Was sagt die Demokratie zu Ihren Vorstellungen? Die realen Verhältnisse werden durch die Einrichtungen dieser oder jener Staatsform nicht geändert. Vernunft bleibt Vernunft, und Einbildung Einbildung. Demokratie erfordert viel Propaganda und intelligente, gutbezahlte Leute. Besonders in der Demokratie muß man den Leuten imaginär viel bieten, weil man ihnen sonst nichts bieten kann, sondern nur viel wegnehmen, beziehungsweise vorenthalten will. Die Leute sind aber in der Regel für die kleinste, autoritativ verabfolgte Gabe dankbar.
In der Demokratie finden darum die Dichter ihren richtigen Platz. Hier werden Einfälle und zündende Ideen ständig benötigt, denn sie bilden tägliche Gebrauchsartikel. Man muß freilich Sorge dafür tragen, dass nicht eine einzelne Idee wirklich die Oberhand gewinnt. Jeder muß das Recht behalten, zwischen Ideen zu wählen. Er kann sich aussuchen, welche ihm Spaß macht, aber dabei muß es bleiben. Das heißt: er kann wählen, womit er sich betrinken will.
Wir erleben gerade eine Periode der Postdemokratie. Viele relevante Entscheidungen fallen nicht mehr in den Parlamenten, sondern in halbstaatlichen bzw. überstaatlichen Institutionen. Die Parlamente dienen oft nur noch als Fassade für die zur Schau gestellte Inszenierung von Politik. International vernetzte Banken sind heutzutage mächtiger als ganze Staaten; letztere werden immer mehr zu Geiseln großer Banken und Konzerne. Demokratie muss den Leuten imaginär viel bieten, hatte Döblin geschrieben. Das besorgen heute u.a. die weltumspannenden elektronischen Medien Facebook, Google und YouTube, die mit ihren Steuerungsmechanismen die öffentliche Meinung prägen. Für allzu viel Optimismus, dass sich die Dinge zum Guten wenden, besteht wenig Anlass. Für mehr Aufmerksamkeit, was die Veränderungen im gesellschaftlichen Nahbereich betrifft, sehr wohl. Bei Döblin finden sich dafür einige Anknüpfungspunkte.
Bildquelle: Wikipedia, public domain