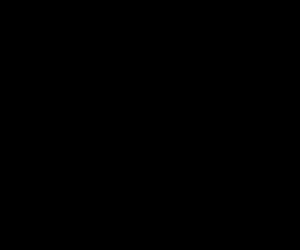Es gab einmal eine Partei, die nannte sich die Linke. Sie kämpfte für soziale Gerechtigkeit, sie kümmerte sich um die Sorgen der kleinen Leute im Osten der Bundesrepublik. Einer ihrer Vorsitzenden, Martin Schirdewan(46), der aus Ostberlin kam und dessen politische Laufbahn in Erfurt begann, sagte nach seiner Wahl vor Jahr und Tag: „Viele Familien sind nicht mehr sicher, ob sie ihre Kinder mit einer Käsestulle in die Schule schicken können.“ Ein Satz, der die missliche Lage vieler Niedrigverdiener gerade in den neuen Ländern trefflich beschreibt und der uns eigentlich die Schamröte ins Gesicht treiben müsste. Und der einer Partei mit linkem Anspruch die Stimmen vieler Wählerinnen und Wähler sichern müsste. Tut es aber nicht, weil diese Partei sich seit vielen Monaten nur noch mit sich selbst beschäftigt, mit Sahra Wagenknecht, einer einstigen Leitfigur der Linken, die von vielen Sympathisanten längst mehr als Leid denn als Leuchtturm gesehen wird. Und die seit langem mit dem Gedanken spielt, eine eigene Partei zu gründen, was die Spaltungstendenzen der Linken nur noch vergrößert.
Gerade hat die Fraktionschefin der Linken, Amira Mohamed Ali, betont, sie werde nicht mehr für das Führungsamt kandidieren. Mal abgesehen davon, ob die Chefin wiedergewählt worden wäre, was man wegen ihrer Nähe zu Wagenknecht bestreiten darf, belegt der Auftritt von Amira Mohamed Ali die Zerrissenheit der Linken. Und das in einer Zeit, da diese Partei sich einen solchen Streit um Personen gar nicht leisten kann. Sie verliert Mitglieder und Sympathisanten, die sich mit ihren Sorgen von der Linken nicht mehr vertreten fühlen. Die einstige Protestpartei im Osten hat ihre Führungsrolle jenseits der Elbe verspielt und verloren an die rechtsextreme AfD. Ausgerechnet. Bei der letzten Bundestagswahl schaffte die Linke nur den Einzug ins Parlament, weil sie drei Direktmandate gewonnen hatte. An der Fünf-vh-Hürde war sie gescheitert. Wenn jetzt im Streit um Wagenknecht und Amira Mohamed Ali ein paar Linke die Fraktion in Berlin verlassen würden, wäre die Fraktion am Ende, aufgelöst. Ob ein solches Warnsignal, von Dietmar Bartsch gerade ausgesprochen, die Linken zu mehr Geschlossenheit bewegt, ist nicht ausgemacht. Wagenknecht macht ihr Ding, aber andere Linke auch.
Wahlpropaganda gegen Schröder
Die Frage ist ja längst, wofür die Linke denn überhaupt steht? Für soziale Gerechtigkeit? Wenn dies nur noch ein Spruch ist für den Wahlkampf, können sie das vergessen. Die von der Linken gern kritisierte Ampel-Regierung hat inzwischen den Mindestlohn leicht erhöht, mehr wäre besser, scheitert aber wohl aktuell an der FDP. Es würde nicht reichen, wie gehabt die SPD wegen Hartz IV zu attackieren, weil sich die Partei gelöst hat von der Hartz-IV-Politik Gerhard Schröders, von der einst die Linke profitierte. „Hartz IV, das ist Armut per Gesetz“. So die Wahlpropaganda gegen den SPD-Kanzler, die zugespitzt war, überzogen, aber giftig und griffig. Die Propaganda verfing vor allem bei den Leuten im Osten der Republik, wo die Linke ohnehin stark vertreten war. Aber auch im Westen folgten der Linken verärgerte, ja frustrierte Sozialdemokraten.
Entstanden war die Linke ausgerechnet aus der einstigen kommunistischen DDR-Staatspartei SED(der einst auch Gregor Gysi angehört hatte und deren Vorsitzender er 1989/90 war)), die sich dann zur PDS(Vorsitzender: Gregor Gysi) wandelte. Und im Zuge des Streits um die Hartz-IV-Gesetze verließen viele Sozialdemokraten die SPD, gründeten mit dem IG-Metall-Gewerkschafter Klaus Ernst die WASG(Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit) und diese Gruppe fusionierte dann 2007 mit der PDS zur Partei „Die Linke“. Gründungsvorsitzende: der ehemalige SPD-Chef Oskar Lafontaine und Lothar Bisky einst PDS-Chef.
Oskar Lafontaine, der Ehemann von Sahra Wagenknecht, hat die Linke vor einem Jahr verlassen. Inwieweit der ehemalige SPD-Chef, Oberbürgermeister von Saarbrücken, Saar-Ministerpräsident, Bundesfinanzminister im ersten Kabinett von Kanzler Schröder, heute noch Einfluss auf die Entwicklung der Partei Die Linke nimmt, ist ungewiss. Ob er Sahra Wagenknecht bei ihrem Gedankenspiel über die Gründung einer neuen linken Partei berät, ihr zu-oder abrät? Oskar Lafontaine wird im September 80 Jahre alt, Sahra Wagenknecht(sie sind seit 2014 verheiratet) ist fast 26 Jahre jünger. Es ist unvergessen, wie Lafontaine damals 1999 die Brocken hinwarf als Minister, dann als SPD-Chef, schließlich die Partei verließ, der er 1966 beigetreten war. Derselbe Lafontaine, ohne den Schröder nie Kanzler geworden wäre, der Lafontaine, der auf dem Mannheimer Parteitag 1995 die SPD aus ihrer Lethargie gerissen und den amtierenden Parteichef Rudolf Scharping abgelöst hatte. Der als Kanzlerkandidat der SPD 1990 gegen Helmut Kohl, den sogenannten Kanzler der Einheit, chancenlos war, zumal er nach dem lebensgefährlichen Attentat körperlich geschwächt war. Aber er trat an, weil die SPD-Spitze es wollte. Ob er seinen Austritt aus der SPD bereut hat? Jedenfalls hat sein Ausscheiden damals der SPD schwer geschadet.
USA-Krieg gegen Irak
In Kommentaren kann man Oskar Lafontaine gelegentlich gegen Amerika wettern lesen, gegen die Dominanz der USA, deren weltweiten angeblich verheerenden Einfluss. Der Irak-Krieg unter Führung Amerikas war völkerrechtswidrig, Deutschland machte damals nicht mit, weil der SPD-Kanzler Schröder US-Präsident George W. Bush die Stirn bot. Später stellte sich heraus, dass die für den Krieg herbeigeschafften Argumente der Amerikaner gelogen waren. Es gab keine Biowaffen-Produktion im Irak. Washington ist nie dafür verurteilt worden, es gab keiner Sanktionen gegen die USA. Natürlich kennt einer wie Lafontaine die Vorgeschichte des Krieges von Putins Russland gegen die Ukraine, weiß er um die Konflikte, die sich aus der Ost-Erweiterung der NATO ergaben. Aber all das gibt doch Wladimir Putin nicht das Recht, den Nachbarn zu überfallen, das Land zu zerstören, Menschen, töten, Kinder entführen und Frauen vergewaltigen zu lassen. Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands spaltet die Linke, weil sie sich immer noch Moskau stark verbunden fühlt. Putins Krieg wird von nicht wenigen Linken verharmlost, Waffenlieferungen an die Ukraine werden abgelehnt. Als wenn das so einfach wäre! Mit naivem Pazifismus wird man Putin nicht beikommen und einem möglichen Waffenstillstand oder gar Frieden auch nicht.
Die Linke wird dringend gebraucht. Das sagte die Linke vor einiger Zeit über sich. Aber da merkte man schon die Sorge vor einem weiteren Bedeutungsverlust dieser Partei. Ein paar Zahlen belegen eine für sie gefährliche Entwicklung. In Brandenburg hatte die Linke 2009 immerhin 27,2 Prozent Zustimmung bei Wahlen, zehn Jahre später ist sie abgerutscht auf 10,7 Prozent. In Sachsen sackte die Linke im gleichen Zeitraum von 20,6 auf nur noch 10,4 Prozent. Ähnlich die Entwicklung in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen-Anhalt. Einzig in dünn besiedelten Thüringen konnte sie sich halten und stellt mit Bodo Ramelow ihren einzigen Ministerpräsidenten in der Bundesrepublik. In den
Ländern im Westen, in NRW, Schleswig-Holstein und im Saarland, scheiterte die Linke zuletzt an der 5-vh-Hürde. Bei den Wahlen im Oktober in Bayern und in Hessen sind ihre Aussichten eher düster. Und im nächsten Jahr muss sie sich gegen die AfD im Osten behaupten.
Leicht wird das nicht, vor allem, wenn die Linke ihre ewigen Personaldebatten nicht beendet und sich mit dem beschäftigt, was ihre Sache wäre: mit den vielen Sorgen der kleinen Leute, mit Sozialabbau, mit der Wohnungsnot, mit dem unsicheren Leben der Menschen. Mit den Problemen, die die Migration mit sich bringt. Dass man mit Gerhard Trabert einen Kandidaten für die Europa-Wahl nominiert hat, der mit seinem Arzt-Mobil der Mediziner der Armen ist, der auch und gerade Obdachlose behandelt, ist ein Anfang. Beim Klimaschutz reicht es nicht, zu behaupten, da sei man radikaler als die Grünen. Und mit einer Verklärung Russlands ist es ohnehin nicht getan.
Ob die Linke gebraucht wird, entscheidet sie selbst. Ihre Nabelschau ist kein Ersatz für eine sachpolitische Diskussion. Die Linke heute steht nicht nur vor der Spaltung, sie steht vor ihrem Ende.