Was gibt es für einen Grund, sich in Zeiten der sogenannten Dienstleistungsgesellschaft mit dem Thema des Dienens zu befassen? Könnte es mehr sein als die bloße Liebhaberei zu zwei Romanen, die der Vergangenheit angehören? Kommt ihnen vielleicht heute noch eine soziale Relevanz zu? Diesen Fragen soll am Schluss Aufmerksamkeit geschenkt werden, nachdem ich mich mit dem Stoff in seiner ästhetischen Form vergleichend auseinandergesetzt habe.
Beide Romane stehen inhaltlich in einem wundersamen Komplementärverhältnis: Robert Walsers Jakob von Gunten will das Dienen in der Anstalt Benjamenta erst noch erlernen, während bei Hermann Lenz dem Diener Wasik das Dienen schon immer in Fleisch und Blut war, dem aber durch veränderte gesellschaftliche Umstände die Existenzgrundlage für die Ausübung seiner Tätigkeit abhanden zu kommen droht. Bemerkenswert ist, dass Lenz einen historisierenden Roman geschrieben hat; neunzig Jahre, nachdem Walser sein Werk verfasst hatte, schreibt Lenz über den Diener Wasik in einem Erzählzeitraum der ersten zwanzig Jahre des 20. Jahrhunderts, also der Zeit, in der auch der Gunten-Roman spielt.
Robert Walser war selbst mehrere Wochen in einer Dienerschule, bevor er den Roman Jakob von Gunten schrieb. Er weiß also, wie es dort zugeht und was man dort lernt. Walser lässt seinen Jakob aus freien Stücken eine solche Anstalt, benannt nach ihrem Vorsteher Benjamenta, besuchen, um sich den Fängen seiner Herkunft, einem Adelsgeschlecht, und konkreter noch dem erdrückenden Zugriff seines Vaters zu entziehen. Ironischerweise wählt Jakob dafür die Unterwerfung unter das strenge Regime einer Anstalt, in der nichts anderes gelernt und gelehrt wird als der blinde Gehorsam, die Unterordnung unter Regeln und Gesetze, die keinen anderen Sinn haben als die Einübung von Verhaltensweisen der Demut, Geduld und Bescheidenheit. Eine wichtige Voraussetzung dafür ist in diesem Institut, zu lernen, dass man selbst ein Nichts ist und es immer bleiben wird.
Die Zöglinge werden in ihrer Verschiedenheit durch Jakob peu à peu vorgestellt und lassen sich grob in die Dummen und die Gescheiten einteilen. Einigen der Dummen prophezeit Jakob die Karriere von Emporkömmlingen, die später zum Befehlen wie geschaffen sein werden. Die Gescheiten hingegen – und dazu zählt er sich selbst – werden eher das Dienen beherrschen und etwas Kleines und Niedriges sein oder werden.
Jakob nun ist unter den Gescheiten noch einmal ein Sonderfall, denn er kommt sozial von oben, ist ein Abkömmling, der zur Selbsterziehung aufs Internat gegangen ist, von zu Hause weggelaufen aus Furcht, von der Vortrefflichkeit des Vaters erstickt zu werden. In seinem Lebenslauf, den er für die Anstalt abfasst, ist davon die Rede, dass er eine strenge Behandlung wünscht, damit er von der hochmütigen Tradition seines Geschlechts abfallen kann. Er will, dass das Leben ihn erziehe, nicht erbliche oder irgend adlige Grundsätze. Ein gleichsam demokratisches und republikanisches Motiv, wie es scheint. Doch ist sich Jakob auch bewusst, dass er über bestimmte angeborene Eigenschaften verfügt, die er nicht ohne weiteres abstreifen kann, die aber durchaus nicht hinderlich für das Um-Erziehungsprogramm sein müssen. Dazu gehören neben Mut und Diensteifer ein Ehrgeiz, der ihm befiehlt, hinderliche und schädliche Ehrgefühle zu verachten, um Hochmut und Überhebung erfolgreich bekämpfen zu können. Dazu gehört vor allem aber auch ein besonderer Stolz: Allerdings, er ist stolz, denn es ist ihm unmöglich, die angeborene Natur zu verleugnen, aber er versteht unter Stolz etwas ganz Neues, gewissermaßen der Zeit, in der er lebt, Entsprechendes. Er hoffe, dass er modern, einigermaßen geschickt zu Dienstleistungen und nicht ganz dumm und unbrauchbar ist, aber er lügt, er hofft das nicht nur, sondern er behauptet und weiß es. Hieraus spricht ein Selbstbewusstsein, das Jakob mitgebracht hat und das er gewillt ist, auf die Selbsteinschätzung seiner Fähigkeiten im neuen Betätigungsfeld in spe zu übertragen.
Erstaunlicherweise lässt Robert Walser seinen Jakob schon kurz nach der Jahrhundertwende eine Sicht auf das Dienen als Dienstleistung ausbilden, die in der Tat modern ist. Ein bedeutender Schritt im Blick auf den Wandel einer Tätigkeit, zu der der Diener Wasik – wie noch zu zeigen sein wird – gerade nicht in der Lage ist: Wenn das Dienen hinter der Dienstleistung verschwindet, fühlt er sich nutzlos und seiner Wurzeln beraubt.
Ganz anders Jakob. Er ist mit einem hohen Maß an Durchblick, Gewitztheit und Situationsbeherrschung ausgestattet, so dass man den Eindruck hat, er stehe über den Dingen und Verhältnissen. Jedenfalls verfügt dieser Jakob über die Fähigkeit, Widersprüche und Ambivalenzen nicht nur auszuhalten, sondern zu meistern. Dafür sprechen eine Reihe von Indizien: so etwa, dass er sich zwar unterwirft und klein macht, aber wenn es darauf an kommt und er sich beleidigt oder ungerecht behandelt fühlt, seine Würde verteidigt: Mein Name ist Jakob von Gunten, erklärt er beispielsweise gegenüber dem Vorsteher Benjamenta, und das ist zwar ein junger, aber trotzdem seiner Würde bewusster Mensch. Ich bin nicht zu entschuldigen, das sehe ich, aber auch nicht zu beleidigen, das verhindere ich. Er liebt den Zwang und die Unfreiheit, verspürt aber gleichzeitig eine unbändige Freude an der Verbotsüberschreitung, am Streich als probatem Mittel gegen die Langeweile. Bei allem Hochhalten der Tugenden, die in der Anstalt vermittelt werden, schätzt er an seinem Mitschüler Schacht dessen feinsinnige Unzufriedenheit als Zeichen dafür, dass er Seele hat. Ihm ist die Differenz von Anerkennung und Dank bewusst; nur der Dank passt zum Dienen, nicht die Anerkennung, die nur den Dienenden aufbläst und entkräftet. Sie spielen in der Turn-, Anstand- und Tanzstunde unter Anleitung des Fräuleins Szenen des öffentlichen Lebens oder Stücke aus der Literatur vor. Das Ende eines Stückes ist immer die Verherrlichung und Versinnbildlichung bescheidenen Dienens. Das Glück dient: das ist die Moral unserer dramatischen Literatur. Er lernt geflissentlich zu gehorchen und sich zu fügen, ohne zu denken und sagt dazu: Ich verachte mein ganzes Denkvermögen.
Gleichzeitig verfügt er aber über eine mentale Kraft, die ihn etwa über die Unterschiede zwischen dem antiken und dem modernen Sklaventum reflektieren lässt: Die Gesetze waren damals vielleicht inhuman, gewiss, aber die Sitten und Gebräuche und Anschauungen waren dafür umso zarter und feiner. Heute hätte es ein Sklave viel schlimmer, Gott behüte! Übrigens gibt es sehr, sehr viele Sklaven mitten unter uns modernen, hochmütig-fix und fertigen Menschen. Vielleicht sind wir heutigen Menschen alle so etwas wie Sklaven, beherrscht von einem ärgerlichen, peitscheschwingenden, unfeinen Weltgedanken. Oder, um ein letztes Beispiel zu bemühen, wobei es sich für mich um eine Schlüsselstelle handelt, Jakobs verkehrende Reflexion über das Verhältnis von Herrschen und Dienen in Abhängigkeit von der sozialen Herkunft:
Ich vergesse nie, dass ich ein Abkömmling bin, der nun von unten, von ganz unten anfängt, ohne doch die Eigenschaften, die nötig sind, empor zu gelangen, zu besitzen. (…) Ich habe gar keine Emporkömmlingstugenden. Ich bin manchmal frech, aber nur aus Laune. Der Emporkömmling aber ist von einer permanenten bescheiden-tuenden Frechheit, oder von einer frechen, fortwährend frechen Unbedeutendheitsgebärde. (…) Emporkömmlinge sind Herren, und solch einem Herrn, einem vielleicht etwas protzigen Herrn, werde ich Abkömmling, oder was ich sonst bin, dienen, und ehrenhaft dienen, treu, verlässlich, fest, ganz gedankenlos, ganz unerpicht auf persönliche Vorteile, denn nur so, nämlich anständig, werde ich überhaupt jemandem dienen können.
Als Abkömmling sei er zum Dienen verurteilt und die Person sechsten Ranges im Weltenleben zu spielen; und eine seiner Begründungen dafür lautet, dass er nur in den unteren Regionen atmen könne. Er übernimmt das Gesellschaftsbild seines Bruders, dass alles faul sei, die Reichen (…) sehr unzufrieden und unglücklich, und dass es sich oben (…) kaum noch zu leben (lohnt). Wird hier die Genügsamkeit gepriesen? Oder was steckt sonst hinter dem Drang nach unten? Eine Frage, die erst am Schluss wieder aufgegriffen werden soll.
Die Beispiele mögen vorerst genügen, um aufzuzeigen, mit welchen Pfunden Walser seinen Jakob ausstattet, damit er die Mechanismen aufzudecken vermag, wie sich das Dienen als Existenzform konstituiert und welches Personal dafür zu rekrutieren ist. Der Protagonist hält die Prämissen einer Moral des Dienens hoch, zu der Treue, Verlässlichkeit, Uneigennützigkeit, Ergebenheit, Anstand und eine bestimmte Form von Gedankenlosigkeit (im Sinne des sich nicht Einmischens in die Angelegenheiten der Herrschaft) gehören. Aber alles, was Jakob meint, denkt, fühlt und äußert, scheint ironisch gebrochen und verkehrt sich häufig ins Gegenteilige. Man kann kaum etwas für bare Münze nehmen. Hier ist Martin Walser zuzustimmen, der in seiner Abhandlung über Robert Walsers Prosawerk festhält: Das ist ironischer Stil: etwas im Tone einer Errungenschaft zu erzählen, was dann, als Resultat, doch überraschend wenig, eher das Gegenteil einer Errungenschaft ist.
Wie sieht nun der von Hermann Lenz kreierte Diener Wasik die Welt am Anfang des 20. Jahrhunderts? Wie definiert er seine Rolle? Zunächst sind die Prinzipien und Prämissen des Dienens hier ganz ähnlich denen, die Robert Walser im Gunten-Roman aufgestellt hat. Einem Diener sei es nur darum zu tun, sich herauszuhalten und nichts zu erfahren, also sich allen Angelegenheiten im Hause seines Herrn fernzuhalten, stets sich als Person zurückzunehmen, keine Meinung zu haben, sich nicht einzubringen, nichts zu hören, zu sehen, zu sagen zu haben und nur seinen Pflichten nachzukommen. Den Mit-Bediensteten im Hause, der Pfanni und der Erika, kommt er vor wie eine Attrappe, weil er sich nicht zeigt, und sie meinen es emotional. Erika hätte verstehen sollen, dass ein Diener nichts anderes tun konnte, als Handreichungen zu leisten, und diese Handreichungen hatten nur mit den Händen und mit sonst nichts zu tun. Kopf und Gefühle bleiben außerhalb. Das Dienen hat mit Abstand halten, Grenzen wahren und auch mit Einsamkeit zu tun: Der Abstand herrschte, (…) der ihm wichtig war. Die Grenze ließ ihn allein sein, denn darauf kam es an. Die Einsamkeit war seine Speise. Er sagt von sich: Man wird halt nicht verrückt… Die glaubten also, er sei einer, an den nichts herankomme, und damit hatten die wahrscheinlich recht; denn dieser A. Wasik musste hinter einer Mauer stehen, weil er Diener war. So gehörte sich’s für ihn, das war sein Platz. Ein Diener weiß so viel, schaut zu, und dabei bleibt viel hängen. Deshalb denkt er: mische dich doch nicht auch noch hinein.
All das hat Wasik in Jahrzehnten seiner Dienertätigkeit eingeübt. Er beherrscht seine Aufgaben und Pflichten, die ihm in Fleisch und Blut übergegangen sind, er weiß um seinen Platz, und er hält ein Ethos des Dienens hoch, das unanzweifelbar und unhinterfragt seine Richtigkeit und seinen moralischen Wert hat; er verfügt also über die wesentlichen Eigenschaften und Verhaltensmuster des Dienens, die ihn wie ein innerer Kompass sicher und verlässlich durch den Alltag seines Daseins geleitet.
Der erste Teil des Romans schließt ab mit dem Ende des Ersten Weltkriegs, dem Zusammenbruch der Monarchie 1918 und dem Beginn der Weimarer Republik. Eine Zeitenwende, die dem Dienerstand und -status den Boden zu entziehen droht, weil die Unmittelbarkeit von Herrschaft und Dienen als persönliches Macht- und Abhängigkeitsverhältnis allmählich durch die Dienstleistung abgelöst wird, in der sich das Herrschaftsverhältnis verallgemeinert, abstrakter und anonymer generiert. Jakob von Gunten sieht diese Entwicklung und fühlt sich den modernen Anforderungen des Dienens gewachsen. Wasik ist dazu kaum oder gar nicht in der Lage; er versucht verzweifelt, seine, die alte Zeit und ihre Tugenden hochzuhalten und sich gegen die neuen Entwicklungen, gegen die Zukunft zu stemmen.
Wasik meint: Wenn er sich nicht abgesondert hätte und die anderen ihn durchschauen könnten, wäre er verstrickt in seine Zeit. So aber ist’s nicht nötig, dass es diesen Wasik gibt. (…) Ebensogut nicht vorhanden sein können, das war vorteilhaft. Der Diener, seiner Dienerschaft beraubt, aber seiner Tugenden noch habhaft: ein Nicht-Existenter, Unsichtbarer, aber nicht ohne Identität. In einer Kneipe, dunkel und verräuchert, sitzend und über die vergangene Zeit sinnierend: Etwas fürs Museum des Gemüts… Eine andere Zeit war wichtiger als diese Zeit. Das Versunkene, Abgelegte, das Vergessene und das Entschwundene machten alles zu einem Raum. Die Zukunft blieb ausgeschlossen.
Auch mit zeitlichem Abstand verteidigt er seinen obsolet gewordenen Stand.
Nein, als Sklavendienst war ihm die Arbeit nie erschienen, und es war dumm, wenn in Zeitungen stand, gewisse Dienstverhältnisse erinnerten noch an Leibeigenschaft (…) Wenn die gewusst hätten, wie’s in einem Diener aussah, hätten sie den Mund gehalten; schließlich war’s doch so, dass jeder auf den anderen angewiesen war, ob Herr oder Diener; und das Leben ganz allein bestehen, wer brachte das schon fertig.
Eine Anspielung auf die Herr-Knecht-Dialektik von Hegel, die auf das Wechselverhältnis von Herr und Knecht oder Diener abhebt und im Kern formuliert: Keine Herrschaft ohne Anerkennung dieser durch die Beherrschten. Interessant, dass sowohl bei Robert Walser als auch hier bei Hermann Lenz, die Dienstverhältnisse und das Sklaventum in Beziehung gesetzt werden: Jakob sieht zwar überall moderne Sklaven, grenzt sie allerdings deutlich von Dienern ab; und auch Wasik besteht auf der Differenz, indem er auf eine wechselseitige Verwiesenheit im Dienstverhältnis abhebt, die es seiner Meinung nach von Sklavendienst und Leibeigenschaft unterscheidet.
Die Tugenden des Dieners passen nicht mehr in die neue Zeit. Unsinn, Wasik. Ihre Treue in Ehren, aber sie gehört nicht mehr hierher. Gewöhnen Sie sich Ihre Treue ab. Wasik versteht die Welt nicht mehr. Wie kann sein neuer Vorgesetzter in einer Behörde, in der er inzwischen als kleiner Beamter seinen Dienst tut, von ihm verlangen, sich seine Treue abzugewöhnen? Es ist, als verlange man von ihm, in eine neue Haut zu schlüpfen. All die eingefleischten Verhaltensmuster und Eigenschaften, die zum Wesen des Dienens gehörten und die ihn in den langen Jahren seiner Dienertätigkeit wie ein Stützkorsett sicher durchs Leben geleitet hatten, bieten keinen Halt mehr. Das kommt einem sozialen Tod gleich. Wasik im Unglück.
Die Menschen waren gleichgültig und steinern. Bleibe der Diener Wasik, bleibe außerhalb. Verliere dich nicht außerhalb des Hauses. Vor deiner Haut beginnt die Fremde. Die hat nur ein Haus in dir selbst. Und alles andere verändert sich. (…) Und nur deine Erinnerung lässt dich das Gegenwärtige ertragen.
Wasik verkriecht sich nicht nur in den wenigen vertrauten Winkeln, die er noch aufsucht, nein, er zieht sich in seiner existentiellen Not ganz in sich wie in ein Schneckenhaus zurück. Seine eigene Haut ist sein letzter Schutzwall.
Wer sich in der schwindenden Zeit zurechtfand, hatte es weit gebracht. Auch als Pensionist (Dritter Teil) findet sich Wasik nicht mehr zurecht. Er hängt seinen Erinnerungen nach und betrauert die alten Zeiten. Die Gegenwart – Republik, Demokratie, Kapitalismus – ist ihm fremd. Die Menschen sind sich gleichgültig, alles ist flüchtig, auf nichts ist mehr Verlass. Der Diener hat ausgedient.
Der Roman von Hermann Lenz ist in weiten Teilen in der Form eines inneren Monologs geschrieben. Die stilistisch-sprachlichen Besonderheiten liegen im feinsinnigen Nachspüren eines Verhaltensrepertoires, das wie kein anderes auf Tugenden der Unterwerfung beruht und einem Weltverständnis, das sich an klaren Hierarchien und überschaubaren, persönlichen Herrschafts- und Abhängigkeitsverhältnissen orientiert. Sobald diese anonymer und abstrakter werden, zerbricht das innere Gleichgewicht, und die als unverbrüchlich angesehenen Ordnungsschemata greifen nicht mehr.
Das ist eine andere Problematik als die von Robert Walsers Jakob von Gunten. Hier liegt der Fokus auf dem Erlernen des Dienens als Daseinsform mit Verweis auf ihre zukünftige, praktische Ausübung, während dieses bei Lenz ein soziales Auslaufmodell darstellt. Die moderne Klassengesellschaft kann nichts mehr mit den Tugenden des Dienens anfangen, ist nicht länger darauf angewiesen.
Beide Romane leisten, und zwar nahezu hintereinander geschaltet, einen tiefen Einblick in die subjektiven und objektiven Voraussetzungen für die Existenzform des Dienens. Sie unterscheiden sich in Form und Stil. Über den Roman von Lenz ist hierzu schon etwas gesagt. Walsers Roman hat die Form eines Tagebuchs; jedenfalls lässt er Jakob gegenwärtig und ab dem Zeitpunkt des Eintritts ins Institut Aufzeichnungen machen, so dass der Eindruck entsteht, man sei Zeuge einer Initiation und eines Eingewöhnungsprozesses in das Regime der Anstalt. Ein weiteres formales Merkmal ist das Selbstgespräch und die Selbstvergewisserung aus der Perspektive Jakobs. Der Stil ist ironisch, und nur mit dem Verweis auf Ironie ist auch die zentrale Frage zu klären, was einen Abkömmling wie Jakob so ostentativ nach unten zieht. Dieses Phänomen kann wohl kaum mit dem Streben nach Genügsamkeit und Verzicht auf adlige Privilegien erklärt werden; für eine Verzichtsmoral fehlen die Anhaltspunkte. Jakob treibt eher ein Freiheits- und Selbstbestimmungsverlangen um, eine Art Emanzipation von seiner Klasse, Herkunft und Familie, insbesondere vom unerreichbaren Vater. Und wenn Selbstbestimmung und Selbsterziehung nur um den Preis des sozialen Abstiegs zu haben sind, dann scheint Jakob gewillt, diesen Preis zu zahlen. Genauso widersprüchlich sieht es mit dem Freiheitsdrang aus: Wenn dieser nur in der Knechtschaft der Anstalt und später als Diener eines Herren zu realisieren ist und Jakob diese möglicherweise weniger bedrückend empfindet als die Knechtschaft seiner Herkunft, dann ist es folgerichtig, diesen Weg zu gehen. Aber nichts ist eindeutig bei Robert Walser. Jakob flieht nicht nur und distanziert sich, er weiß auch um das Erbe seiner Vergangenheit in Form von Eigenschaften wie Stolz oder Würde, ob als Herkunftswürde oder sogar noch als kleine, schmiegsame Zöglingswürde, und seinen Wert. Ihm ist bewusst, dass er die Spuren, die seine Herkunft in ihm hinterlassen hat, als Eigenschaften nicht vollständig abstreifen kann – woraus er eine Tugend macht und sie nutzt. Insofern ist er der Sonderling in der Anstalt – kein anderer, ob dumm oder gescheit, verfügt über diese Distanz oder Fähigkeit zur Distanzierung.
Unter den Aspekten des Verhaltensrepertoires qua sozialer Herkunft lässt sich ein Vergleich anstellen, der die Differenz zwischen beiden Protagonisten deutlich macht: Jakob kommt aus dem Adel bzw. der Oberklasse; über diese Prägung ist sich der junge Mann relativ bewusst, er macht sie sich teils zunutze; andere Eigenschaften hingegen (wie etwa Hochmut, Überlegenheitsgefühl, soziale Arroganz) sollen bewusst einer Transformation unterzogen werden. Ein Selbsterziehungs-Programm, das Jakob nur mit Hilfe der Anstalt und ihres Regiments meint leisten zu können. Wasik kommt hingegen aus der Unterklasse; auch wenn wir kaum etwas über seine Biographie wissen, spricht vieles dafür, dass er zum Dienen nahezu geboren ist. Diese Disposition gerät nun durch eine Zeitenwende in die Krise. Eine Anpassung an veränderte gesellschaftliche Umstände, ein reflektierter Umgang mit dem Wandel, wie ihn Jakob anstrebt oder vornimmt, ist Wasik nicht möglich; dazu fehlen ihm auch die intellektuellen Voraussetzungen. Moderne Dienstleistungen sind ihm fremd, weil die persönlichen Tugenden wie Treue, Gehorsam, Unterwerfung etc., ihm zur zweiten Natur geworden, nicht mehr in alter Form gefragt sind. Folgerichtig wird Wasik in der neuen Welt realitätsuntüchtig – das ist die Tragik seines Schicksals, das ihn nur noch in die innere Emigration und ins private Unglück führt.
Nun könnte man meinen, mit dieser hier aufgezeigten Problematik habe man heute nichts mehr zu schaffen. Dem ist nur bedingt zuzustimmen. Denn zum einen gibt es im modernen Dienstleistungsbereich vielfältige Formen von Dienstleistungen mit zum Teil äußerst prekären Beschäftigungsverhältnissen (in privaten Haushalten, der Zulieferung von Frachtgütern und Waren durch Botendienste, den Fahrrad-Kurierdiensten für Nahrungsmittel, im Reinigungsbereich, Hotel- und Gaststättengewerbe u.a.m.) und mit Verdiensten jenseits von Tarifen und Mindestlöhnen, die dem von Robert Walser schon vor hundert Jahren so bezeichneten modernen Sklaventum nahekommen. Man fragt sich, wie diese Beschäftigten an demokratischen Prozessen partizipieren sollen. Zum anderen zeigen die beiden Romane minutiös die Entstehung autoritär geprägter Sozialcharaktere auf: einmal durch obrigkeitsstaatliche Gesellschaftsstrukturen und zum anderen durch hierarchisch-patriarchalische Familienverhältnisse. Einen solchen Charaktertyp hat Heinrich Mann in seinem Untertan dargestellt. Auch Michael Hanekes Film Das weiße Band steht in dieser Tradition, indem er die Erziehung zum autoritären Charakter (Adorno/Horkheimer) und zur Gefolgschaft in der Nazizeit aufzeigt. Angesichts des erneuten Anwachsens rechter, autoritärer Gesinnungen in vielen Ländern zeigt sich die gesellschaftspolitische Relevanz der hier behandelten Stoffe bis heute.
Bildquelle: pixabay, qimono, CC0 Creative Commons



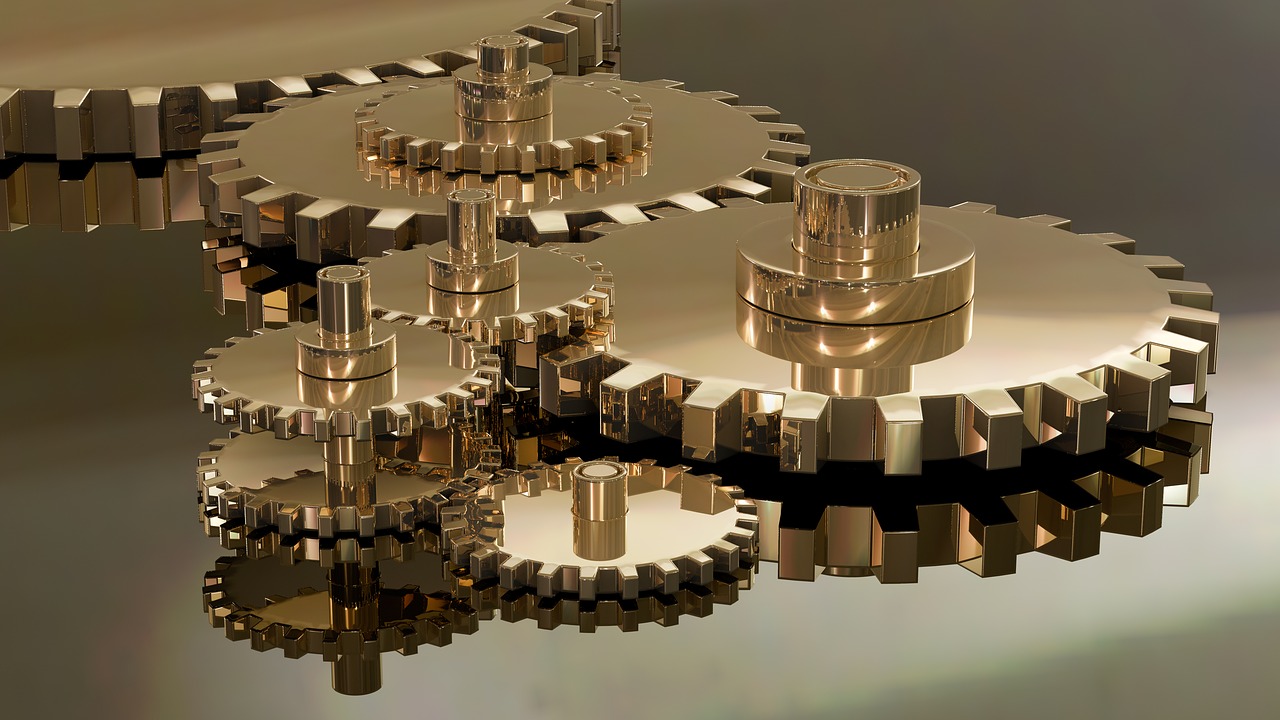













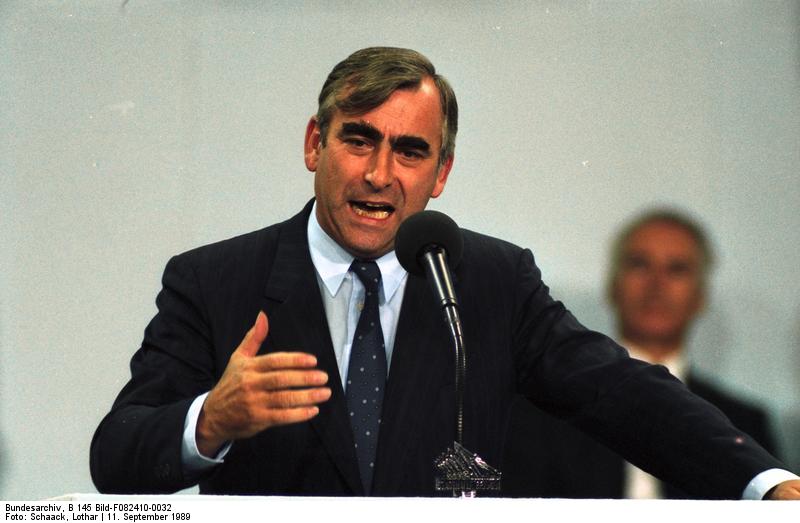
Comments 1