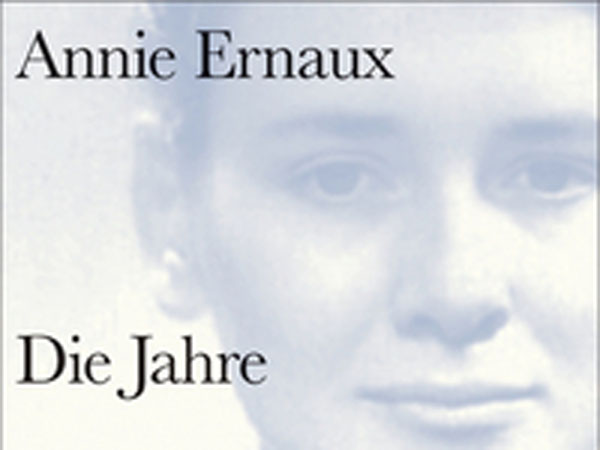Ein vollkommenes Leseerlebnis, spannend obwohl kein Krimi, lehrreich obwohl kein Geschichtsbuch, persönlich obwohl keine Biografie, europäisch, obwohl alles sich nur in Frankreich ergibt. „Etwas von der Zeit retten, in der man nie wieder sein wird.“ Das ist der letzte Satz auf Seite 256 des Taschenbuchs – aber die Leser*innen werden darin gewesen sein, in der Zeit ungefähr zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dem 11. September 2002, als in New York die Türme
des World-Trade-Centre in sich zusammen sackten und dem Moment als der Sieg Sarkozys bei den Präsidentschaftswahlen unvermeidlich erschien.
Einerseits orientiert sich das Buch am Leben der Autorin, aber es handelt von den Umständen, wie sie sich einer gemäßigt linken, französischen Lehrerin gezeigt haben. Wie anfangs die Alten die Gespräche dominieren, die immer wieder auf die beiden Weltkriege kommen, wie das Thema mit den Alten verschwindet und durch andere ersetzt wird; wie das Fernsehen in den Alltag eindringt und die Wahrnehmung verändert; welche Hoffnungen mit der Revolte von 1968 verbunden waren und wie sie allmählich abgeschliffen wurden; wie sich das Vokabular änderte:
„Wer die Wörter „Klassenkampf“, „soziale Gerechtigkeit“, „Kapitalist“ oder „Arbeiter“ in den Mund nahm, wurde mitleidig belächelt. Da sie nicht mehr benutzt wurden, schienen sie ihre Bedeutung zu verlieren. Neue Wörter setzten sich durch(…),“Leistung“, „Herausforderung“, „Profit“. Der „Erfolg“ wurde zur universellen Tugend erhoben (…) Es war die Zeit der Schwätzer“. Den Leser*innen des von Sonja Finck in allerbestes Deutsch übertragenen, schon 2008 in
Frankreich erschienen Buches werden die Aufkleber-Herzen der Zeitung mit den großen Buchstaben einfallen, wenn es bei Ernaux weiter heisst:
„Statt Hoffnung sollte man „ein Herz für“ alles Mögliche haben, sich einen Button anstecken …CDs gegen Hunger, Rassismus, die Armut oder für den Weltfrieden kaufen….“.
Überhaupt: man wird beim Lesen schnell im Kopf die deutschen Hits der jeweiligen Jahre durch die französischen ersetzen können, wenn man die nicht auch kennt und sich schnell erinnern, wer bei uns regierte, als in Frankreich deGaulle, Giscard, Mitterand, Chirac die Politik dominierten. Denn so ist die Geschichte aufgebaut: Fotos der Hauptperson – anfangs sind es die kleinen schwarzweissen mit dem gezackten Rand, später sind es Farbfotos, Super-8-Filme und Videos – leiten Zeitabschnitte ein, Hits der Epoche fügen den Bildern die Töne hinzu – dann wird in knappen Sätzen, sorgfältig formulierten Aufzählungen, manchmal auch verstreuten Puzzleteilen, beschrieben, was war. So setzt sich das Zeitmosaik im Kopf der Leser*innen anschaulich zusammen.
Man wird viele Hoffnungen als eigene wieder erkennen und den Verlust dieser Hoffnungen auch. Man ist gezwungen, das eigene Erleben zu überdenken, den eigenen Umgang mit den äußeren Umständen, den eigenen Gefühlen von Euphorie bis Ohnmacht in Anbetracht der Ereignisse. Und plötzlich ist das individuelle Leben und Erleben der Protagonistin exemplarisch für viele, sehr viele ihrer Zeitgenoss*innen und die Ereignisse in Frankreich werden exemplarisch für die Entwicklung Europas seit der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts. West-Europa muss man präzise sagen, denn der Blick auf die europäische Vereinigung bleibt ein Blick aus quasi unbeteiligten westlichen Augen. Wie es eben war – und vielfach noch ist.
Nostalgie – nein, ein nostalgisches Buch ist das nicht. Es ist eher ein bitteres Fazit der in den Blick genommenen fast 7 Jahrzehnte. Es zwingt zum Nachdenken, zum Innehalten trotz fast atemlosen Weiterlesens – und es hallt lange nach. Ich glaube auch, es jüngeren Leser*innen unbedingt empfehlen zu sollen, denn es beschreibt den Gang des Individuellen im Sozialen und Politischen anschaulich. Den Soundtrack muss man nicht kennen, um die Beschreibungen zu verstehen. Wer wissen will, wie die Gegenwart von 2019 entstanden ist, kann hier Antworten finden – übrigens auch darüber, wie die Entfremdung zwischen Wählern und Gewählten entstanden ist, einer der Nährböden des Rechtsextremismus.
Die Autorin be- oder verurteilt, anders als ihre Protagonistin, wenig, benennt und beschreibt die Zeit, in die es kein Zurück mehr gibt, analysiert sie nicht, aber weiß, was die Veränderungen der eigenen Haltung zugemutet, wie sie die Protagonistin verändert haben. Dann steht da Sso ein Satz:
„Der Konsum löste die Ideale von 1968 ab.“
Schockiert stellt die Leserschaft fest: das stimmt. Auf diese Weise schafft Annie Ernaux eine neuartige Erzählweise und schreibt – große Literatur!
Annie Ernaux: Die Jahre. Suhrkamp 2019
Bildquelle: Buchtitel