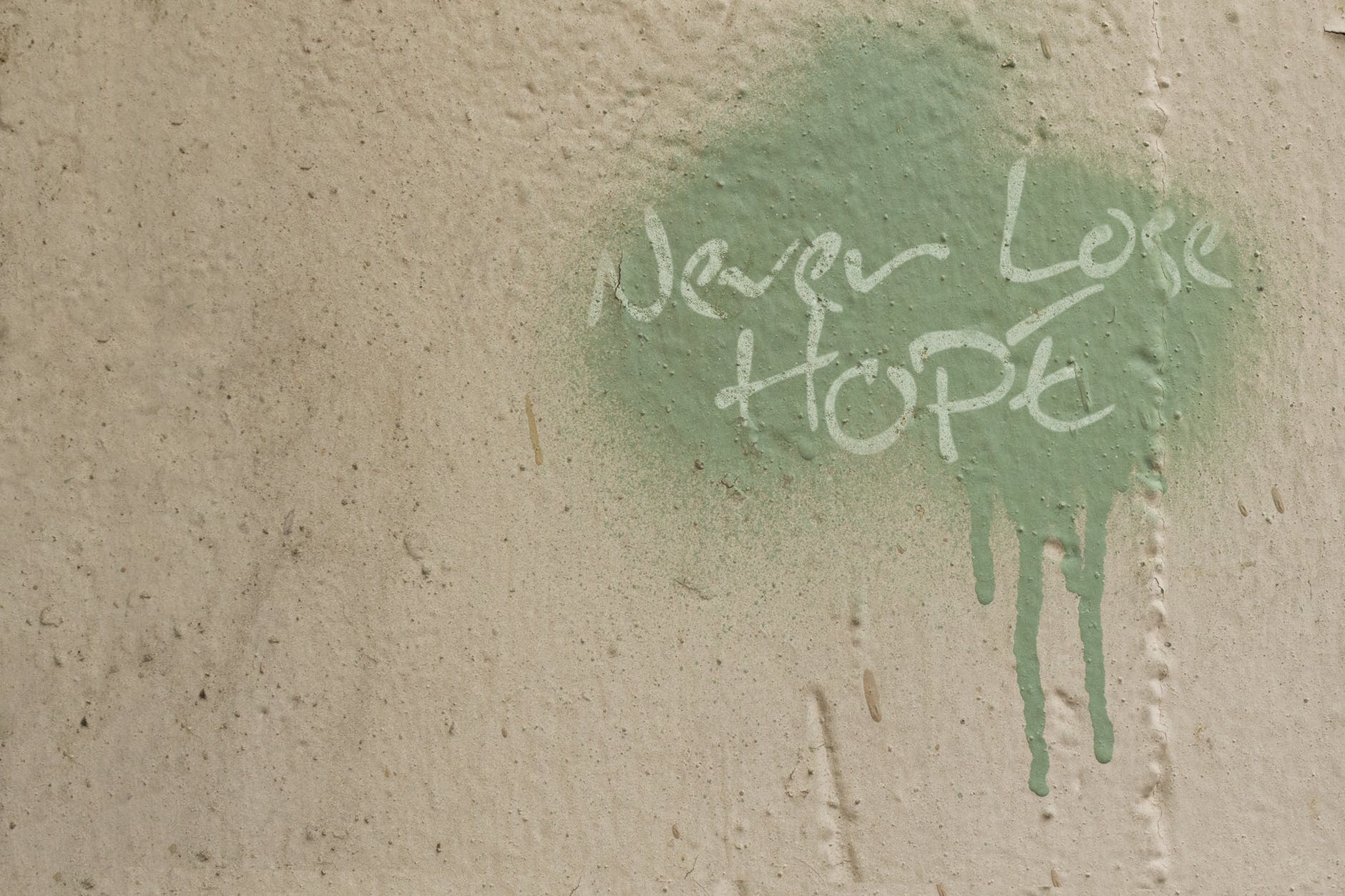Der Kampf um das Überleben des Planeten zieht sich zäh dahin. Von Klimagipfel zu Klimagipfel werden Vereinbarungen der Weltgemeinschaft als Minimalziel gefeiert. Das mit Ach und Krach nach einem Verlängerungstag verabschiedete „Katowice Climate Package“ regelt, wie das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen ist. Den bitternötigen Fortschritt für weitergehende Anstrengungen bei der Verringerung der Treibhausgase brachte es nicht.
Gemessen an den drängenden Erfordernissen war Katowice ein Fiasko. Doch das blieb unausgesprochen, weil es auch hätte schlimmer kommen können. Nach dem Austritt der USA – einem der Hauptverursacher der Erderwärmung – aus dem weltweiten Klimaprozess, gilt schon ein Weitermachen der anderen als Erfolg. Während von den Konferenzen derart schöngefärbte Erfolge verkündet werden, steigen die weltweiten Treibhausgasemissionen von einem Rekord zum nächsten. Das Jahr 2018 macht da keine Ausnahme. Um den Anstieg der Temperatur seit dem vorindustriellen Niveau auf zwei, besser 1,5 Grad Celsius zu begrenzen, muss es endlich zur Umkehr kommen.
Die große Transformation
Während die Weltgemeinschaft den Planeten und seine Bewohner mit Absichtserklärungen hinhält und ein ums andere Mal vertröstet, verrinnt die Zeit, die für entschlossenes Handeln bleibt. Längst keimt die Ahnung, dass es mit zaghaften Veränderungen nicht getan sein wird. Energiewende, Verkehrswende, Klimawende, Agrarwende, Ernährungswende, Konsumwende, Mobilitätswende bündeln sich zu einem enormen Kraftakt, der „großen Transformation“.
Dafür plädiert Uwe Scheidewind, seit 2010 Präsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie in einem so betitelten „Kursbuch“, das „fundamentale Veränderungsprozesse“ und nicht weniger als einen neuen „Zivilisationssprung“ anstoßen will. Alle Lebensbereiche sind gefragt, Wirtschaft und Kultur, Politik und Kirchen, Städte, Zivilgesellschaft, Individuen. Alle miteinander sollen „Zukunftskünstler“ sein, Weltretter, wenn man so will. Damit die Erde auch für demnächst zehn Milliarden Menschen und nachfolgende Generationen bewohnbar bleibt.
Von einer „Großen Transformation“ war schon 2011 im Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) die Rede. Seither ist der Begriff in vieler Munde, noch nicht in genauso vielen Köpfen. Im Vorfeld der UN-Konferenz zur nachhaltigen Entwicklung (Rio +20) im Jahr 2012 schrieb der Beirat über die „Welt im Wandel“ und entwarf die Perspektive einer klimaverträglichen Gesellschaft, die auf fossile Brennstoffe ebenso verzichtet wie auf Atomkraft und stattdessen auf erneuerbare Energien setzt.
Dessen ungeachtet trumpfte auch in Katowice die Atomlobby wieder auf, die bei einem der Side Events die Kernenergie als Beitrag zur sicheren Energieversorgung propagierte. Es sei „skandalös, dass der Atomindustrie auf der Weltklimakonferenz
Raum gegeben wird, um ihre kruden Thesen und falschen Versprechungen zu
verbreiten“, kritisierte die Ärzteorganisation IPPNW. Ihr Vorsitzender Alex Rosen sagte: „Atomenergie ist mit einer echten nachhaltigen Energiewende nicht kompatibel.“ Beim geplanten Bau von Atomkraftwerken wie aktuell in Großbritannien gehe es „in erster Linie um milliardenschwere Quersubventionen für Atomwaffenprogramme“. Im Interesse des Klimaschutzes sei allein der Ausbau Erneuerbarer Energien in Verbindung mit Stromspeichern.
Ohne Kapitalismuskritik kommt die Debatte nicht aus
Halbherzig, verzagt und wirtschaftsfixiert sind die wesentlichen Fortschritte nicht zu erreichen. „Die Eingriffe des Menschen in die natürliche Umwelt haben ein globales Ausmaß erreicht“, schrieb der WBGU schon 2011. „Besonders der Klimawandel, der Verlust biologischer Vielfalt, die Bodendegradation sowie die Übernutzung der Meere zählen zu den weltweit voranschreitenden kritischen Veränderungen der natürlichen Umwelt.“ Der Beirat wies bereits auf die „Städte als Treiber und Betroffene des globalen Wandels“ hin: Im Zuge der rasanten Urbanisierung konzentrierten sich Potenziale wie Herausforderungen der Transformation zur Nachhaltigkeit zunehmend dort. Und er rückte die „globalen Sicherheits- und Gerechtigkeitsfragen“ in den Blick.
Letztlich sind die Fragen nach den Grenzen des Wachstums, dem rücksichtslosen ausbeuterischen Wirtschaften, nach dem kapitalistischen System nicht zu umschiffen. Ohne Kapitalismuskritik, so räumt schließlich auch Uwe Schneidewind ein, komme die Debatte nicht aus. In einem Gastbeitrag ist Bernd Fittkau eingeladen, deutlich zu machen, warum das Thema Gemeinwohlökonomie „unbedingt“ in das Buch gehört hätte.
Mit einem Zitat aus dem jüngsten Bericht des „Club of Rome“, den Schneidewinds Vorgänger und Gründer des Wuppertal-Instituts, Ernst-Ulrich von Weizsäcker mitverfasst hat, knüpft Fittkau an ebenfalls bereits vorliegende Einsichten an: „Die aktuellen Trends auf der Erde sind nicht nachhaltig und die üblichen Antworten auf die Herausforderungen neigen dazu, auf einer Art Wirtschaftswachstum aufzubauen, das fest an einen zusätzlichen Ressourcenverbrauch gebunden ist.“
Menschenwürdig und nachhaltig wirtschaften
Die Gemeinwohlökonomie stellt sich als eine globale Bewegung dar, die ein menschenfreundliches Wirtschaftsmodell anstrebt. Oberstes Ziel müsse „ein gutes Leben für alle“ sein. Unternehmen, die menschenwürdig, solidarisch und gerecht, ökologisch nachhaltig, demokratisch und transparent agieren, sollten dafür belohnt werden, beispielsweise durch niedrigere Steuern, günstigere Kredite, Vorrang bei öffentlichen Aufträgen oder Förderungen. Die Folgen seien, dass sich langlebige, nachhaltige Produkte durchsetzten, mehr Wertschöpfung in der Region bleibe, sinnvolle Arbeitsplätze entstehen, der Umgang in den Betrieben menschlicher werde, die Ungleichheit zurückgehe, Umwelt und Klima global entlastet würden.
Etwas weniger visionär, dafür pragmatisch geht die „Allianz Entwicklung und Klima“ das Thema an, die Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) noch vor dem Katowice-Gipfel im Bundestag vorstellte. Klimaschutz sei „die Überlebensfrage der Menschheit“, sagte Müller, und: „Die reichsten zehn Prozent der Welt sind für 50 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich.“
Der Milliarden-Joker
Die Partner der Allianz – Unternehmen, Behörden, Institute, auch Müllers Ministerium – stellten sich ihrer besonderen Verantwortung und gingen beim internationalen Klimaschutz voran. Sie streben nach Klimaneutralität, indem sie ihren CO2-Ausstoß vermeiden, verringern und mit Projekten in Entwicklungs- und Schwellenländern kompensieren. Das Ganze soll zusätzlich zu den bestehenden CO2-Minderungsverpflichtungen stattfinden, auch Privatleuten offenstehen und entspricht weitgehend der Idee vom „Milliarden-Joker“, die Franz Josef Radermacher in seinem neuen Buch beschreibt. Im Zentrum der Überlegungen stehen nichtstaatliche Akteure in Europa, die freiwillige CO2-Kompensationen leisten.
Bei der Vorstellung des Buchs in Berlin befürwortete Minister Müller den Ansatz, und Felix Finkbeiner, Gründer der weltweit agierenden Initiative Plant-for-the-Planet, wies darauf hin, dass 1,2 Milliarden Hektar Landfläche nur darauf warten, wieder aufgeforstet zu werden, da sie weder Waldfläche sind, noch landwirtschaftlich oder für Siedlungsbau genutzt werden.
Jeder einzelne, meint Radermacher, könne seine persönliche CO2-Bilanz auf diese Weise ausgleichen und klimaneutral werden. Und außerdem ein Zukunftskünstler im Sinne von Schneidewind. Die Wortschöpfung „Zukunftskunst“ will die Fähigkeit bezeichnen, kulturellen Wandel, kluge Politik, neues Wirtschaften und innovative Technologien miteinander zu verbinden. Ob das Wort allein tatsächlich das Zeug zu Ansporn und Ermutigung hat? Auf jeden Fall ist es die bessere Alternative zur lähmenden Zukunftsangst.
Bildquelle: pixabay, ShonEjai, CC0 Creative Commons