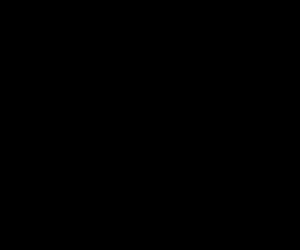Seit einigen Jahrzehnten wird unsere Sprache im Namen angeblicher Gerechtigkeit blutig umoperiert zwischen den Beinen, freilich ohne Betäubung und Desinfektion, so dass seelische Traumata und langwierig eiternde, entstellende Narben zurückblieben. Es wird Zeit, dagegen die Stimme zu erheben. Welchen Zweck das Er-Sie-Es, also die grammatikalischen Geschlechter erfüllen, ist manchmal schwer zu erkennen. Man braucht das eigentlich auch gar nicht tief zu durchdenken, sondern sollte die Genera nur mit gutem Sprachgefühl anwenden. Dann wird man bemerken, dass unsere Sprache das Genus hauptsächlich dazu benutzt, unterschiedliche Sachen besser auseinanderzuhalten. Nur selten ist daher beim grammatischen Geschlecht wirklich ein natürliches gemeint oder auch nur mitgedacht. Nix mit Sex.
Ob die Sonne weiblich ist oder der Mond, ist letztlich egal. Die romanischen Sprachen haben es andersherum als wir. Hauptsache, die beiden wichtigsten Himmelskörper sind gut unterscheidbar, und da wir aus der Lateinischen Luna das Wort „Laune“ gezogen haben, heißt die Sonne besser weiblich und der Erdtrabant halt männlich, trotz aller zyklischen Überlappungen bei Nachtgestirn und Menschenfrau.
Manchen verwirrt vielleicht unser deutsches Neutrum überhaupt. Man möchte es irrtümlich als unverzichtbaren Anzeiger für nicht-weiblich-und-nicht-männlich sehen. In den romanischen Sprachen passiert das nicht, da dort sowieso kein Lebewesen und kein Gegenstand grammatikalisch der Unterscheidung männlich–weiblich entkommt, weil’s dort kein Neutrum mehr gibt. Und in der Tat hat die Verbissenheit in der hier referierten Debatte recht deutsche Züge, weniger grammatisch und semantisch, als vielmehr mentalitätsbedingt.
Alle zusammen nennt man Pferd
Etwa bei den Reittieren ist es mit den Genera noch schön übersichtlich: Rappe-Wallach-Stute-Fohlen – man weiß immer sauber, wie es mit jedem hinsichtlich Kinderkriegen steht, und alle zusammen werden „Pferd“ genannt, und dies Wort ist ein Neutrum, also geschlechtlich zugleich beides und keins von beiden. So ordentlich wie bei den Paarhufern sollte es immer sein, muht uns von unpaarhufiger Seite auch das Rind als Stier, Bulle, Ochse, Kuh und Kälbchen zu. Haben die eine Ahnung!
So einfach ist es nur selten. Die allermeisten Begriffe für Lebewesen besitzen nämlich auch angesichts eines manifestem Sexualdimorphismus ein sogenanntes generisches Geschlecht, also ein gewissermaßen allgemeines grammatikalisches Normalgenus, das mit der Unterscheidung zwischen primär männlich und primär weiblich zugerüsteten Wesen nichts zu tun hat. Dieses Geschlecht ist oft nicht das Neutrum, wie bei den genannten Huftieren, sondern das Weibliche oder das Männliche. Sehen Sie: Die Substantive „Katze“, „Storch“, „Eule“ und „Neandertaler“ sowie alle möglichen anderen lassen – besonders wenn sie ohne Artikel stehen – offen, ob es sich um ein männliches oder weibliches Wesen handelt, beziehungsweise bei der Mehrzalform um einzelne oder mehrere solcher Wesen in einem beliebigen Geschlechtermischungsverhältnis. Nix wird über Sex und Gender gesagt – rein gar nichts!
Dass das natürliche Geschlecht eben nicht gemeint ist, kann im Deutschen in Worten überhaupt nicht anders ausgedrückt werden, als eben mit dem generischen Geschlecht. Im Englischen nimmt man bei nichtmenschlichen Einheiten notorisch das Neutrum, aber im Deutschen ist dessen Rolle schwächer. Wir folgen dabei uralten Wegen, wir sagen statt „it“, „the door“, nun mal „die Tür“ und „sie“, weil schon die alten Griechen dieses Lehnwort weiblich gebildet haben. Dass auf diesem Wege zwangsläufig Frauen als Gruppenmitglieder unter einen grammatikalisch männlichen Oberbegriff geraten können – wir werden gleich Beispiele sehen –, damit kommen viele nicht klar und wollen unsere Sprache deshalb am liebsten brave-new-world-mäßig umstricken, wie es unter der Knute der Fanatiker oft geschieht.
Als wäre dieser Quatsch normal
Die meisten suchen traditionell das Heil in hässlichen Sprachredundanzen, die die Sätze aufquellen lassen wie Bohnen den Darm, und hinterher steht da „Kundinnen und Kunden“, „Musikerinnen und Musiker“, „Gutverdienerinnen und Gutverdienter“ auf dem geduldigen Papier. Entspringt so ein Quatsch nicht der Tastatur, sondern dem Munde eines öffentlich Sprechenden, wird es noch schlimmer, denn angesichts derartiger Wörterverdoppelungen treibt es vielen auch wohlwollenden unter den wenigen aufmerksamen Zuhörern undercover-heimlich vor lauter unterdrückten Lachern Tränen in die Augen und bläht es bei fest aufeinandergepressten Lippen pupsend die Backen. Oder man hat sich schon diesen bekannten stoischen Gesichtausdruck angewöhnt und tut so, als wäre dieser Quatsch normal. Die Zwangsnennung des natürlichen Geschlechts führt nämlich zu einem der peinlichsten denkbaren sprachlichen Fehler überhaupt, zur ungestalteten Redundanz. Der Sprecher wirkt plump, steif und unbeholfen. Ein neues Paradigma der Zungen kann so natürlich nicht entstehen, sondern nur verschiedene, einander widersprechende Formen auf breiter Front nachgeplapperter Sprachhäresie.
Die angebliche Geschlechtergerechtigkeit wird freilich nur im Gespräch über solche Menschenwesen gefordert, denen man freundlich begegnen möchte, eben „Kundinnen und Kunden“ im allerweitesten Sinne. Für Bösewichter, Betrüger, Heiratsschwindler, Gewalttäter, Strafgefangene, Krankheitserrreger, Raucher und Säufer sucht niemand jemals nach politischer Korrektheit.
Immer mehr Unbrauchbares wurde und wird für den Gendermoloch erfunden. Manche schwören zwecks Buchstabenersparnis und damit man nicht sieht, wie hässlich die ungeschlachten Redundanzen aussehen, auf Binnenmajuskeln zur Plakatierung grammatikalischer Bisexualität.
So infiziert man etwa „SteuerberaterInnen“ oder „StreifenpolizistInnen“ eine lautlich uneindeutige Buchstabengärung ein, die nicht abgepupst werden kann, sondern dauerhaft drückt. Im typographischen Fachjargon spricht man von Kamelschreibungen (englisch „camel caps“), zoologisch genauer hieße es wegen der Zweizahl der Höcker auf Deutsch besser „Trampeltierschreibung“. Jedenfalls widerspricht solches Gehunze dem unverzichtbaren Grundsatz „schreib, wie du sprichst“. Oder sollen wir „I“ der „-Innen“ vielleicht immer eine Quinte oder womöglich gar eine Sext höher aussprechen? Reihenversuche dazu wurden schon auf ganzen Wissenschaftlerkongressen und Parteitagen beobachtet. Manche tupfen jetzt als Alternative zur Kamelschreibung einen sternförmigen Popel vor die weibliche Endung – der Misserfolg ist derselbe. Versuchen Sie zum Beispiel mal, bei solchen Asterisken oder auch bei den ebenso tastaturentsprungenen Unterstrichen mit der Zunge zu schnalzen, um dem Blödsinn wenigstens irgendeine Lautgestalt zu verleihen!
Lösegeld-Erpressung und Pfändung
Geben eine Dame und ein Herr gemeinsam ein Medium heraus, etwa ein Buch, dann werden sie im Vorfeld der Edition Herausgebersitzungen abhalten. Das müssen sie aber bitte nicht zur „Herausgeberin-und-Herausgeber-Sitzung“ künstlich übersexualisieren, als fände das bei Kerzenschein statt, oder? Würde man den Begriff nun umschnitzen, etwa zu „Editionsbesprechung“, so würde das den beiden vielleicht Wichtige in den Hintergrund treten, dass sie nämlich ein gemeinsam handelndes Gremium bilden. Beim Notwort „Herausgebende“ denkt man erstmal weniger ans Publizieren, sondern eher an die Essensausgabe in der Kantine, bei „Herausgabe“ kommt einem die Situation bei Lösegelderpressungen und Pfändungen in den Sinn.
Trotzdem sucht der eine und der andere in partizipialen und anderen Substantivierungen einen Ausweg aus der Peinlichkeit. Gewaltsam desexualisierte Partizipialformen statt verständlicher und eingeführter Begriffe führen aber in die Sackgasse: Schaut doch nur mal auf „Jagende und Sammelnde“ oder auf die inzwischen als Vokabel von vielen brav gelernten „Studierenden“ für Menschen, die Otto Normalverbraucher zwangsläufig nie studierend sieht. Otto geht ja nicht in Bibliotheken und Seminare. Otto wird dieser Menschenkinder immer bloß dann ansichtig, wenn sie jobben oder abends ausgehen. Seltsame „Studierende“! – nein: „Studenten“ heißen die, verdammte Hacke, denn das ist eine Daseinsform und keine permanente Tätigkeit! Doch zu den Partizipien hören wir später noch beim Thema „Flüchtlinge“.
Nun also nochmal von Grund auf: Das sprachliche Genus und das natürliche Geschlecht sind eigentlich zwei prinzipiell verschiedene Dinge. In der Mehrzahl verwenden die generischen Pluralformen für die Menschenwelt oft den männlichen Grundbegriff, zum Beispiel „der Asthmatiker“. Plural „die Asthmatiker“. Darin sind an Bronchenverengungen erkrankte Frauen eingeschlossen, ohne dass deren Anzahl, deren Leiden oder deren Bedeutung damit irgendwie herabgesetzt würden.
Manchmal erfüllt aber auch eine weibliche Form dieselbe Funktion als Generisches: Ist das Mordopfer maskulin, wird es nicht weiblicher, wenn man von „die Leiche“ spricht. (Umgekehrt: Ist es feminin, würde es durch den Begriff „der Leichnam“ nicht männlicher.) „Die Waise“ ist stets grammatikalisch weiblich, auch wenn statistisch gesehen genau die Hälfte dieser Bedauernswerten keine Mädchen, sondern Jungen sind. Diesen klaren sprachlichen Befund wollen viele nicht wahrhaben, so dass sie meinen, diese Vokabel zum neutralen Kompositum „Waisenkind“ aufpumpen zu müssen. Das brauchen wir nicht, denn in diesem Begriff begegnen wir ja den Waisen und nicht den Greisen: „Waise“ ist natürlich nur bei Minderjährigen sinnvoll anwendbar, der Bestandteil „-kind“ ist also nach dem Grundsatz „Less is more“ zu behandeln und zu löschen.
Eine Bande von Rotznasen
Bei „die Geisel“ ist es hinsichtlich Geschlecht ebenso, wobei ich hoffe, dass Geiselnehmer vielleicht dazu tendieren, Frauen in Ruhe zu lassen, die Mehrheit der Geiseln also sogar männlich sein könnte. Ob das so ist oder nicht, ist aber auch völlig egal: Das generische Geschlecht sagt hier über das natürliche Genus eben gar nichts aus. So ist es auch bei „die Gören“. Wir verstehen darunter mit Blick auf die freche Pippi Langstrumpf bevorzugt, aber natürlich nicht ausschließlich Girls-Girls-Girls, sondern eine hinsichtlich des Geschlechtes nicht definierte Bande von Rotznasen (noch ein generisches Feminin für ein anthropes Wesen!). Die beiden Singularia dazu sind beide bestes Hochdeutsch: „die Göre“, die auch grammatikalisch weiblich ist, oder sächlich „das Gör“. Eine männliche Form gibt es dazu aber auf-Teufel-komm-raus nicht. Unauffindbar!
Das Gegenteil ist der Fall beim „Gast“, der – warum auch immer – so entschieden maskulin-generisch ist, dass er einfach gar keine feminine Form kennt und man im Notfalle nur den Terminus „weiblicher Gast“ bilden kann – zumindest solange hier noch kein sprachliches Umoperieren stattgefunden hat, das die Genderwatcher dann natürlich kaum ein Wimpernzucken kostet. Dann, wenn es einmal soweit ist und sie ihr pseudolinguistisches, schartiges Skalpell voller infektiöser Sprachleichenblutverkrustungen zücken. Bei so knackigen Wörtern wie „Wicht“, „Knilch“ und auch beim „Lümmel“ ist es ähnlich. Keine weibliche Form in Sicht! Auch den Flüchtlingen geht es nicht anders, und alle Versuche, hier mittels der partizipialen chirurgischen Kneifzange entstellte „Geflüchtete“ in sprachlicher Entmannung vorzuführen, enden unglücklich. „Flüchtlinge“ sind nämlich nicht nur die schon geflüchteten, sondern auch die akut flüchtenden Menschen. Der Übergang ist fließend. Ich selbst stamme aus einer Sippschaft dieser Art und verbitte es mir wütend, als in einer „Flüchtenden-und/oder-Geflüchteten-Familie“ wurzelnd eingeschubladet zu werden.
Sogar die komplette Umkehr der Geschlechtsverhältnisse zwischen Lebewesen und Vokabel gibt es: Die dem Artikel nach feminine Drohne ist bekanntlich durchwegs männlich. Der grammatikalisch maskuline Sopran ist im wirklichen Leben ausnahmslos weiblich, genau wie der Alt. (Das war in Johann Sebastian Bachs Thomanerchor noch nicht so, aber heute gilt es.) Das hat – mit zeitgenössischen Augen – aber alles nichts mit dem Sex oder dem Gender zu tun, oder zweifeln Sie im Normalfall an der Weiblichkeit eines prächtigen Sopran?
Sara war der erste weibliche Prophet
Die generischen Genera sind freilich nicht bloß so da, so, wie eine Staffage aus der Vergangenheit, wie die Fachwerkäuser, die Barockschlösser und die Alleen, gewissermaßen ein „Nice-to-have, aber es ginge auch ohne“. Nein, vielmehr sind generische Genera aus semantischen Gründen unverzichtbar: Ist der letzte Sänger des Gesangsabends weiblich, dann darf es nur „als letzter Sänger trat eine Dame auf“ und im Kern nicht anders lauten! Sagte man, dass „die letzte Sängerin eine Frau“ gewesen sei, so legte dies absurderweise nahe, dass die zuvor aufgetretenen Chansonnieren mit männlichen Zeugungsorganen ausgerüstet waren.
Oder dies: „Sara war der erste weibliche Prophet.“ – Haargenau so muss es ohne Fisimatenten heißen, und zwar gerade dann, wenn man das Feminine der Erzmutter betonen will.
Würde man die Frau Abrahams als „erste weibliche Prophetin“ bezeichnen, besagte dies, dass es vor ihr schon Prophetinnen gegeben habe, aber die seien alle männlich gewesen. Das wäre sachlich doppelt daneben. Sagte man nur, sie sei die erste Prophetin gewesen, geht der Kern der Aussage verloren: Nämlich dass schon Sara als Frau in die überhaupt gerade erst im Entwurf befindliche Männerdomäne des Prophezeiens avant la lettre einbrach. Und ausgerechnet das können uns doch auch die schärfsten selbsternannten Sprachgleichstellungsbeauftragten nicht vorschreiben wollen, oder? – Doch, das tun sie, denn da kennen sie kein Gewissen und kein Erbarmen: Frau von der Leyen figurierte auf den Titelseiten der Zeitungen seinerzeit nur blass als „erste Verteidigungsministerin“ (Vorher gab’s so eine Art von Minsterium also noch nicht, denkt man.), statt als eisbrechende Frau auf diesem Führungsposten auch sprachlich etwas dahermachen zu dürfen, etwa „der erste weibliche Verteidigungsminister“.
Wir fassen zusammen: Natürlich kann das grammatikalische Geschlecht zur Bezeichnung eines natürlichen Genus von Lebewesen verwendet werden. Gleich kommen noch gute Beispiele dazu. Das generische Geschlecht aber ist etwas anderes und in seiner typischen Anwendung ist es auf Deutsch der Normalfall beim Genusgebrauch: Mal ist das Wort männlich, mal weiblich, mal sächlich, die Dinge, Pflanzen, Tiere und Menschenkinder selbst können bestückt sein, wie sie wollen – unser Sprechen schert in allen bisher besprochenen Fällen überhaupt nicht, wer was zur Arterhaltung beiträgt.
Aus Geblüt und aus Neigung
Die Weisheit unsere Sprache ist freilich noch höher als die Vernunft aller sie Sprechenden zusammen. Sie bildet nämlich sogar das Gegenteil des Generischen heraus, wenn sie es braucht. Nennen wir es die a-generische Ausnahme, die die Regel bestätigt. Und zwar bei den Verwandschaftsbezeichnungen. Die sind stets so scharf und sexy unterwegs, dass sie sich gegen eine generische Genusform sperren, widerwillig wie ein störrisch ausschachtender Eselshengst oder eine röllige Muschikatze. Hier war – oder ist? – nämlich die Frage des Patrilinearen oder Matrilinearen in Zeiten der Sprachbildung des Deutschen – also etwa auch heute? – von überragender Bedeutung. Und zwar so hervorstechend, das diese Begriffe in jedem Genus eigene Vokabeln ausprägten. Und auf denen wird beharrt. Dies führt zu einer ganz bestimmten Ordnung, ähnlich wie bei den eingangs betrachteten Huftieren, deren Vermehrung ja bekanntlich unter ebenso scharfer Detailbeobachtung steht wie das Kinderkriegen im Rahmen menschlicher Verwandschaftsbeziehungen, solchen aus Geblüt und solchen aus Neigung gleichermaßen. Solche Vokabeln für Relationen zwischen Zweibeinern wollen gewissermaßen wie ein Auszug aus dem Familienregister genau abbilden, wie die Lebewesen der älteren Abstammung nach und der künftigen Familienplanung gemäß stehen.
Die Verwandschaftstitel bilden für die verschiedenen Geschlechter folglich gern stark abweichende Wörter aus, die in der im Deutschen sui generis geschlechtslosen Pluralform wiederum eine andere Vokabel hervorgebracht haben. So werden „Bruder und Schwester“ durch „die Geschwister“ oder „Mutter und Vater“ durch „die Eltern“ zusammengefasst. Morphologisch sind die beiden Mehrzahlformen gewissermaßen Pluraliatanta, wie sie dem Deutschen mit seinem islationssüchtigen Hang zum Singularetantum sonst eher fremd sind. Beide können in einem zweiten Schritt zum Singular gleichsam rückvereinzelt werden und stehen so manchmal verblüffenderweise ohne da – ich meine: ohne, hm, Sie wissen, was ich meine – indem man zum Beispiel zum geschechtsneutralen „das Geschwister“ singularisiert. Aber schon das ist sensibel zu behandeln, denn oft bietet „Brüder und Schwestern“ entweder um der Rhetorik oder aber um der Mengenverdeutlichung willen eine andere Nuance.
Bei „Eltern“ wäre die Singularisierung ursprünglich natürlich absurd: Emotional und im Erbrecht mag mein Bruder vielleicht meiner Schwester gleichgestellt sein. Aber schon für den Säugling kann ein Vater nicht die Mutter ersetzen und das bleibt nach archaischer Vorstellung – wir sind und bleiben übrigens im seelischen Befund stets archaische Wesen – ein Leben lang so bei. Auch die Mutter kann ihrerseits die Vaterrolle nicht wirklich erfüllen. Das weiß jeder, der einen Vater hatte oder hat, mehr aber noch, wer keinen hatte. Da die Juristen der Neuzeit allerdings die selbsterfundene Rechtsfigur „Vater-oder-Mutter-egal-welches-von-beiden“ haben und ein Wort dafür benötigen, wurde der Neologismus „Elternteil“ herbeikomponiert, den kein normaler Mensch ausspricht. Er nistet nur endemisch im Behördendeutsch wie die Läuse auf den Köpfen der Kleinen im Kindergarten.
Zur Ausbreitung einer Sippschaft undercover tätig
Manchmal, freilich ganz selten, verweigert uns unsere deutsche Sprache sogar trotzig – jetzt wird’s extrem! –, aber unerbittlich einen gemeinsamen Pluralbegriff für einander Nahestehende gemeinsamen Schlages, der beide Genera umfasste. Gemeint sind „Onkel“ und „Tante“, also ursprünglich die Geschwister und Schwäger des Vaters, sowie die außer Gebrauch geratenen „Muhme“ und „Oheim“, also einst dasselbe von der Mutterseite her, oder „Cousin“ und „Cousine“ – früher Geschwisterkinder matrinilear – beziehungsweise „Vetter“ und „Base“ – ehedem nur die Kinder von Vatersbruderseite. Manches an heutiger Begriffsvielfalt bildet ja noch ein altes Rechtsdenken ab, wo der Bruder des Vaters (Oheim) einem Kinde gegenüber eine andere Stellung hatte als der Bruder der Mutter (Onkel) undsoweiter. Entscheidend ist aber nicht das, sondern Folgendes: Es gibt jedesmal keinen gemeinsamen Plural für beide, unglaublich!
Nur als Einschub zur Steigerung der Spannung: Die alte Großfamilie des Agrarzeitalters bestand nicht nur aus Verwandten in Geblüt und Rechtsstellung. Kann es sein, daß Knecht und Magd manchmal für die Ausbreitung einer Sippschaft zumindest undercover tätig waren und deshalb auf sie dasselbe Prinzip geschlechtlich vereinzelter Vokabeln ohne direkten gemeinsamen Plural Anwendung findet? Es mag Sie, arme Leser, vielleicht jetzt endgültig baff machen, wenn ich auch noch ganz frech annehme, dass – ich muss jetzt vorsichtig formulieren – im ontologischen Vorfeld von mondverbunenem Regelwerk einerseits und zahllos Brauendem andererseits – Göre und Knilch – man mag auch andere Wörtlein einsetzen –, die wir oben noch so harmlos spielen gesehen haben, schon rechtzeitig beäugt gehören, und deshalb ebenfalls nicht in einen gemeinsamen Vokabelpferch gehören?
Das mag ja alles noch angehen, ist ja hinsichtlich Sippschaft und Erbschaft sowie Grund und Boden nebst Knecht und Zugtier auch Schnee von gestern, aber trotzdem: Dass die weiblichen und männlichen Wesen wie Onkel und Tante et cetera sich einfach nicht auf einen gemeinsamen Plural bringen lassen, mutet einfach nur paradox an und ist nicht wirklich erklärbar. Im Italienischen und Französischen geht das doch! Es ist vertrackt: Im Deutschen können wir nicht schlicht parallel zum französischen „mariage des cousins“ formulieren, sondern beschreiben umstandskrämerisch die „Ehe zwischen Cousin und Cousine“. Und das, obwohl wir das einschlägige Substantiv für die Onkel-und-Tanten-Kinder doch bei unseren westlichen Nachbarn gelernt haben!
Gehirnwäscherinnen oder Gehirnwaschende
Und genau eine solche Ausnahme in unserer Sprache wie bei „Cousins und Cousinen“ wird zur Grundfigur des sprachlichen Gendering erhoben, dass nämlich das grammatikalische Geschlecht der Sprache immer mit dem natürlichen kongruent gehen müsse. Ausgerechnet diese völlig isolierte Anomalie monströser Geschlechterdissoziierung, diese Abstrusität, die biologisch-sexuelle Identität stets zwanghaft sichtbar machen zu müssen wie bei den Vorfahren in einem Adelsstammbaum aus Ritterzeiten oder beim Reproduzieren in der Viehzucht, nehmen politisch motivierte Sprachschänder in ihrem mänadenhaften Wahn als Paradigma. Sie mähren sich aus, die Sprachmelodie zerfetzend wie einst die Thyiaden den Leib des schönen Orpheus: „Liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Unterstützerinnen und Unterstützer, Sympatisantinnen und Sympatisanten!“ – So sprechen nur Gehirnwäscherinnen und Gehirnwäscher – oder sollen wir sie bald „Gehirnwaschende“ nennen müssen?