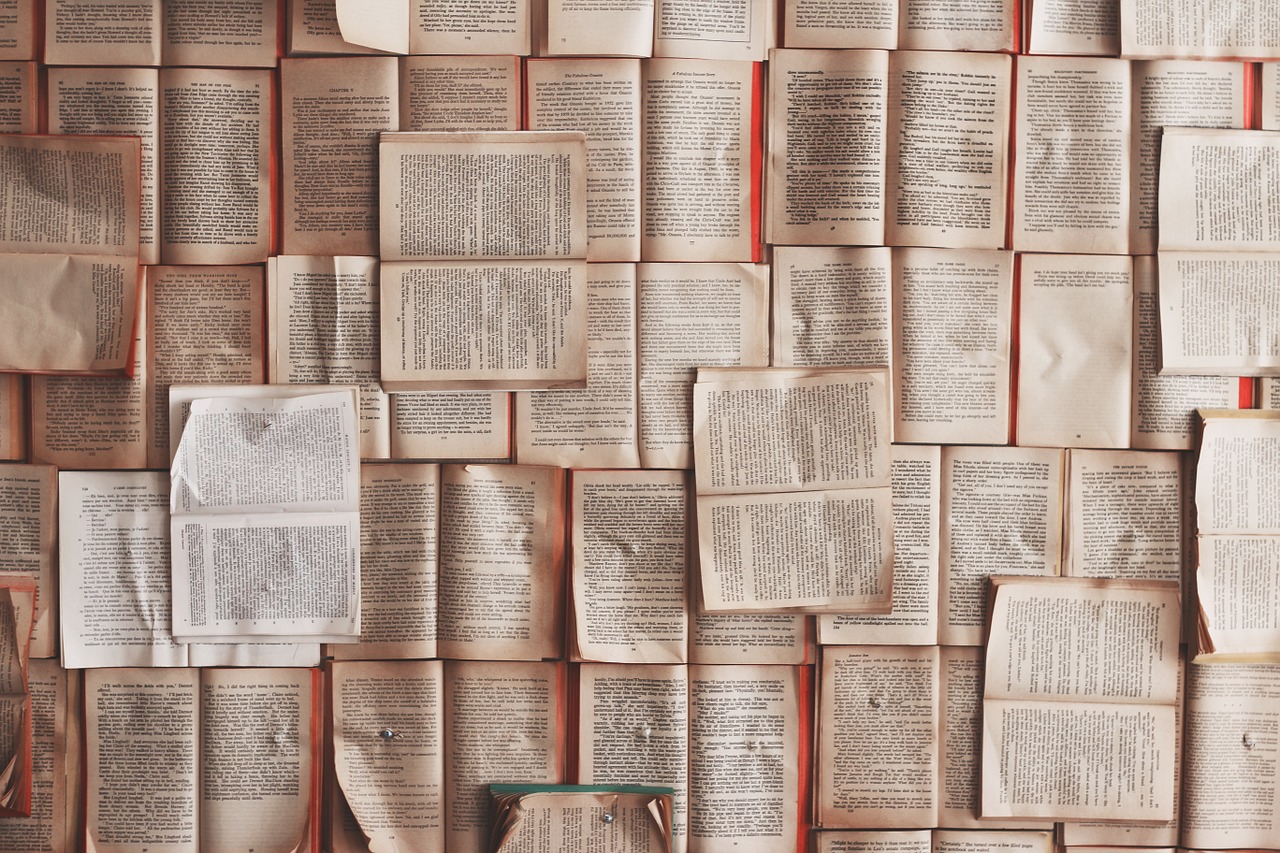Bei einer Podiumsdiskussion im Kölner Literaturhaus anlässlich einer Gedenkveranstaltung für den verstorbenen Dichter Peter Kurzeck wurde die Frage aufgeworfen, ob sich der Erzählstil Peter Kurzecks mit dem von Marcel Proust vergleichen lässt, wie dies in einigen Feuilleton-Beiträgen offenbar geschehen ist (Kurzeck wurde als hessischer Proust tituliert). Die Antworten der Diskutanten blieben mehr oder weniger im Ungefähren stecken. Dabei könnte es ganz interessant sein, der Frage einmal nachzugehen.
Peter Kurzeck ist dafür bekannt, dass er Vergangenes minutiös und detailgenau aus dem Gedächtnis rekonstruiert. (Vgl. dazu: Petra Frerichs: Die Kunst des Erinnerns, Blog der Republik v. 22.2.2018). In immer neuen Schleifen lässt er eine untergegangene Kindheitswelt wieder auferstehen. Das hat vordergründig etwas Nostalgisches, ja Rückwärtsgewandtes, weil die Vergangenheit bis zu einem gewissen Grad geradezu verklärt wird; sie erscheint als heile Welt gegenüber einer ins Unübersichtliche, Entfremdete abgleitende Gegenwart, deren Zukunft man sich gar nicht ausmalen mag.
Peter Kurzeck ist ein Gedächtniskünstler; was er an Einzelheiten aus seinem Erlebten hervorzaubert, ist schier unfassbar. Die Art, wie er es darstellt, erscheint oft unstrukturiert und wenig verdichtet; es kann so oder auch ganz anders erzählt werden, je nachdem, welche Schleife er gerade dreht. Auch ein gewisser Hang zum Redundanten findet sich bei ihm. Einiges wird immer wieder in der gleichen Weise nacherzählt, wobei lediglich die Kontexte sich verändern; das geschilderte Detail bleibt unverändert. Und noch ein Charakteristikum seines Erzählstils: Kurzeck ruft sich die Vergangenheit immer wieder bewusst ins Gedächtnis zurück, um sich darüber klar zu werden, was da verloren gegangen ist; und er weiß, dass es so, wie es früher war, nie mehr werden wird. Gerade deshalb will er es benennen und auf diese Weise vor dem Vergessen bewahren. Kurzecks nahezu fotographisches Gedächtnis setzt ihn instand, das Milieu eines Cafes aus den späten 50er Jahren so plastisch zu schildern, das man es sich so genau vorstellen kann, als wäre man dabei gewesen:
Weil ich in dieser Konditorei jedes Mal eine Weile sitzen muß und sehen, welche Gedanken mir dort kommen und welche schon auf mich gewartet haben. Eine Konditorei wie im Jahr 1958. Plüschmöbel und Wandlämpchen und auf den Tischen Spitzendeckchen unter Glas und auch die Trockenblumengestecke von damals. Genau solche Blumenvasen und Spitzendecken hat damals jedes Kind seiner lieben Mutter jedes Jahr wieder zum Muttertag geschenkt. Und jetzt sind die Kinder groß und längst aus dem Haus. Und die Mütter meistenteils Witwen. Eine gute Rente. Und jeden Tag Obst-, Creme- und Sahnetorten zum Trost. Kaffee Hag, heiße Schokolade mit Sahne oder ein Glas Tee oder Pfefferminztee und ab und zu einen Scharlachberg, ein Likörchen. Wie kleine Silberglöckchen klingeln die Teelöffel und Tortengabeln auf dem Porzellan. Manchmal muß ich auch allein hin, damit ich mir beim Denken besser zuhören kann, damit ich mir alles noch besser merke.
*
Marcel Proust erinnert sich auf ganz andere Weise; man hat seine Art der Erinnerung eine unwillkürliche Erinnerung genannt. Wenn er sich z.B. angesichts des Geschmacks eines Kekses beim Teetrinken an ein Ereignis erinnert, so hat er diese Erinnerung nicht bewusst herbeigeführt. Im Gegenteil; diese löst ganz ungewollt eine Kette von Assoziationen aus, durch die er sich z.T. sehr komplexe soziale Beziehungen, Gefühlslagen usw. wieder in Erinnerung ruft. Damit kommt ein Prozess von Erinnerungsarbeit in Gang, der sich immer weiter fortspinnt und eine vergangene Situation, ja eine ganze Lebenswelt erschließt. Proust sucht nach geheimen Bedeutungen und Sinnzusammenhängen; daher ja auch der Titel seines vielbändigen Romans: er ist buchstäblich auf der Suche nach der verlorenen Zeit; d.h.: er kann die Ereignisse nicht einfach aus dem Gedächtnis abrufen. Seine Suche hat etwas Mysteriöses, Unheimliches, Angestrengtes, da er nicht weiß, was sie zutage fördert. Es kann Schmerzliches, Leidvolles, Unangenehmes sein; aber eben auch Erfreuliches; der Ausgang seines Suchprozesses ist offen. Ein Beispiel:
Wenn ich mitten in der Nacht erwachte, wusste ich nicht, wo ich mich befand, ja im ersten Augenblick nicht einmal, wer ich war: ich hatte nur in primitivster Form das bloße Seinsgefühl, das ein Tier im Innern verspüren mag: ich war hilfloser ausgesetzt als ein Höhlenmensch; dann aber kam mir die Erinnerung – noch nicht an den Ort, an dem ich mich befand, aber an einige andere Stätten, die ich bewohnt hatte und an denen ich hätte sein können – gleichsam von oben her zu Hilfe, um mich aus dem Nichts zu ziehen, aus dem ich mir selbst nicht hätte heraushelfen können; in einer Sekunde durchlief ich Jahrhunderte der Zivilisation, und aus vagen Bildern von Petroleumlampen und Hemden mit offenen Kragen setzte sich allmählich mein Ich in seinen originalen Zügen wieder von neuem zusammen. Wenn ich jedenfalls in dieser Weise erwachte und mein Geist geschäftig und erfolglos zu ermitteln versuchte, wo ich war, kreiste in der Finsternis alles um mich her, die Dinge, die Länder, die Jahre.
Nur mühsam gelingt es Proust, sich zu erinnern, wo er sich befindet; erst allmählich gelingt es ihm, sich seine Lage bewusst zu machen. Sein Gedächtnis, das Gedächtnis seiner Seiten, seiner Knie und Schultern bot ihm nacheinander eine Reihe von Zimmern, in denen er schon geschlafen hatte, an, während rings um ihn die unsichtbaren Wände im Dunkel kreisten…Und bevor mein Denken, das an der Schwelle der Zeiten und Formen zögerte, die Wohnung durch ein Vergleichen der Umstände eindeutig festgestellt hatte, erinnerte er – mein Körper – sich von einem jeden an die Art des Bettes, die Lage der Türen, die Fensteröffnungen, das Vorhandenseins eines Flurs, gleichzeitig mit dem Gedanken, den ich beim Einschlummern gehabt hatte und beim Erwachen wiederfand.
Wenn Beckett davon spricht, Proust habe ein schlechtes Gedächtnis gehabt, zielt er auf die Unterscheidung von Gedächtnis und Erinnerung. Das Gedächtnis ruft Details ab, die sich unmittelbar reproduzieren lassen; dazu bedarf es keiner besonderen Anstrengung. Man kann sie geradezu wortgleich immer wieder schildern; das Ganze hat etwas Routiniertes, beliebig Wiederholbares. Ich weiß es noch wie gestern, sagen dann die Leute.
Erinnerungen dagegen stellen sich immer dann ein, wenn ein Sachverhalt etwas Unabgeschlossenes, noch nicht bewusst Verarbeitetes enthält, das erst noch bewältigt werden muss. Proust: Diese verworren durcheinanderwirbelnden Erinnerungsbilder hielten jeweils nur ein paar Sekunden an; oft gelang es mir in meiner kurzen Unsicherheit über den Ort, an dem ich mich befand, so wenig, die verschiedenen Momente des Ablaufs, aus denen sie bestanden, voneinander zu unterscheiden wie die sich ablösenden Stellungen eines laufenden Pferdes, die das Kinetoskop uns zeigt. Der hier geschilderte Erinnerungsvorgang ist das Gegenteil des nahezu automatischen Abrufens von Ereignissen, die sich dem Gedächtnis unmittelbar erschließen. Bei Proust spürt man die Mühe, die es ihn kostet, sich zu orientieren.
Aber wenn ich jetzt auch noch so gut wusste, dass ich mich nicht in den Behausungen befand, von denen mir die Unwissenheit des Erwachens einen Augenblick lang wenn auch nicht ein deutliches Bild vor Augen gestellt, so doch glaubhaft gemacht hatte, dass sie vielleicht um mich gegenwärtig wären, so hatte doch meine Erinnerung einen Anstoß erhalten…Erst allmählich gelingt es ihm, die disparaten Erinnerungsfetzen in eine verständige Ordnung zu bringen; und dieser Prozess ist es, der dann jene schier unendliche Assoziationskette in Gang setzt, die für Prousts Suche nach der verlorenen Zeit so typisch ist.
*
Von Prousts Art und Weise, sich zu erinnern, unterscheidet sich Kurzecks Gedächtnisprosa sehr deutlich. Er scheint die Ereignisse aus seiner Vergangenheit nahezu in jeder Situation präzise abrufen zu können. Das gilt insbesondere für die Art, in der Kurzeck Eindrücke aus seiner Kindheit schildert: virtuos und detailgenau:
Als Kind in Staufenberg mit sieben-acht-neun mir immer alle Flüchtlingskalender in der Flüchtlingsnachbarschaft ausgeliehen. Keine Wandkalender, sondern Jahrbücher mit Bildern, Geschichten, Brauchtum, Erinnerungen und man merkt sich als Kind jedes Wort…Das Buch vor mir auf dem Tisch. Schon anfangen mich auf das Buch zu freuen. Auf das Buch und den Heimweg. Und dass es noch nicht so spät ist. Noch Nachmittag. Den Heimweg einstweilen schon vor mir herdenken. Das Buch mit. Über die Brücke. Der Fluß rauscht. Und dann ist man auf dem Inselchen. Die Lollarer Mühleninsel. Niedrige alte Häuser auf beiden Seiten. Eingesunken und schief. Jedes anders schief. Kleine Fenster. Und nach hundert Schritten kommt einem schon das zweite Brückchen entgegen. Dann die Kirche. Grau und alt und verwittert. Ein Schieferdach. Das Türmchen so klein wie ein Taubenschlag. Direkt in der Kurve die Kirche. Als ob sie hier steht und sich nicht über die Straße traut. Genau wie die alten Frauen, die in der Kirchstraße wohnen. Ein halbes Menschenalter schon Witwen. Hat da noch das Kirchenglöckchen gebimmelt? Die Straße wird eng und macht einen Bogen. Direkt an der Hauptstraße die schmalen Häuser und so dicht beieinander, dass kaum noch Platz für den Himmel bleibt.
Kurzeck fächert seine Erinnerungen gewissermaßen auf und erzählt sie, als würde man sich auf einem Spaziergang durch die Straßen seiner Kindheit befinden. Dabei entsteht ein ganz bestimmter Rhythmus, den man besonders dann wahrnimmt, wenn man Kurzeck einmal erzählen hat hören. Wie er in einem ruhigen, gleichförmigen Erzählton die Abfolge der Wahrnehmungen gleichsam mitschwingen lässt; dass ist höchst eindrucksvoll; insbesondere, wenn man sich klar macht, dass Kurzeck seine Texte oft nicht abliest, sondern frei erzählt. Damit hat er nicht nur ein neues literarisches Genre geschaffen; diese Art des rhythmischen Erzählens überträgt sich auch aufs Lesen seiner Texte. Auf diese Weise entsteht große Erzählkunst.
*
Gleichwohl gibt es eine Differenz zwischen den Stilformen Prousts und Kurzecks: Prousts Texte sind reflexiver; man könnte auch sagen: konstruierter und weisen einen hohen Verdichtungsgrad auf. Virginia Woolf schreibt über ihn: Die gewöhnlichsten Handlungen wie, in einem Aufzug hinaufzufahren oder Kuchen zu essen, schürfen, statt automatisch ausgeführt zu werden, in ihrem Verlauf eine ganze Reihe von Gedanken, Empfindungen, Ideen, Erinnerungen hervor, welche offenbar an den Wänden des Geistes geschlafen hatten. Das ist es, was sie die beständige Indirektheit des Erzählstils Prousts nennt. Immer wieder werden bei ihm Geschehnisse durch Reflexionen unterbrochen oder außer Kraft gesetzt.
Dagegen wirken die Texte Kurzecks auf den ersten Blick schlichter; sie kommen meist in der Alltagssprache daher – halt so, wie man erzählt, wenn man wie er erzählen kann. Aber dieser Eindruck täuscht. Auch bei ihm wird der Erzählstrom durch reflexive Elemente angereichert – etwa dem Nachdenken über das Vergehen der Zeit. Kein Nachsommer. Schon vier Wochen kaum je ein Augenblick Sonne. Früh der Herbst, sagt man sich. Als ob das gleich für das ganze Leben gilt. Und muß sich durch die Jahre jedes Jahr einzeln merken. Wird Zeit.
Zeit wozu, möchte man fragen. Um alles aufzuschreiben, könnte die Antwort lauten. Beide – Proust und Kurzeck – sehen in der Literatur eine Gegenmacht gegen die Furie des Verschwindens: die Zeit (Wellershoff). So heißt es bei Kurzeck einmal: Eng die Wohnung. Immer enger um uns her. Aber auf einmal dann wird sie nach allen Seiten hin weit wie der Abendhimmel. Schreiben, Musik und so oft es geht den Wolken nach mit dem Blick. Und beim Schreiben manchmal die Zeit anhalten. Und an anderer Stelle: Wenn ich schreibe, ist immer jetzt!
Unterscheiden tun sich beide hinsichtlich der Erinnerungsmodi: bei Proust handelt es sich um eine Form der Erinnerungsarbeit. Durch sie werden Ereignisse wieder zum Leben erweckt; sie werden gewissermaßen an ihn herangetragen, so als würden sie sich ihm auch gegen seinen Willen aufdrängen.
Dagegen ruft sich Kurzeck die Eindrücke aus seiner Kindheit scheinbar mühelos ins Gedächtnis zurück, und da er sich an nahezu alle Einzelheiten erinnert, kann er sie auch in ganz unterschiedlichen Kontexten jederzeit rekonstruieren.
Resümierend lässt sich feststellen: Proust ist der Suchende auf den Spuren einer Vergangenheit, die er sich erinnernd vergegenwärtigen muss, wodurch er sich in überaus komplexe Assoziationsketten verstrickt, die immer neue Facetten in ihm auslösen. Bei Kurzeck gewinnt man den Eindruck, dass er sich in die Welt seiner Kindheit zurück versetzt; sie scheint ihm ständig präsent zu sein; sie ist ihm so nah, als lebte er noch in ihr und würde sich wünschen, sie wäre nie vergangen.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Free-Photos, Pixabay License