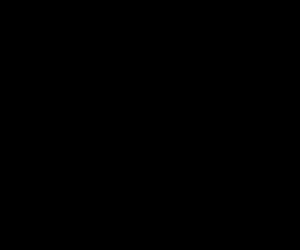Gibt es einen nennenswerten Ertrag der ostdeutsch- westdeutschen und westdeutsch- ostdeutschen Debatte der vergangenen Wochen? Schläft die Debatte wieder ein, wenn der 30. Jahrestag der neudeutschen Novemberrevolution hinter Weihnachten und dem Dreikönigsfest versunken ist? Gibt es Fortschritte, Rückschritte. Tendenzen? Was wissen wir im Westen denn noch nach 30 Jahren?
Vor wenigen Tagen schrieb der schlaue „Publikönom“ Thomas Fricke folgendes; „Wolfgang Schäuble, mittlerweile Bundestagspräsident, postuliert selbst anno 2019 noch wie unbekümmert, dass es keine bessere Form der Wiedervereinigung hätte geben können. Das ist eine absurde These. Es hätte womöglich hundert andere Varianten gegeben. Nur kam es nie dazu, diese ernsthaft zu erwägen. Staatsräson.“
Was Fricke meint, wenn er von „ hundert anderen Varianten“ schreibt, weiß ich nicht. Vielleicht war´s nur Provokation? Ich habe den Satz in meinen Ordner gesteckt, über dem als leitender Titel steht: Könnte von Varoufakis stammen.
Dann habe ich versucht, mich zu erinnern. War damals Mitarbeiter des Sprechers für Wirtschaftspolitik der Bundestagsfraktion der SPD, Wolfgang Roth. Roth hatte, das ist nicht ironisch, sondern bewundernd gemeint, einen Blick „für´s Ganze“. 1982 hatte er ein Buch über die sozialdemokratische Alternative („Humane Wirtschaftspolitik“) geschrieben, das heute noch lesenswert ist: “Wir müssen unsere Produktionsmethoden an die wirklichen, zukünftigen Knappheiten anpassen.“ Wie geschrieben: 1982. Da buddelten andere noch tiefe Kohle- Schächte.
War es tatsächlich so, dass andere Varianten nicht ernsthaft erwogen wurden, aus „Staatsräson“?
Wir waren darauf trainiert, Probleme wie gelernt zu lösen: Anschauen, verstehen, vergleichen, diskutieren, Wissensstand abschätzen, Kosten schätzen, Alternativen prüfen, lösen. Das ging aber nicht, bezogen auf den Übergang vom Plansozialismus in eine Marktwirtschaft, denn da gab es keine Erfahrungen zu verstehen, zu vergleichen, Wissensstand auf den Tisch zu bringen, Alternativen zu prüfen etc. Das was vor uns lag, war Abgrund und kein Oberseminar mit Praxisanhang.
Ich erinnere mich daran, dass wir im Westen über die realen sozialen, betrieblichen, auch arbeitsmedizinischen und sonstigen, bestimmenden Verhältnisse der Werktätigen der DDR fast nichts wussten. Es war uns nicht klar, dass die DDR sowohl harte Leistungsgesellschaft als auch zugleich bürokratisch, Wissensgesellschaft und Diktatur, klein- oder großbürgerlicher Freiraum, Weltklasse und Heimat der Broiler war. Es gab „bei uns“ damals skandalös wenige wirkliche Kenner der DDR, obwohl sich die beiden Staaten fortwährend gegenseitig im Blick gehabt hatten. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin wusste wenig. Fachleute wie der 1978 aus der DDR ausgesiedelte Ökonom und Jurist Wolfgang Seiffert wurden nicht recht ernst genommen. Die Geheimdienste dösten offenbar. Was man im Westen hinlänglich kannte, das waren IKEA-Produkte aus der DDR-Herstellung und DDR-Erzeugnisse in den Katalogen von Neckermann und Quelle. Manches war, wie nach 89 recherchiert wurde, in Zwangsarbeit hergestellt.
Aber sonst?
Damals wurde von namhaften Westmenschen angenommen, dass allein das Etablieren der Marktwirtschaft die Produktivität der DDR-Wirtschaft spontan um ein Drittel anheben würde. Was natürlich Quatsch war. Typisch war die Antwort des damaligen Wirtschaftsministers Helmut Haussmann 1990 auf eine Spiegel-Frage: „Sie haben prophezeit, das planwirtschaftliche Abstiegsland DDR werde sich in absehbarer Zeit in ein marktwirtschaftliches Aufstiegsland verwandeln. Wie lang ist absehbar?
Haussmann: „Jetzt und im nächsten Jahr werden, außer in wenigen Elite-Unternehmen, kaum schwarze Zahlen geschrieben. Doch ich glaube, ab 1992/93 wird gutes Geld verdient.“ Es wurde schlicht und einfach die Quersumme der Systemkonkurrenz gezogen: Die können es nicht. Bei uns hat es wirtschaftlich geklappt. Also kriegen die das, was bei uns den Erfolg gebracht hat. Punkt.
Das Bild der DDR
Das Bild der DDR in unseren westdeutschen Köpfen war das eines Staatsapparats; irgendwie sah das aus wie ein abweisender Funktionsbau, fünf Stockwerke hoch, hunderte Meter lang, mit hunderten blinden Fenstern. DDR „kannten“ viele aus brieflichen Kontakten zu Verwandten, die oft auf Pakete „von drüben“ warteten sowie aus Begegnungen mit den Alten, die uns besuchen durften. Den Rest erledigten (dieses Mal fast ironisch gemeint) Stern beziehungsweise Gräfin Dönhoff, die in der DDR-Welt einiges Gute erkennten konnten. Aber all das reichte natürlich nicht, um zureichende Entscheidungen über die Zukunft eines implodierenden States zu treffen. Aber woher Informationen nehmen, wenn´s keine gibt? Den DKP-Vorsitzenden Herber Mies fragen? „Schlaues“ wurde erst nachträglich getextet.
„Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr“, so lautete ein Slogan, der irgendwann im Herbst 89 auftauchte und der dann überall zu hören oder lesen war. Friedrich Schorlemmer dazu im Sender Deutschlandfunk-Kultur: „Jedenfalls ist meine Erinnerung so. Und Sie wissen: Erinnerung täuscht, denn ich kann nicht mehr sagen, wann, an welchem Tag genau, oder so; kann doch auch sein, dass es erst im Januar gezeigt wurde. Aber: Richtig ist, dass nach dem 9. November änderten sich die Demonstrationen, vor allem die Ziele der Demonstrationen – wie ich finde, auf eine fatale Weise. Nämlich: Alles richtete sich jetzt nicht mehr darauf, die Selbstbefreiung voranzubringen und Strukturen der Demokratie aufzubauen, sondern: möglichst schnell Deutsche Einheit zu erreichen, D-Mark besitzen, Ende der Demütigung mit der Ost-Mark, die nirgendwo kompatibel war…“
Wir konnten uns manche Probleme von Ökonomien mit nicht umtauschbaren Währung real nicht oder – wie soll ich schreiben – nicht plastisch vorstellen. Nur ahnen. Demütigung durch die eigene Währung statt Identitätsstiftung durch Münzen und Scheine, die man tagtäglich in die Hände nahm. Das war doch unvorstellbar für uns.
Klar war uns, dass der DDR- Wirtschaft die wesentlichen Märkte weggebrochen waren. Mehr als die Hälfte der Valuta-Mark- Exporte 1989 in einer Größenordnung von weit über 130 Milliarden Valuta-Mark gingen in die damalige Sowjetunion und weitere Exporte in die übrigen Staaten des RGW – des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe. Diese Märkte waren weg.
Nach den Revolutionen
Die DDR baute damals beispielsweise für den RGW- Bereich die Kraftwerke. Nach den jeweiligen Revolutionen war an den Bau neuer Kraftwerke in Polen oder Rumänien nicht zu denken. Und in der DDR konnten die ausfallenden Aufträge nicht ersetzt werden; weder durch Exporte in die bisherigen Märkte noch in neue, denn dort saßen ja Siemens & andere. Was sollten wir tun?
Wie macht man das, auf die Schnelle Märkte für Produkte finden, die erst noch entwickelt werden müssten und deren Wettbewerbsfähigkeit sich erst zeigen musste? Welche Strategie hätte der „Publikönom“ empfohlen?
Um Exporte in den nicht-sozialistischen Ländern zu verkaufen, musste von der DDR- Wirtschaft Jahr für Jahr mehr aufgewendet werden. 15 Prozent des DDR-Exports ging zollfrei über die innerdeutsche Grenze. Teils von westdeutschen Banken kreditiert.
Das alles zusammen war Sackgasse. Der Soziologe Theo Pirker schrieb darüber 1995: „Es gehört in das Reich der Fabel zu glauben, dass die Führung der DDR erst 1988 über den Zustand Ihrer Wirtschaft Bescheid wusste.“
Das war „die Lage“. Und alles musste unter enormem Zeitdruck erledigt werden. Heißt: Nicht zurücklehnen. Mappe auf Wiedervorlage, sobald was Besseres eingefallen ist.
Natürlich gab es Alternativen:
Die Grenzen dicht halten, eine Zoll- Sonderzone Ostdeutschland einrichten; die Bürger der neuen DDR und deren Wirtschaft mit neuem Geld ausstatten und so einen Startschuss in die Marktwirtschaft organisieren. Das hätten die Europa-Partner nicht mitgemacht und die Bürgerinnen und Bürger der DDR auch nicht. Die hätten die Grenzen noch mal geöffnet – dieses Mal mit Karacho.
Mehr Arbeitslose
Eine andere Alternative auf die Schnelle wäre gewesen, die wachsende Zahl der Arbeitslosen (1,1 Millionen in Ostdeutschland 1990 und 1,6 Millionen 1995)durch zu finanzieren, bis sich neue/alte Unternehmen mit neuen Produkten auf anderen Märkten etabliert hätten. Das hätte Kohls Portokasse in die Luft fliegen lassen. In Westdeutschland waren ebenfalls Hunderttausende nach Strukturbrüchen arbeitslos – Gelsenkirchen ist heute noch die ärmste deutsche Stadt. Für die hätte „Durchfinanzieren“ auch gelten müssen. Die damalige Bundesanstalt für Arbeit war zudem für massenhafte Wiedereingliederung in Arbeitsprozesse in Ost wie West nicht geeignet. Das war also illusorisch.
All das und noch mehr wurde diskutiert, von Hans- Jürgen Krupp, dem damaligen Chef der Hamburger Landesbank und späteren DIW- Vorsitzenden; von Bundesbank- Präsident Karl-Otto Pöhl und vielen anderen. Nein, es ist nicht alles fehlerlos gewesen. Das ist wahr. Späteren Kritikern ist freilich in Anlehnung an Obi Wan Kenobi ins Stammbuch zu schreiben: Die Einsicht sei mit euch.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Peter H, Pixabay License