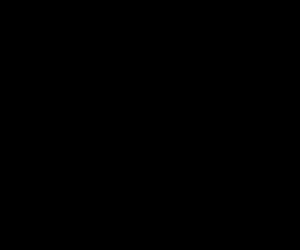„Geht doch nach drüben!“
„Geht doch nach drüben!“, so stachelte die Springer-Presse den Volkszorn gegen die „roten Garden“ an der FU an. Ich ging jedenfalls nach drüben. Ich hatte zwar keinerlei Sympathie für das für mich „kleinbürgerliche“ und damit reaktionäre SED-Regime, aber ein- oder gar zweimal im Monat war ich drüben: Im Brecht-Theater am Schiffbauerdamm. Helene Weigel habe ich in Brechts „Mutter Courage“ noch auf der Bühne erlebt. Auch das Kabarett DISTEL, direkt am Bahnhof Friedrichstraße, fand ich spannend und erstaunlich frech. Mit der „schwarz“ im Verhältnis 1 D-Mark zu 3 eingetauschten Mark der (Ost-)Deutschen Notenbank konnte man drüben billig und gut essen und trinken („Hasseröder“ Bier) und einkaufen. Unter den Linden gab es ein tschechisches Plattengeschäft, wo man billig Klassik-Schallplatten kaufen konnte. Stück für Stück besorgte ich mir die „blauen Bände“, die Marx-Engels-Gesamtausgabe. Ich schmuggelte für Leute, die ich meist im Theater kennengelernt hatte, manchmal das westdeutsche Magazin „Der Spiegel“ durch die Grenzkontrolle am Bahnhof Friedrichstraße. Das war nicht ganz ungefährlich, falls man von den stets unfreundlichen Vopos (Volkspolizisten) „gefilzt“ werden sollte.
Und ich war zwei- oder dreimal sogar Fluchthelfer, wie übrigens nicht wenige der linken Studenten – auch SDS-Mitglieder. Die Aufgabe, die mir von irgendjemand mir Unbekanntem übertragen wurde, war, einen Lebenslauf, ja noch mehr ein ganze Biografie auswendig zu lernen, also angefangen vom Namen des Vaters und der Mutter, Geburtstage, Geschwister, Onkel und Tanten, Einzelheiten zum Wohnort etc. Das waren immerhin gut 8 bis 10 DIN A4-Seiten. Das Heikelste und Aufregendste war, drüben im Osten den richtigen Gesprächspartner und eben nicht auf einen Stasi-Mitarbeiter zu treffen. Mit diesem Unbekannten ging man dann möglichst unauffällig (sich aber dennoch ständig umschauend) durch Ostberliner Straßen und paukte mündlich die Biografie eines Dritten mit westdeutschem Pass, mit dem der Betreffende aus dem Osten nach Westen passieren sollte. Ob das jeweils gelungen ist, wurde mir nie bekannt. Ich hätte nicht einmal sagen können, wie die Person hieß, die mir den Umschlag mit der Biografie in die Hand gedrückt hat, geschweige denn, dass ich den wirklichen Namen der Person kannte, die ich „briefte“.
Das kulturelle und das verruchte West-Berlin
Nachdem ich aus der Wohngemeinschaft in der Joachimsthaler Straße auszog, fand ich eine Bude im fünften Stock in einem Hinterhaus in der Johann-Georg-Straße in Hallensee. Das war – meinem engen finanziellen Spielraum geschuldet – ein winziges Zimmerchen, bei dem man das Bett hochklappen musste, wenn man an einem kleinen Tischchen sitzen wollte. Auch wenn Damenbesuche aufgrund der räumlichen Enge ohnehin kaum möglich gewesen wären, waren Sie (wegen des damals geltenden Kuppeleiparagrafen) im Mietvertrag strikt untersagt. Das (arme) Rentner-Ehepaar teilte Küche und Toiletten mit mir.
Eine Klingel im Vorderhaus gab es nicht und wenn dort abends die Tür abgeschlossen war, konnte niemand mehr zu mir durchdringen. Eigenes Telefon oder gar Handys gab es natürlich nicht.
An der Ecke zum Kudamm (Kurfürstendamm 140) war das SDS-Zentrum in einem Gebäude untergebracht, an dessen Eingang man noch gut den Reichsadler der Nazis ausmachen konnte. (Michael Ruetz, „Ihr müßt diesen Typen nur ins Gesicht sehen“, Frankfurt a.M. 1980, S. 50)
Ich besuchte dort einige Male einen Kapital-Lektürekursus. Ja, es gab da regelrechte Schulungsabende. Gut drei Monate studierte ich nahezu täglich einige Stunden „Das Kapital“ von Karl Marx und schrieb Zitate auf Karteikarten. Anders als manche SDSler konnte ich aber nicht aus dem Kopf zitieren. Das zentrale Bildungserlebnis dieser Lektüre war, dass ich gelernt habe, dass es eine Theorie hinter der Oberfläche gesellschaftlicher Prozesse geben kann. Das hat mir geholfen meine bisherige eher naiv „positivistische“ und unstrukturierte Weltanschauung zu reflektieren. Auf diese tiefergründige Betrachtungsweise gesellschaftlicher Erscheinungen greife ich bis heute zurück. Man kann es auch einfach so sagen: Ich habe gelernt bei politischen oder wirtschaftlichen Herrschaftsverhältnissen nach den dahinter stehenden Interessen und Kräften oder Strukturen zu fragen.
Aus der doch sehr engen Bude zog ich bald wieder aus, ins Wohnzimmer einer alleinerziehenden Frau so um die Mitte Dreißig in der Hildegardstraße, nahe der Bundesallee. Sie war Alleinerziehend und benötigte wohl das Geld aus der Untermiete. Sie hatte Verwandte in Ost-Berlin und kam in den Genuss des 1963 ausgehandelten Passierscheinabkommens. Wenn sie abends von ihren Besuchen im Osten zurückkam, weinte sie oft. Sie hatte dort offenbar einen Freund.
Da ich nachts lange gelesen habe, ging ich häufig nach Mitternacht auf ein Bierchen in eine naheliegende Bar namens „PiPaPo“. In Berlin gab es ja keine Sperrstunde. Das war, wie ich in meiner Naivität erst nach einiger Zeit auf der Toilette bemerkte, (zumindest auch) ein Schwulen-Treff. Für mich, dem doch noch recht naiven Jungen vom Land war das die erste Begegnung mit Homosexuellen. Ich wurde öfters mal „angemacht“. Das war ein eindeutiger Prüfstein, dass ich nicht homosexuell bin.
Trotz meines politischen Engagements blieb immer noch Zeit für Theater- und Konzertbesuche. Während des Berliner Film-Festivals (Jean-Luc Godards „Lemmy Caution gegen Alpha 60“ gewann in diesem Jahr den Goldenen Bären) habe ich mehrere Tage hintereinander zwei oder gar drei Filme angeschaut. Als Provinzler hatte ich einen großen kulturellen Nachholbedarf. Ich habe mich in aller Regel erst am Nachmittag entschieden, dass ich abends „auf Kultur“ machen wollte. Man stellte sich vors Theater oder den Scharoun-Bau der Berliner Philharmonie mit einem Schild „Suche Karte“ vor der Brust. In aller Regel klappte das, häufig bekam man als Student die Karte sogar geschenkt. Zwei oder dreimal ging ich auch in eine Travestieshow in der Nähe des Wittenbergplatzes, meist mit Besuchern aus dem „Ländle“, um diesen zu zeigen, wie verrucht Berlin doch ist. Natürlich besuchte ich auch den „Mann mit der Trommel“, Wolfgang Neuss, und seinem Programm das „Jüngste Gerücht“. Der Kabarettist Neuss trat auch bei Teach-ins an der FU auf und wurde 1966, wegen seines Aufrufs zur Wahl der DFU aus der SPD ausgeschlossen, wogegen der SHB heftig protestierte. (Später hat ihn die SPD wieder aufgenommen und er machte sogar Wahlkampf für diese Partei.)
Skandal im SHB-Bundesvorstand
Im Frühsommer 1965 gab es im SHB-Bundesverband einen Skandal. Der im März gewählte Bundesvorsitzende Hajo Hauß (München) warf der SPD-Führung „eine zunehmend faschistische Ausrichtung“ (Willy Albrecht, Der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS), Bonn 1994 S. 454) vor und rief dazu auf bei der Bundestagswahl im September die (angeblich kommunistisch unterwanderte) Deutsche Friedensunion (DFU) zu wählen; das wohl deshalb, weil er gegen eine Große Koalition war.
Am 7. September 1965 erklärte Hauß in einem offenen Brief an den SPD-Vorsitzenden Willy Brandt seinen Austritt aus der Partei: „Nach langer reiflicher Überlegung bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren kann, einer Partei anzugehören, die sich heute allem denkbaren, nur nicht ihrem Namen verpflichtet fühlt….
Den letzten Anstoß für meinen Austritt aber gab die zunehmend faschistoide Ausrichtung der Partei… Die SPD hatte im Nachkriegsdeutschland eine klare Aufgabe: jedes Wiedererwachen des Faschismus zu verhindern…Diese Aufgabe hat die SPD-Führung verraten. Sie hat sich von der Aussicht auf ein paar Ministersessel korrumpieren lassen“
Gleichzeitig trat Hauß als 1. Vorsitzender des SHB zurück. Auch der stellvertretende SHB-Bundesvorsitzende Hans Lehnert (FU Berlin) gab seinen Posten ab. Der zweite stellvertretende Bundesvorsitzende Christoph Zöpel (FU Berlin) wurde vom Bundesbeirat zum kommissarischen Vorsitzenden gewählt. Er erklärte, dass Hauß für „sein Amt nicht befähigt war“. (Dokumentation FU-Berlin a.a.O. S. 46.)
Zöpel verlautbarte weiter, dass er sich um die Wiederherstellung freundschaftlicher Beziehungen zur SPD bemühen werde. Er setzte jedoch die Zusammenarbeit mit dem von der SPD verstoßenen SDS und den anderen „Höchster Verbänden“ (u.a. SDS, LSD, dem Internationalen Studentenbund (ISSF), dem Bundesverband Deutsch-Israelischer Studiengruppen (BDIS), der Humanistische Studentenunion (HU) und der Evangelische Studentengemeine (ESG)) fort.
Ich wurde nach dem Rücktritt von Hajo Hauß – wohl als (Berliner) Aufpasser für den verbliebenen Finanzreferenten Erich Langmantel (aus München) – als „Bundesgeschäftsführer“ nach Bonn entsandt. Ich bin ungern aus Berlin weg und hielt danach noch enge Verbindung.
Als Geschäftsführer des SHB musste ich täglich ins Büro in der Bonner Noeggerathstraße 29. Also zog ich im Herbst 1965 nach Roisdorf bei Bonn. Ich kaufte mir von meinem ersten Salär von einem Journalisten für 300 Mark einen völlig verbeulten mattgrauen VW-Standard. Ein Auto, das noch eine Seilzugbremse hatte, auf das Bremspedal musst man sich mit aller Gewalt stemmen, bis das Auto allmählich bremste. Dazuhin wirkte die Bremse – weil falsch eingestellt – unterschiedlich stark auf die Räder ein. Das hatte zur Folge, dass man bei Regen schnell ins Schleudern geriet und einmal bin ich auf einer Fahrt nach Hannover bei regennasser Autobahn gegen die Leitplanke geknallt. Das kostete aber nur eine Beule mehr.
Mir war vorher nicht klar, auf was ich mich als „Bundesgeschäftsführer“ eingelassen hatte und ich war dazu noch völlig unerfahren in der Verwaltung eines Verbandes. Christoph Zöpel als Interims-Bundesvorsitzender war schon als Student ein Management-Talent. Wir telefonierten täglich und er kam nahezu wöchentlich für einen oder zwei Tage aus Berlin angeflogen und ich holte ihn mit meinem alten VW vom Köln-Bonner Flughafen ab – damals noch ohne Autobahn über die Dörfer.
Nach den Bundestagswahlen am 19. September 1965 schrieb Christoph Zöpel an Willy Brandt, dass Bundesvorstand, Bundesbeirat und Ältestenrat des SHB der Ansicht seien, „dass Sie sich in ganz besonderer Weise in diesem Wahlkampf um die Sozialdemokratie verdient gemacht haben“ . (Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 47). Brandt hatte für die SPD fast 40 Prozent der Stimmen geholt.
Der Versuch, wieder „gut Wetter“ mit der SPD zu machen, bekam aber Anfang November einen erneuten Tiefschlag. Die Frankfurter Rundschau veröffentlichte einen Leserbrief des in Bonn verbliebenen SHB-Schatzmeisters Erich Langmantel zur Abwahl von Wolfgang Lefèvre (s.o.): „Der Sturz des AStA-Vorsitzenden Lefèvre als 1. AStA-Vorsitzendem zeigt wieder einmal mehr, welche Leute in der Berliner Gruppe den Ton angeben: SPD-fromme Studenten, deren Hauptziel es ist, ihre persönliche Karriere zu sichern. Deshalb fällt es ihnen auch leichter, mit Korporationen und RCDS zusammenzugehen, als mit den liberalen und sozialistischen Studenten, die es noch wagen, sich offen zu einer unabhängigen und kritischen Linie zu bekennen“ . (Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 51.)
Ende November erklärte Langmantel seinen Rücktritt. Ab diesem Zeitpunkt saß ich mit unserer Sekretärin, „Fräulein“ (so hieß das damals noch) Maibach, alleine im Bonner Büro.
Die unterschiedlichen politischen Konzepte – Demokratischer Sozialismus vs. Stamokap-Theorie vs. Frankfurter Schule vs. Marburger Schule
Ende Januar 1966 fand in Höchst im Odenwald eine Konferenz der SHB-Vorsitzenden, des Bundesbeirats, der Landesvorsitzenden und Funktionsträger des SHB in den Asten und im VDS statt. Berliner Genossen legten dort ein „Arbeitspapier“ vor. Darin bekannte sich der SHB zu einem „Konzept des demokratischen Sozialismus“, das sich im „Widerspruch zum dogmatisch-ideologischen Teil der marxschen Gesellschaftstheorie“ verstehe:
„Der demokratische Sozialismus will die optimale Ausgestaltung einer ständigem Wandel unterworfenen Gesellschaft. Er entwirft kein utopisches Gesellschaftsbild, das zur realen Gesellschaftsverfassung in unüberwindlichem Widerspruch stehen würde und dem einzelnen Menschen ´dogmatisch` durch Interpretation und Imperativ die Möglichkeit zur freien Entscheidung nehmen würde“. (Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 63)
Dieses Konzept des „demokratischen Sozialismus“ hob sich deutlich ab, von der aus meiner Sicht rigiden Subsumtion aller gesellschaftlichen Verhältnisse unter ein theoretisches Dogmengebäude, das sich später vor allem bei den Kölner und Bonner SDS-Gruppen, aber auch bei Teilen des SHB und der Jusos zur sog. „Stamokap“-Theorie verdichtete. Diese marxistisch-leninistische Ideologie vom „Staatsmonopolistischen Kapitalismus“ ging von der Verschmelzung der Monopolmacht der Wirtschaft mit der Regierungsmacht aus. Sie unterstellte eine Endstufe des Kapitalismus, in der das monopolisierte Kapital sich die Staatsmacht unterwarf, um seine Verwertungsbedingungen zu erhalten oder noch zu steigern.
Das SHB-Konzept eines „demokratischen Sozialismus“ unterstellte dagegen eine „relative Autonomie“ der staatlichen Politik gegenüber den herrschenden Kapitalfraktionen.
Wenngleich meiner vom Jura-Studium eingeübten Denkschulung das Subsumieren der gesellschaftlichen Abläufe unter ein geschlossenes Dogmengebäude sehr entgegenkam, hatte ich größere Sympathien für die Sichtweise einer gewissen reformerisch und demokratisch gestaltbaren Offenheit des politischen Prozesses gegenüber den Interessen der Kapitalfraktionen.
(Dass ich später nicht in den Marxistischen Studentenbund Spartakus (MSB) eintrat, habe ich einmal so begründet, dass ich schon einmal aus der Kirche ausgetreten sei und ich mich nicht ein zweites Mal einem bestimmten Glauben unterwerfen wolle.)
Der Einfluss der „Frankfurter Schule“, also den Adepten von Adorno, Horkheimer oder Marcuse, die vor allem im Frankfurter SDS tonangebend waren, war im SHB gering. Mir selbst war zunächst eigentlich nur Adornos viel zitierter Leitsatz „Es gibt kein richtiges Leben im falschen“ geläufig. Erst nach meiner Zeit im SHB-Bundesvorstand habe ich mit Marcuses „repressiver Toleranz“ oder dem „eindimensionalen Menschen“ beschäftigt. Ich habe jedoch seine „Randgruppentheorie“ und das Konzept der „Großen Weigerung“ gegenüber einer „totalitären Herrschaftsform der industriellen Zivilisation“ und die von Marcuse herausgearbeitete „nichtterroristische ökonomisch-technische Gleichschaltung“ als eine abgehobene Theorie ohne Vermittlung zu einer gesellschaftlichen Praxis nicht überzeugend empfunden. Seine „demokratische erzieherische Diktatur freier Menschen“ mag zwar ab 1968 den Narzissmus der sich als Avantgarde stilisierenden Frankfurter SDSler und einzelner Sektenführer befriedigt haben, insgesamt hat jedoch seine These, dass die „Randgruppen“ Träger einer revolutionären Veränderung sein sollten, tatsächlich zum Ende und zum Zerbröseln der Studentenbewegung geführt.
Siehe dazu mein Referat „Demokratietheorien der außerparlamentarischen Opposition“ aus dem Jahr 1968
Viel mehr anfangen konnte ich mit dem von der Juristerei herkommenden in Marburg lehrenden Wolfgang Abendroth. Auch er grenzte sich – wie die Frankfurter Schule – scharf vom sozialwissenschaftlichen „Positivismus“ ab. Dieser allein das erfahrungsmäßig Gegebene, d. h. das Positive, als wissenschaftlich Erkenntnis anerkennenden Theorie hält er – Marcuse noch ganz ähnlich – vor, durch den Verzicht auf jedwede politische Theorie, sich stets mit der Realität zu identifizieren und diese zu rechtfertigen.
Abendroths Thema ist jedoch nicht so sehr die “kritische Gesellschaftstheorie“, die die Gesellschaft im Lichte ihrer genutzten und ungenutzten oder missbrauchten Kapazitäten analysiert, als vielmehr die Entwicklung der Arbeiterbewegung und ihre Selbstverständigung in einer Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus. Abendroths Analysen des kapitalistischen Produktionsprozesses, seiner Gesetzlichkeiten und seiner Widersprüche hatten mich mehr angesprochen, als die meisten der anderen damals viel gelesenen Autoren. Mit seinen Analysen über die wirtschaftlichen Machtpositionen, die nicht nur Kommandogewalt über die Arbeitnehmer und die Verflechtung von Großwirtschaft und öffentlicher Hand bedeuteten, sondern auch einher gingen mit dem Einfluss auf die Parteien, die Kontrolle der öffentlichen Meinung und – was für mich als hochschulpolitisch Engagiertem besonders wichtig war – mit der Instrumentalisierung der Bildung im wirtschaftlichen Partikularinteresse, konnte ich viel anfangen.
Die von Abendroth historisch etwa am Beispiel des Nationalsozialismus belegte These, dass die Inhaber wirtschaftlicher Macht die formale Demokratie ohne weiteres preisgaben, wenn es darum ging ihre Machtposition zu erhalten, gewann für mich vor allem vor dem Hintergrund der Debatte um die Notstandsgesetze an Aktualität.
Ansprechend für mich als stud. jur. waren vor allem seine Vorstellungen von einer „sozialen Demokratie“ (in Erweiterung einer „formalen Demokratie“) und seine damit verbundene These, dass durch das Bekenntnis des Grundgesetzes zum „sozialen Rechtsstaat“ (Art. 20 GG), die bestehende Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung nicht etwa vorgegeben, sondern für eine demokratische Gestaltung, also auch für den Sozialismus offen sei. Sozialismus sei nichts anderes als die Verwirklichung der Demokratie als inhaltliches Prinzip für die gesamte Gesellschaft.
Ein „gläubiger Jünger“ wurde ich zwar nicht, dazu war Abendroths Gesellschaftstheorie doch zu oft vor der Praxis gescheitert, aber sein Ideal einer „sozialen Demokratie“ blieb mir bis heute ein Leitbild.
Mitglied im SHB-Bundesvorstand – Konflikte mit der SPD
Die deutliche Abgrenzung der SHB-Führungsgremien vom SDS mit dem Konzept des „demokratischen Sozialismus“ hat den jugend- und bildungspolitischen Referenten in der „Baracke“ (so nannte man den Sitz des SPD-Parteivorstandes in Bonn), Waldemar Ritter, nicht davon abgehalten, der SPD-Führung zu empfehlen, dem SHB das vertraglich eingeräumte Recht, sich „sozialdemokratisch“ zu nennen, zu entziehen. Das Parteipräsidium lehnte dies im Februar 1966 zwar noch ab, setzte aber eine Kommission unter Leitung des damaligen parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Bundestagsfraktion, Gerhard Jahn, ein, die „Leitsätze“ für eine weitere Zusammenarbeit vorlegen sollte.
Damit aber noch nicht genug: Auf einem Parteitag der SPD im Juni 1966 wurde die Aufhebung des Unvereinbarkeitsbeschlusses mit dem SDS an den Parteivorstand zur „Erledigung“ überwiesen. Statt sich dem SDS wieder anzunähern, hat der SPD-Parteivorstand die Unvereinbarkeit einer Mitgliedschaft in einer „schlagenden Verbindung“ mit einer solchen in der SPD aufgehoben. Was beim SHB wiederum zu großem Ärger geführt hat. In einer Resolution einer außerordentlichen Delegiertenversammlung im Januar 1967 hieß es: „Wenn sich die Sozialdemokratische Partei schon weit öffnet, warum dann nur für die antidemokratischen Nationalisten und nicht auch für demokratische Sozialisten“. (Albrecht, a.a.O. S. 456)
Vom 2. Bis 6. März 1966 fand die 7. ordentliche Delegiertenversammlung des SHB in der „Johannes Gutenberg-Universität“ in Mainz statt. Christoph Zöpel wurde zum 1. Bundesvorsitzenden gewählt – Rainer Wirth (FU Berlin) und ich zu seinen Stellvertretern.
In seinem Rechenschaftsbericht schrieb Christoph Zöpel zum Verhältnis zwischen SHB und SPD:
„Der Sozialdemokratische Hochschulbund hat sich die eine Aufgabe gestellt, an der politischen Diskussion innerhalb der Sozialdemokratie teilzunehmen. Es stellt sich ihm aber verstärkt eine zweite: Seine Aufmerksamkeit muss sich intensiv den Problemen der deutschen Hochschule zuwenden…
Bei allen kritischen Äußerungen von sozialdemokratischen Studenten, Mitgliedern dieses Verbandes, zu bestimmten politischen Entscheidungen…der SPD muß man berücksichtigen und sollte man festhalten, daß diese Kritik nicht die Kritik Außenstehender ist. Wir bemühen uns um die Teilnahme an dem Prozeß ständiger Selbstkritik, der für jede demokratische Partei notwendig ist. In diesem Sinne sieht der SHB seine Aufgabe innerhalb der Sozialdemokratie, er will dazu beitragen, daß sich die SPD weiter entwickelt zu einer Partei, die den Anforderungen des 20. Jahrhunderts gewachsen ist.“
SHB, Beschlüsse und Stellungnahmen, herausgegeben vom Bundesvorstand des SHB, als Manuskript gedruckt 1966, S. 15, 17f.
Um das damalige Spannungsverhältnis zwischen SHB und SPD zu verstehen, ist es notwendig, auf die Geschichte dieses Studentenverbandes zurückzublicken:
Der SHB wurde, nachdem die SPD den SDS 1959 verstoßen und im Oktober 1961 die Mitgliedschaft im SDS für unvereinbar mit einer SPD-Parteimitgliedschaft erklärt hatte, im Jahre 1960 zunächst als lammfrommer Studentenverband der Partei gegründet. Den Namen „sozialdemokratisch“ durfte der Verband nur auf Widerruf führen. Der SHB bekannte sich zum Godesberger Programm der SPD und stand anfänglich als „Musterknäblein“ politisch sogar eher rechts von der Mutterpartei. Das änderte sich jedoch bald.
Einen ersten heftigen politischen Konflikt zwischen Partei und studentischer Jugendorganisation gab es, als der SHB schon auf seiner 5. Ordentlichen Delegiertenversammlung im Mai 1964 in Heidelberg in einem Beschluss unter bestimmten Bedingungen in einem Friedensvertrag die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Ostgrenze Deutschlands forderte:
„Der SHB hält es …für die dringende Aufgabe der Bundesregierung und der im Bundestag vertretenen Parteien, im Rahmen einer Gesamtkonzeption der Entspannung als Weg zu einer erfolgreichen Deutschlandpolitik einen Auszug aus einem Friedensvertragsentwurf vorzulegen, der eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze vorsieht.“ (SHB, Beschlüsse und Stellungnahmen, a.a.O., S. 18f.)
Für die SPD-Führung war das (damals noch) ein Tabubruch.
Provozierend für die Mutterpartei war auch, dass 1964 die Bundesvorstände von, SHB und des von der SPD verstoßenen SDS, zusammen mit dem Liberalen Studentenbund Deutschlands (LSD) , der Deutsch-Israelische Studiengruppe (DIS), der Humanistische Studentenunion (HSU) und dem Internationalen Studentenbund – Studentenbewegung für übernationale Föderation e.V. (ISSF), den gewerkschaftlichen Hochschulgruppen und einzelnen Evangelischen Studentengemeinden (ESG) das sog. „Höchster Abkommen“ schlossen. In diesem Abkommen vereinbarten diese Verbände eine politische Zusammenarbeit in den Studentenparlamenten und im studentischen Dachverband des Verbandes deutscher Studentenschaften (VDS).
Der Bundesvorsitzende des SDS, Helmut Schauer (später Tarifexperte der IG Metall), sprach auf der Bundesdelegiertenversammlung des SHB im März 1965 ein Grußwort. Der Beobachter des SPD-Parteivorstandes verließ daraufhin den Saal.
1965 gab es neuen Ärger: Die 6. Bundesdelegiertenversammlung in Marburg forderte den Verzicht auf die „Hallstein Doktrin“. Diese außenpolitische Leitlinie bestimmte, dass die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur DDR durch Drittstaaten als „unfreundlicher Akt“ gegenüber der BRD betrachtet wurde. Im Beschluss des SHB heißt es:
„Der Sozialdemokratische Hochschulbund hält es für erforderlich, auf die Hallstein-Doktrin als Mittel deutscher Außenpolitik zu verzichten. Die Hallstein-Doktrin hemmt eine konstruktive und flexible Außenpolitik besonders gegenüber den Ostblockländern und isoliert die Bundesrepublik“. (SHB, Beschlüsse und Stellungnahmen, a.a.O. S. 19)
Außerdem wetterte der SHB schon damals gegen eine drohende Große Koalition. Alle diese Beschlüsse und Aktivitäten verschlechterten das Verhältnis zur Parteiführung.
Auf der Delegiertenversammlung im März 1966, auf der ich dann in den Bundesvorstand gewählt wurde, gab es eine heftige Debatte über das Verhältnis des SHB zu der Ostermarsch-Bewegung. Mit zwei Stimmen Mehrheit wurde ein Antrag angenommen, nach dem der SHB die Ziele der „Kampagne für Demokratie und Abrüstung“ unterstützen solle und seinen Mitgliedern empfiehlt, „sich an den Veranstaltungen der Ostermarschierer zu beteiligen“. (SHB, Beschlüsse und Stellungnahmen, a.a.O. S. 31)
Die SPD und der DGB warnten vor einer Teilnahme an den Ostermärschen. Sie hielten die Bewegung „kommunistisch unterwandert“.
Wie inzwischen alle linken Studentenverbände verurteilte auch der SHB die den Krieg der USA in Vietnam.
Der Vietnam-Krieg wurde geradezu zum verbindenden Element der internationalen Studentenbewegung. Die Kritik an diesem Krieg hat mit der Rede von Martin Luther King am 4. April 1967 in der Riverside Kirche in New York noch einmal eine besondere moralische Unterstützung gefunden. „Wenn Profite und Eigentum mehr zählen als die Menschen selbst, dann werden wir nie das gigantische Dreigestirn von Rassismus, Materialismus und Militarismus überwinden“. (FR v.30.01.2018 S. 20f.)
Außerdem kritisierte der SHB die Geheimverhandlungen bei der Notstandsgesetzgebung.
Weniger Aufregung verursachten Beschlüsse zu bildungspolitischen Themen, u.a. wurde ein „Reformplan des allgemeinbildenden deutschen Schulwesens“ vorgelegt. Hochschulpolitisch wurde eine vom elterlichen Einkommen unabhängige Ausbildungsförderung und Vorlesungskritiken an Universitäten, die Ausweitung der Mitbestimmung in Unternehmen und vieles andere mehr gefordert.
Selbst das Verbandsmagazin des SHB „frontal“ sprach von einem Linksrutsch auf dieser Delegiertenversammlung. (Dokumentation FU-Berlin a.a.O. S. 275f.)
Ostkontakte
Zusätzlichen Ärger mit der „Mutterpartei“ brachte ein Memorandum, in dem vorsichtig die „nationalstaatliche Zielsetzung“ der Bonner Wiedervereinigungspolitik in Frage gestellt wurde:
„Beide Machtgruppen respektieren ihre gesellschaftlichen und politischen Verfassungen. Diese gegenseitige Respektierung beruht weniger auf einer Identität aller Ziele beider Gesellschaftssysteme, als auf der notwendigen Erkenntnis, daß nur der Friede sie der Verwirklichung ihrer Ziele näher bringen kann… Daher muß der Begriff der Koexistenz beiderseits als Bestandteil in der Theorie vom Zusammenleben der Völker aufgenommen werden.“ (SHB, Beschlüsse und Stellungnahmen, a.a.O., S. 19 ff. (21)(
Auf gut deutsch, es wurde der Alleinvertretungsanspruch der BRD in Frage gestellt und praktisch die „Zwei-Staaten-Theorie“, d.h. die Position der DDR übernommen, dass auf deutschem Boden zwei Staaten existierten.
Dementsprechend hielt der SHB „verstärkte Kontakte zu Osteuropa (einschließlich der UdSSR und der DDR) für notwendig“ und fordert von der SPD die Aufhebung der „Richtlinien für Ostkontakte“. (SHB, Beschlüsse und Stellungnahmen, a.a.O., S. 26)
Nach diesen Richtlinien drohte die SPD mit Parteiausschluss, wenn offizielle Kontakte zu kommunistischen Organisationen im Osten aufgenommen wurden. Auch die Teilnahme an wesentlich von kommunistischen Organisationen veranstalteten Festivals wie den damaligen „Weltjugendfestspielen“ war untersagt.
Im April 1966 habe ich zusammen mit Rainer Wirth an einem „informellen“ Gespräch mit Mitgliedern des Zentralrates der FDJ Günter Schneider und Horst Kapson teilgenommen, in dem über gemeinsame Seminare zwischen SHB und FDJ gesprochen wurde. Bei einem weiteren Treffen wurden zwei gemeinsame Seminare vereinbart. Am 21. Juni fand in Bonn ein weiteres Gespräch mit dem Zentralrat der FDJ statt.
Teilnehmer u.a. Günther Schneider und Horst Kapson von der FDJ, Christoph Zöpel, Dieter Goy, Robert Lossen (der Schatzmeister) und ich von Seiten des SHB
Ende Juni gab es Irritationen, weil der Zentralrat der FDJ über „offizielle Kontakte“ zum SHB-Bundesvorstand sprach.
Ich kann mich an Ort und Zeit nicht mehr genau erinnern, jedenfalls nahm ich in der DDR auch an einem Seminar mit FDJlern teil. Es waren auffallend viele „Genossinnen“ anwesend. Am Abend wurde ordentlich getrunken und die Westjungs flirteten heftig mit den Ostmaiden – und mehr. Ich war (damals leider) Leiter der West-Delegation und musste mich den ganzen Abend mit meinem Gegenüber unterhalten und vor allem mit ihm trinken. Das war letztlich mein Glück, denn ein Mitglied unserer Delegation (das schon verheiratet war) wurde anschließend wegen seines „Fremdgehens“ erpresst und ihm wurde später wegen Spitzelei für die Stasi der Prozess gemacht
Alfred Nau, damals Schatzmeister der SPD, drohte mir aufgrund solcher Verstöße gegen die Beschlusslage der Partei in einem Schreiben bei einem weiteren Verstoß gegen Parteibeschlüsse den Ausschluss aus der Partei an.
Die Konflikte mit der Partei brachten mir und anderen auch eine Einbestellung beim stellvertretenden Bundesvorsitzenden der SPD, Herbert Wehner, ein. Das war eine denkwürdige Begegnung. Wir kamen ins Büro von „Onkel Herbert“, er saß mit der obligatorischen Pfeife im Mund am Schreibtisch über Akten. Er schaute nicht auf. Plötzlich fing er an, uns anzubrüllen, so nach dem Motto was wir Rotzlöffel, die wir noch grün hinter den Ohren seien uns eigentlich einbildeten usw. usf. Er brüllte etwa fünf Minuten und warf uns dann aus dem Raum, ohne dass wir auch nur ein Wort sagen konnten.
Auf einer gemeinsamen Sitzung der Bundesvorstände von SHB und SDS kam es zu Meinungsstreitigkeiten über eine Erklärung anlässlich des an der Uni in Frankfurt geplanten Kongresses – manche sprachen auch vom ersten deutschen Teach-in – unter dem Titel „Vietnam – Analyse eines Exempels“. Die SHB-Seite sprach sich für einen „rein wissenschaftlichen Charakter“ der Veranstaltung auch unter Teilnahme von Vertretern der US-Regierung aus, während der SDS für eine demonstrativ-öffentliche Kundgebung eintrat. Letztlich trat der SHB nicht als „Mitveranstalter“ auf. Was u.a. vom Berliner und Frankfurter SHB kritisiert wurde. Christoph Zöpel sprach jedoch zu Beginn des Kongresses am 22. Mai 1966 ein Grußwort. Alles was damals Rang und Namen innerhalb der Linken war an der Frankfurter Uni vertreten, u.a. Wolfgang Abendroth, Conrad Ahlers, Norman Birnbaum, Bo Gustafson, Frank Deppe, Jürgen Habermas, Arno Klönne, Herbert Marcuse, Oskar Negt, Theo Pirker u.v.a.m.
Etwa 2.200 Teilnehmer nahmen eine Schlusserklärung an, in der es hieß:
„Der Vietnamkrieg ist ein nationaler und sozialer Befreiungskampf; er ist ein Modellfall für die Konflikte in den anderen halbkolonialen Agrarländer Asiens, Afrikas und Lateinamerikas; die Interventionspolitik der USA bedroht nicht nur die Existenz des vietnamesischen Volkes, sondern widerspricht den Lebensinteressen der großen Mehrheit der Bevölkerung in den USA“. (Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 317)
Auf einem Bundesseminar in Hannover am 26./27 Mai 1966 wird über das SHB-Grundsatzprogramm diskutiert. Zöpel referiert zum Thema „Studentenverband und Volkspartei“ und plädiert für eine Fortsetzung der innerparteilichen Arbeit des SHB in der SPD. Der anwesende SDS-Bundesvorsitzende kritisiert das als „innerparteiliche Illusion“. (Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 95)
Der SHB-Bundesvorstand solidarisiert sich mit den Forderungen von mehr als 3.000 Studenten der Freien Universität beim ersten „Sit-in“ in Deutschland am 22./23. Juni 1966. Die Forderungen waren u.a. Abschaffung der befristeten Zulassung, Parität aus Professoren, Assistenten und Studenten in der Selbstverwaltung, öffentliche Diskussion mit dem Rektor und dem akademischen Senat, Wiedereinstellung des Assistenten Krippendorff und grundsätzlich:
„Wir kämpfen nicht nur um das Recht, längere Zeit zu studieren und unsere Meinung stärker äußern zu können. Das ist nur die halbe Sache. Es geht uns vielmehr darum, daß Entscheidungen, die die Studenten betreffen, demokratisch und unter Mitwirkung der Studenten getroffen werden…. Es gilt, die Freiheit in der Universität als Problem zu sehen, das über den Rahmen der Universität hinausweist. Aus diesem Grund sieht die Studentenschaft die Notwendigkeit, mit allen demokratischen Organisationen in der Gesellschaft zusammenzuarbeiten, um ihre Forderungen durchzusetzen.“
Selbstverständlich beschäftigte sich der SHB Bundesverband auch mit der Hochschulpolitik, so hat der Bildungspolitische Ausschuss in einer von Marlies Seeling betreuten Stellungnahme ein Gutachten des Wissenschaftsrats (WR) kritisiert. Der WR schlage eine unangemessene Reglementierung des Studiums vor, so verhindere die Trennung von Grund- und Aufbaustudium eine wissenschaftliche Ausbildung. Eine Zwischenprüfung dürfe nicht der Auslese dienen, eine Zwangsexmatrikulation sei grundsätzlich abzulehnen, das Universitätsexamen dürfe keine Auslesefunktion zum sog. Aufbaustudium sein. Dokumentation FU-Berlin a.a.O. S. 352f.
Forderungen die nach den Bologna-Reformen der zurückliegenden zwei Dekaden höchst aktuell klingen.
Das größte außerparlamentarische politische Ereignis dieses Jahres war der von der IG Metall finanzierte Kongress „Notstand der Demokratie“ am 30. Oktober 1966 in Frankfurt an dem über 5000 Gewerkschafter, SPD-Mitglieder, sämtliche linken Studentenverbände und auch eine große Zahl von Professoren aktiv beteiligt waren. Auf der Schlusskundgebung, an der über 20.000 Menschen teilnahmen, sprach Ernst Bloch die vielzitierten Anfangs- und Schlusssätze:
„Wir sind hier zusammen gekommen, um den Anfängen zu wehren.“
Und als Schlusssatz:
„Die alten Herren mit ihrem Artikel 48 haben bereits die Vergangenheit verspielt, die neuen Herren mit ihrem Notstandsunrecht sollen nicht unsere Zukunft verspielen.“ (Dokumentation S. 355.)
Art. 48 der Weimarer Verfassung, der sog. Notverordnungsartikel, also die gesetzesvertretende Anordnung der Exekutive, die später zum Freibrief für die Tyrannei des „Dritten Reiches“ wurde.
Ende November 1966 einigten sich die Verhandlungskommissionen von CDU/CSU und SPD auf die Bildung einer Großen Koalition mit Kurt Georg Kiesinger als Kanzler und Willy Brandt als Vizekanzler und Außenminister.
Der SHB-Bundesvorstand fordert die sofortige Einberufung eines außerordentlichen Parteitags. In einem Telegramm an den Parteivorstand der SPD heißt es:
„Der SHB ist tief betrübt über die Entscheidung der Verhandlungskommission der SPD, mit der CDU gemeinsam eine Bundesregierung zu bilden. Besonders die Unterstützung Kiesingers ist wegen seiner ungeklärten Vergangenheit unverständlich. Eine große Koalition lässt ein Ansteigen der Stimmen für die NPD fürchten….(Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 326)
In Berlin organisierte der SHB eine Protestkundgebung gegen die Große Koalition auf dem Wittenbergplatz, auf der Harry Ristock (SPD), Lothar Pinkall (IG Metall) und Rainer Wirth vom SHB-BV sprachen. Wirth nannte das Zusammengehen „ein Produkt Wehnerscher Machtpolitik“.
Nachfolger im Amt des Regierenden Bürgermeisters von West-Berlin wird der ehemalige evangelische Pastor Heinrich Albertz, der zunächst den Polizeieinsatz am 2. Juni 1967 verteidigte und aufgrund seines unglücklichen Agierens von seiner eigenen Partei zum Rücktritt gezwungen wurde.
Albertz über seinen Rücktritt: „Ich war am schwächsten, als ich am härtesten war, in jener Nacht des 2. Juni, weil ich objektiv das Falsche tat.“
Albertz` Nachfolger wurde Klaus Schütz. Auch ihm schlug heftiger Protest entgegen. „Phrasen dreschen Knüppel ins Genick, das ist Berliner Schütz-Politik“, so lauteten etwa die Parolen. Schütz war seinerseits allerdings alles andere als zimperlich. Auf einem SPD-Parteitag im Frühjahr 1968 soll er laut BZ erregt in den Saal gerufen haben „Ihr müsst diese Typen sehen. Ihr müsst ihnen ganz genau ins Gesicht sehen, dann wisst ihr, denen geht es darum, unsere freiheitliche Grundordnung zu zerstören.“
Der SHB war ein entschiedener Gegner der GroKo. Damit werde die Demokratie geschwächt, weil eine starke Opposition fehle. Es werde der Weg für die Notstandsgesetze frei gemacht. Man nahm der SPD übel, dass sie einen ehemaligen Nazi als Kanzler duldete und den nach der Spiegel-Affäre als Lügner bloßgestellten Franz Josef Strauß als Finanzminister rehabilitiere.
Deshalb fand vom 20.- 22. Januar 1967 in Duisburg-Wedau eine (erste) außerordentliche Bundesdelegiertenversammlung des SHB zum Thema Große Koalition statt. Das SPD-Präsidiumsmitglied Carlo Schmid und der Parlamentarische Geschäftsführer Gerhard Jahn verteidigten den Standpunkt der SPD-Führung. Von Seiten der Delegierten gab es heftige Kritik. Die Delegierten erklärten in einer Resolution, dass die SPD durch ihre Mitarbeit in der Großen Koalition „auf die Verwirklichung wesentlicher Forderungen des Godesberger Programms verzichtet“ habe und sich nicht mehr als Reformpartei, sondern als „Bewahrer der bestehenden Gesellschaftsordnung“ verstehe. (Albrecht, a.a.O. S. 458)
Der SHB stehe „in Opposition zu der derzeitigen Politik der Bundesregierung“. (Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 139 )
Von da an verstand sich der SHB als linke Opposition und versuchte innerhalb der Partei mit kritischen Gruppen zusammenzuarbeiten und der Politik der für rechts gehaltenen SPD-Führung entgegenzuwirken. „Man war nicht gegen die SPD, sondern gegen Herbert Wehner. Man zitierte Willy Brand bei jeder Gelegenheit und schwieg Fritz Erler tot“.
Kai Hermann, Die Zeit v. 19. März 1965
Niels Kadritzke monierte, in der SPD verlören „Diskussionsbeiträge erst dann ihre parteischädigende Wirkung … wenn Herbert Wehner sie liefert„.
Eine Forderung nach Stärkung der „Arbeitsgemeinschaften“ in der SPD wurde von der Parteiführung als Aufruf zur „Fraktionsbildung“ interpretiert und auch der Aufruf zur Zusammenarbeit mit der „Außerparlamentarischen Opposition“ stieß auf heftige Kritik. Der Referent für jungendpolitische Fragen beim Parteivorstand Waldemar Ritter empfahl erneut Sanktionen und Gerhard Jahn drängte auf einen „Namensentzug“. (Albrecht, a.a.O. S. 458)
Am 2. März 1967 war es dann soweit: Der Sekretär des SPD-Parteipräsidiums Heinz Castrup teilte dem Bundesvorstand des SHB schriftlich die Entscheidung des Präsidiums mit, „dass Euch weitere finanzielle Unterstützung nicht gewährt wird.“ http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-46135560.html Gleichzeitig wurde ein Gespräch mit Helmut Schmidt, Alfred Nau, Richard Freyh und Gerhard Jahn in Aussicht gestellt.
Wenige Tage später dementierte allerdings – erstaunlicher Weise – der stellvertretende Parteivorsitzende Herbert Wehner diese Entscheidung. Das Präsidium habe keine „grundsätzliche Sperre der Geldzuweisungen“ beschlossen. Es sei nur so, dass die SPD nicht einsehe, innerhalb kurzer Zeit zwei SHB Kongresse zu finanzieren, die sich gegen die Politik der SPD wendeten.
Es handelte sich dabei um die schon genannte außerordentliche Delegiertenversammlung in Duisburg und um die für Anfang März geplante ordentliche Delegiertenversammlung. Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 148
Der Bundesvorstand des SHB war qua Amt auch Herausgeber des Verbandsmagazins „Frontal“. Der Chefredakteur war Wolfgang Kaden, später Chefredakteur des Spiegel und danach des manager magazins. Diese Herausgeberschaft verschaffte mir zusammen mit Ulf Kadritzke einen Interviewtermin bei Günter Grass. Der spätere Literaturnobelpreisträger war zuvor von Bundeskanzler Erhard hart angegangen worden: „Wir wollen darauf verzichten, in unserem Wahlkampf die Blechtrommel zu rühren… Ich kann die unappetitlichen Entartungserscheinungen der modernen Kunst nicht mehr ertragen. Da geht mir der Hut hoch.“
Grass unterstützte grundsätzlich den Ungehorsam und die Politisierung der Studenten, setzte sich aber scharf von Rudi Dutschke ab. (Er wolle keinesfalls in Dutschkes Staat leben.) Er führte eine Art Zweifrontenkrieg: Faschistische Praktiken seien in den Hetzkampagnen der Springer-Presse genauso zu beobachten, wie bei den Zeitungsverbrennungsaktionen des SDS.
Günter Grass und die Deutschen: Eine Entwirrung
Auf der 8. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 8. – 12. März 1967 des SHB in Bochum hat sich die Mehrheit dafür entschieden erneut den Frieden mit der Parteiführung zu suchen. So unterstützten die Delegierten in einer Resolution die „neue Ostpolitik der Bundesregierung“. Sie begrüßten ferner „die Berliner Erklärung des Bundesaußenministers Willy Brandt, in der klargestellt wird, dass diese …(nicht) eine Einverleibung der DDR zum Ziel hat“. Nur die Aufgabe des Alleinvertretungsanspruchs könne die Glaubwürdigkeit einer solchen Außenpolitik bekräftigen.
Die Versammlung protestierte gegen die Beeinflussung von Studentenorganisationen durch die CIA. Laut einem kurz zuvor erschienen Bericht der New York Times hatte die CIA Studenten der Freien Universität Berlin angeworben, als Spione tätig zu sein. Außerdem forderte der SHB die „Wiederzulassung der KPD“, denn nicht zuletzt die Illegalisierung der KPD habe jene „Schützengrabenideologie des irrationalen Antikommunismus“ in Deutschland gefördert, die die deutsche Außenpolitik auf „das Problem der Verteidigungsbereitschaft reduziert“ habe. Dokumentation FU-Berlin, a.a.O. S. 149
In Bochum wurde der Professorensohn Erdmann Linde (Bonn) zum Bundesvorsitzenden, Rudolf Kollmann (Berlin) und Jens Litten (Hamburg) zu seinen Stellvertretern gewählt.
Erdmann Linde wurde später WDR-Redakteur und schließlich Leiter des westfälischen Landesstudios Dortmund. Jens Litten gab sich besonders verbalradikal und ist später u.a. Chefredakteur eines Springer-Blattes namens „Winners“ geworden, ein „Leitbild-Magazin“ (Litten), das (laut Spiegel) Aufsteigern und solchen, die es bereits geschafft haben, hochglänzend den rechten Weg weisen sollte. Danach ist er noch als Verleger von Werbemagazinen (für die Zigarettenmarke HB und für die Lufthansa) und schließlich als Grundstücksaufkäufer auf Rügen in Erscheinung getreten. Eine solche Kariere ist nicht ganz untypisch für manche, die besonders verbalradikal aufgetreten sind und sich in besonderer Weise an das System angepasst haben.
Erdmann Linde genoss offenbar größeres Vertrauen der Partei als wir, als seine Vorgänger. (Albrecht, a.a.O. S. 458)
Aber auch diese Wiederannäherung und die Unterstützung durch Horst Ehmke und dem schleswig-holsteinischen Landesvorsitzenden, Jochen Steffen, haben nicht verhindert, dass der Parteirat der SPD 1972 mit nur einer Gegenstimme, dem SHB den Namen „sozialdemokratisch“ aberkannte, so dass sich der Verband von da ab „Sozialistischer Hochschulbund“ nannte.
Wird fortgesetzt
Bildquelle: flickr, user opposition24.de , CC BY 2.0