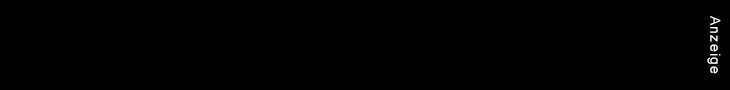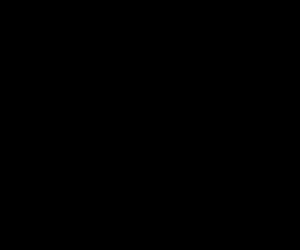Fragen der Identität spielen gegenwärtig eine große Rolle. In Zeiten der Globalisierung fühlen sich die Menschen zunehmend anonymen Entwicklungen ausgeliefert, die sie nicht durchschauen oder beeinflussen können und die ihnen als alternativlos dargestellt werden. Das Bedürfnis nach vertrauten Nahräumen wächst. Der Begriff Heimat hat Konjunktur. Im politischen Raum wird die Forderung nach einer „Leitkultur“ erhoben, als hilfloser Versuch, ein unverwechselbares, normatives Profil zu fixieren ohne zu bedenken, dass sich Kulturen ständig transformieren, weil sie sich neuen Einflüssen nicht verschließen können. Viele fühlen sich dadurch bedroht; andere sehen darin eine Bereicherung. Das Streben nach Identität läuft immer Gefahr, andere auszuschließen. Am deutlichsten wird dies im Ruf Wir sind das Volk. Die Behauptung des Wir dient dann dazu, sich abzugrenzen und das Fremde, Unbekannte herabzusetzen.
Blaise Pascal hatte bereits zu Beginn der Moderne die Frage gestellt: Woher kommen wir? Was sind wir? Wohin gehen wir? Darin spiegelte sich das Bedürfnis nach sinnstiftenden Orientierungen wider, wie die Religion sie einst bot.
In der Literatur hat vor allem Virginia Woolf versucht, sich diesen Fragen zu stellen. Sie hat zeitlebens nach der eigenen Identität gesucht und dies in einer Radikalität und Konsequenz, die ihresgleichen sucht. Sie gehört neben James Joyce und Marcel Proust zu den Schriftstellern, die am ambitioniertesten den Versuch unternommen haben, den Zumutungen der Moderne literarischen Ausdruck zu verleihen. Sie experimentieren mit literarischen Formen, mit denen sich die Gleichzeitigkeit der schier unermesslichen Eindrücke und Erfahrungen, die die Identität des modernen Individuums zu überfordern und zerreißen drohen, darstellen lässt.
Proust versucht, mit seiner Methode der unwillkürlichen Erinnerung das Vergehen der Zeit zu bannen, um sich zumindest für die Dauer der Erinnerung in der Illusion der Zeitlosigkeit zu verlieren. Joyce wiederum möchte die sich auflösenden und überlappenden Konturen der Wahrnehmung in kurze Sequenzen zerlegen, um der Bedeutung eines Augenblicks oder Dings wahrhaftig zu werden. Alles, was uns zufällig einfällt oder begegnet, wird so lange und intensiv betrachtet, bis die Gegenstände unserer Wahrnehmung zu uns zu sprechen beginnen – uns ihre Bedeutung offenbaren.
Auch Virginia Woolf sucht in ihrem Roman Die Wellen nach einer Erzähltechnik, die es ihr ermöglicht, sich der Logik eines linear fortschreitenden Zeitablaufs zu entziehen. Sie konfrontiert die verzweifelte Suche nach subjektiver Identität kompromisslos mit den Widerständen der realen Welt, wie sie ihr in den Routinen und Abnutzungserscheinungen des Alltags begegnen. Darin liegt vielleicht die Größe dieser Schriftstellerin: dass sie dieser Konfrontation nicht ausweicht, sondern sie bis in die letzte Konsequenz durchhält.
Insbesondere der Erfahrungsraum der Großstadt London ist es, der ihre kritische Auseinandersetzung mit dem modernen Leben herausfordert: die überbordenden Reize; der Lärm; die Hetze; die Hässlichkeit; die Zerfaserung der Wahrnehmung – das alles führt zu einem Chaos an Eindrücken, ja zu „Schockerfahrungen“, die der Mensch kaum noch verarbeiten kann. Die Härte der neuen städtischen Tatsachen, die sie am Beispiel Londons dargestellt hat, führen zu einer Depersonalisierung des Ichs, der Virginia Woolf schonungslos nachspürt. Wilhelm Genazino zitiert in seinen Poetik-Vorlesungen eine Reportage Woolfs aus den dreißiger Jahren:
Man sieht London als Ganzes – zusammengedrängt, massig und dicht bevölkert, mit seinen (…) Kränen und Gasometern und seinem ständigen Rauch, den kein Frühling und kein Herbst jemals fortbläst…Diesem Stück Erde (wurden)immer tiefere Wunden geschlagen, es (wurde) immer unbehaglicher gemacht, immer mehr zusammengeballt, mit Lärm und Unruhe erfüllt (…). Wenn man bedenkt, wie wir uns anrempeln, zur Seite stoßen (…), wie behände wir an Autos vorbeischlüpfen. Die bloße Anstrengung, am Leben zu bleiben, erfordert unsere ganze Energie (…). Auf diesen gewöhnlichen menschlichen Stoff wirkt der Druck einer ungeheuren Maschine ein. Und sowohl die Maschine selbst wie der Mensch, auf dem der Druck der Maschine lastet, sind einfach, gesichtslos, unpersönlich (…). Heute kann kein einzelner Mensch mehr dem Druck gesellschaftlicher Verhältnisse widerstehen. Sie fegen über ihn hinweg und vernichten ihn. Sie lassen ihn gesichtslos, namenlos, lediglich als ihr Instrument zurück.
Der Einzelne sieht sich einer zerreißenden Ambivalenz ausgeliefert, der er nahezu schutzlos ausgeliefert ist. Genazino spricht von einer Subjekt-Zerstückelung: Einerseits versucht er, den zerstörerischen Einflüssen zu entkommen, und einige Schonräume für sich zu entdecken; andrerseits muss er sich in seinem Alltag behaupten und dessen Anforderungen entsprechen. Dieser Antagonismus führt zu einer Spaltung des Individuums, die kaum noch psychisch bewältigt werden kann. Genazino:
Kein Autor der Moderne hat diese Aufspaltung des Subjekts gültiger und eindrucksvoller beschrieben als Virginia Woolf. Sie selbst hat die pathogenen Unkosten mit dem Leben bezahlt. In keinem anderen Werk wird das Hin- und Herpendeln des Ichs zwischen Verzückung und Vernichtung, zwischen Seligkeit und Finsternis so schmerzlich präzise vor uns ausgebreitet. Von allen Epiphanikern der Moderne ist Virginia Woolf deswegen die fortgeschrittenste, weil sie die Schwankungsbreite des modernen Ichs zeigt und gleichzeitig dessen Identitätszwang.
Diesem Identitätszwang – oder wie Adorno es genannt hat: dieser Nötigung, gegen alle Widerstände und Zumutungen der Gesellschaft ein Ich zu werden – sehen sich die Protagonisten der Wellen unaufhörlich ausgesetzt: Sie stehen vor der schier unlösbaren Aufgabe, Identität auszubilden und zu behaupten und bewegen sich gleichwohl in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem eine freie Individualität nicht wirklich möglich ist. Genau diese Ambivalenz spiegelt sich in den inneren Monologen der Figuren wider: das zunehmend verzweifelte Streben nach Selbstverwirklichung und Glück und das Versinken aller Bemühungen in der Gestaltlosigkeit der Alltagshandlungen – dieser ungreifbaren, unbeschreibbaren Watte.
Dieter Wellershoff hat darauf verwiesen, dass dies eine Grundproblematik im Leben von Virginia Woolf darstellt:
Es gelang ihr nie, dauerhaft im Leben Fuß zu fassen und ein zuverlässiges Verhältnis zur herrschenden Normalität zu bekommen. Für sie war der normale Alltag (…) das in Gewohnheiten und Automatismen sich vollziehende Leben der meisten Menschen, die Oberflächlichkeit der Wahrnehmungen, die verschwommene Unausdrücklichkeit ihrer Gefühle. Sie nahm sich und ihr Leben keineswegs davon aus. In ihrem Lebensrückblick (…) schreibt sie darüber: „Ein großer Teil des Tages wird nicht bewusst gelebt. Man geht spazieren, isst, sieht alles Mögliche und befasst sich mit dem, was getan werden muß: mit dem defekten Staubsauger, dem Planen des Dinners, dem Schreiben der Einkaufsliste (…), mit Waschen, Kochen, Buchbinden. An einem schlechten Tag ist der Anteil des Nicht-Seins viel größer.“ Ja, sie erlebte es wirklich als ein Nichtsein. Im Belanglosen und Alltäglichen lauerte das Nichts, von dem sie sich bedroht fühlte.
Genau das ist die existentielle Grundsituation ihrer Figuren, denen Virginia Woolf ihre Stimme verleiht: sie kämpfen gegen die Bedingungen an, die sie zu erdrücken drohen und suchen nach Momenten intensiven, bewussten Erlebens, unverstellten Sehens, sinnlicher Offenbarung – um zu spüren, dass das Leben einen Sinn hat. Eine ihrer Personen – Bernard – spricht es aus: Es gibt immer etwas, das man als nächstes tun muss. Dienstag folgt auf Montag; Mittwoch auf Dienstag. Es geht weiter, aber warum?
Virginia Woolf wählt in ihrem Roman Die Wellen als ordnendes Strukturprinzip den Ablauf eines einzigen Tages (wie Joyce in seinem Ulysses). Sie schildert einen Tag am Meer, von Sonnenaufgang bis -untergang. In den Ablauf dieses Tages flicht sie sechs innere Monologe dreier Männer und Frauen ein, die ihre Lebensgeschichte von der Kindheit bis zum Alter reflektieren. Unterbrochen werden die Monologe der Protagonisten von kurzen Naturbetrachtungen, in denen sich die Darstellung des Rhythmus der Jahreszeiten mit visionären Phantasiebildern vermischt. In diesen Einschüben taucht dann auch immer wieder das Wellenmotiv auf – als Symbol für die monotone Wiederkehr des ewig Gleichen und das Vergehen der Zeit.
Die Monologe der sechs Protagonisten enthalten Reflexionen über sich selbst, den Sinn des Lebens und das Konzept der Welt, in das die Individuen schicksalhaft eingewoben sind. Sie sind weniger Handelnde, als Denkende. Ihre Individualität bleibt seltsam unbestimmt. Selbst ihre Sprache wirkt überwiegend stereotyp. Als würden sie ihre Lebensträume zu Protokoll geben. Zwar unterscheiden sich die Figuren durch ihre Motive und deren Interpretation; aber recht eigentlich findet unter ihnen keine Kommunikation statt. Wellershoff schildert sie so:
Es sind sensible, reflektierende Menschen, die immer ein wenig neben sich stehen und sich beobachten und leidenschaftlich nach einem Lebenssinn suchen, Menschen, die nach Selbstvollendung streben. Virginia Woolf hat sich selbst, ihren Mann und Menschen aus ihrem Freundeskreis in den Personen des Romans gespiegelt. Aber nicht in einem naturalistischen, abbildhaften Sinne. Man bekommt keine plastischen Individuen zu Gesicht, sondern wird mit verschiedenen Lebensstimmungen und Geisteshaltungen vertraut gemacht. Die inneren Monologe der Personen unterscheiden sich nicht im sprachlichen Ausdruck, sondern sind alle in derselben erlesenen und schwelgerischen Sprache formuliert… In den „Wellen“ lässt Virginia Woolf ihre Personen sprechen, als gäben sie ein Kammerkonzert. Jeder spielt, mal für sich, mal als Antwort auf die anderen, seine Gedankenmusik, aber es ist immer die poetische, geschmeidige, zugleich sinnliche und spirituelle Sprache der Autorin selber.
Jede Person reflektiert auf die andere aus der jeweils eigenen Perspektive, wobei deutlich wird, dass sich einige von ihnen näher stehen als andere. Die Protagonisten sehnen sich nach dem gemeinsamen Erleben im Freundeskreis, auch nach Nähe – wissen aber gleichzeitig um die Vergeblichkeit ihrer Bemühungen. Ihre Einsamkeit erscheint wie eine undurchdringliche Hülle, aus der es kein Entrinnen zu geben scheint. Sie streben nach Gemeinschaft und spüren doch die Bürde des individuellen Lebens: und so kreisen die Reflexionen um Einsamkeit, Identität und die Sehnsucht nach der Nähe der Freunde, deren Anwesenheit – jedenfalls in der Erinnerung – die seltenen Momente möglicher Glückserfahrung verbürgte.
Es gelingt Virginia Woolf, die inneren Gefühlslagen und Bewusstseinsströme ihrer sechs Protagonisten mit größter Eindringlichkeit zu entfalten. Deren Sehnsüchte, Ängste und intimsten Regungen konfrontiert sie unablässig mit den Bedrohungen durch die alltäglichen Routinen. Einmal lässt sie den Phantasien und Wünschen ihrer Figuren freien Lauf; dann wiederum regredieren diese zu schwächlichen, mutlosen Geschöpfen, deren Versagungsängste sie zu zerstören drohen. Genazino führt aus:
Wir sehen in diesen schroffen Gegenüberstellungen das unerträgliche Schwanken des Ichs in der Moderne. Einmal ist es omnipotent und zermalmt die Welt, dann verzieht es sich in eine dunkle Ecke des eigenen Innenraums und macht ein kleinlautes Geständnis. Man kann sagen: Eine schon eingetretene Melancholie sucht nach einer Unterhaltung, das heißt nach ihrer Selbstauflösung. Erzählt wird bei Virginia Woolf gleichzeitig von innen und von außen. Genauer: Es wird von inneren wie äußeren Befindlichkeiten erzählt, und zwar so, als wären auch die inneren anschaulich. Sie erzählt von der inneren Welt, als k ö n n t e man von dieser erzählen. Faszinierend ist dabei, dass sich die Autorin um deren gegenseitige Anpassung im Erzählfluß nicht kümmert. Wir verfolgen eine laufende Minimalisierung, eine im Wortsinn unendliche innere Aufspaltung, die doch immer nur eines will: Sich selbst als ein Gesamt erleben, als ein Nichtaufgespaltenes.
Insbesondere in ihren Naturbetrachtungen hat Virginia Woolf versucht – als hinter den Figuren agierende Erzählerin – einen unverstellten Blick auf die Dinge zu werfen; die Perspektive der interesselosen, passiven, unbeteiligten Beobachterin einzunehmen. In die Darstellung des Zyklus eines Tages und des Ablaufs der Jahreszeiten sind ihr Schilderungen von großer Schönheit gelungen – Sonnenaufgänge, der Gesang der Vögel, die Metamorphosen der Pflanzen, der Wechsel der Gezeiten – also jener Welt des Lichts, nach der sich die Menschen sehnen, um sich von den Plagen der Zivilisation zu erholen. Zwar dringen hin und wieder auch Elemente des „Realitätsprinzips“ in diese Phantasiewelt ein; aber insgesamt überwiegen doch die harmonischen Eindrücke einer gelungenen Synthese von Mensch und Natur.
So können Die Wellen als Versuch charakterisiert werden, durch eine Sprache der Poesie jene flüchtigen Momente des Seins zu bannen, die allem begrifflich geprägten, bewussten Ausdruck vorgelagert sind: als ganz und gar Individuelles, Zufälliges, Nicht-Notwendiges, über das noch nicht verfügt ist. Man könnte von einer Wahrheit des Augenblicks sprechen, die sich der begrifflichen Fixierung zumindest zeitweise entzieht.
Beispielhaft für viele die folgende Passage, die auch wegen der Schönheit der Sprache besticht:
Die aufgegangen Sonne, die nun nicht länger auf einer grünen Matratze ruhte und den Blick unstet durch wässrige Juwelen schoß, entblößte ihr Gesicht und schaute geradeaus über die Wellen. Sie schlugen gleichmäßig dumpf auf den Strand. Sie schlugen mit dem Beben von Pferdehufen auf dem Rasen auf. Ihre Gischt erhob sich wie das Schwirren von Lanzen und Wurfspießen über den Köpfen von Reitern. Sie überschwemmen den Strand mit stahlblauem und diamantbesetztem Wasser. Sie rollen vor und zurück mit der Energie, der Muskelstärke einer Maschine, die ihre Kraft ausschwingt und wieder einholt. Die Sonne fiel auf Kornfelder und Wälder. Flüsse wurden blau und vielsträhnig, zum Wasserrand abfallende Rasenflächen schimmerten grün wie Vogelgefieder, das sich sanft aufplustert. Die gerundeten, gebändigten Hügel schienen mit Riemen festgezurrt, wie muskelumschnürte Gliedmaßen; und die Wälder, die stolz auf ihren Flanken sprossen, wirkten wie die kurzgeschorene Mähne auf einem Pferdehals.
Diese Stellen können als Ausdruck unverstellten Sehens gedeutet werden. Sie schildern Augenblicke des reinen Seins, der Vision, der Erleuchtung. So als würden Traumfetzen aneinander gereiht, denen keine unmittelbare Wirklichkeit entspricht. Gleichwohl wird in diesen Augenblicken etwas offenkundig, das trotz aller Flüchtigkeit ein Maß an Wirklichkeitsfülle und Lebenstiefe ergibt, das sich nur dem offenbart, der sich diesen Momenten ganz absichtslos hingibt.
Man spürt nahezu körperlich, dass Virginia Woolf nach einer literarischen Form sucht, die dieser Problematik adäquat ist; dass sie alle ihr zur Verfügung stehenden literarischen Möglichkeiten ausschöpft, um einem Dilemma zu entgehen. Wellershoff zitiert eine Passage aus den Tagebüchern von Virginia Woolf, in der sie sich die Frage stellt: Was mit Realität wohl gemeint sein könnte. Da heißt es:
Es scheint etwas sehr Erratisches, etwas sehr Unzuverlässiges zu sein – bald findet man es auf einer staubigen Landstraße, bald auf einem Fetzen Zeitungspapier am Straßenrand, bald als Narzisse in der Sonne. Es beleuchtet eine Gruppe von Menschen in einem Zimmer und prägt ein paar beiläufige Sätze. Es überwältigt einen, während man unter den Sternen nach Hause geht, und macht die stumme Welt wirklicher als die Welt der Sprache (…). Manchmal scheint sie auch in Formen zu wohnen, die uns zu fern sind, als dass wir erkennen könnten, welches ihre Natur ist. Aber was immer sie berührt, sie fixiert es und macht es dauerhaft. Das ist es, was übrigbleibt, wenn die Hülle des Tages in die Hecke geworfen worden ist; das ist es was von vergangenen Zeiten und unserem Lieben und Hassen übrigbleibt.
Wenn Virginia Woolf davon spricht, dass die stumme Welt wirklicher als die Welt der Sprache ist, so gilt dies nur, solange sie das reine Anschauen oder die Unmittelbarkeit der Dinge bezeichnet. Schon Hegel wusste: Der in die Geheimnisse Eingeweihte gelangt nicht nur zum Zweifel an dem Sein der sinnlichen Dinge, sondern zur Verzweiflung an ihm. Denn sobald man über den Status der sinnlichen Gewißheit nachdenkt, ist Sprache im Spiel und mit der begrifflichen Fixierung durch die Sprache verlieren die Dinge ihre singulären Eigenschaften, die sie der individuellen Zuschreibung verdanken. Sie werden gewissermaßen zum Allgemeingut, da die Sprache als intersubjektives Medium ihnen ihre Einmaligkeit nimmt.
Es lässt sich nun trefflich darüber spekulieren, ob es sich bei den sechs Protagonisten, die Viriginia Woolf in ihrem Roman auftreten lässt, um Wesenszüge oder Charaktermerkmale ein und derselben Person handelt oder ob ihnen eine je individuelle Existenz zukommt. Für beiden Lesarten gibt es Belege. Für die erste Deutung spricht die folgende Passage:
Die Wahrheit ist, dass ich nicht zu denen gehöre, die in einer einzigen Person ihre Befriedigung finden, oder in der Unendlichkeit. Das private Gemach langweilt mich, der Himmel ebenfalls. Mein Wesen glitzert erst dann, wenn alle Facetten vielen Menschen zugewandt sind. Sobald die ausbleiben, bin ich voller Löcher, schrumpfe zusammen wie verbranntes Papier.
An dieser Stelle wird darauf verwiesen: Der Mensch ist ein gesellschaftliches Wesen oder – wie Marx es in seinen Feuerbach-Thesen formuliert hat -:
Das menschliche Wesen ist kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Der Einzelne braucht die Gemeinschaft der Anderen: den Austausch mit ihnen; die Kommunikation. Das, was den Menschen ausmacht ist immer auch gesellschaftlich vermittelt: durch Erziehung, Bildung, Arbeit wird er erst zu dem, der er ist. Durch die Anderen erfährt er Bestätigung und Anerkennung.
Gleichwohl überwiegen am Ende des Romans die Zweifel – auch an dieser Deutung. Es spricht für die Größe Virginia Woolfs, das sie die existentielle Zerrissenheit, der ihre Figuren (und damit zweifellos auch sie selbst) ausgesetzt sind, nicht übertüncht. Sie hat ein deutliches Gespür dafür, dass die Traditionen und Konventionen, die einst ein gewisses Maß an kollektiver Identität verbürgten, in der modernen Gesellschaft der Auflösung anheimfallen.
In seinem überwiegend resignativen Räsonnement kommt Bernard – der wohl am ehestens als Sprachrohr Virginia Woolfs angesehen werden kann – zu folgender Schlussfolgerung:
Ich beginne jetzt zu vergessen; ich beginne, zu bezweifeln, die Wirklichkeit des Hier und Jetzt (…) Ich habe so viele verschiedene Dinge gesehen, habe so viele verschiedene Sätze gebildet (…). Und jetzt frage ich, >Wer bin ich? Bin ich ein einziger und unterschieden? Ich weiß es nicht (…) Es gibt keine Trennlinie zwischen mir und ihnen. Dieser Unterschied, von dem wir so viel hermachen, diese Identität, die wir so fieberhaft hüten, war überwunden.
Der Protagonist ist sich nicht mehr sicher, wer er ist. Ein Ich oder alle Ichs gleichzeitig. Die Gefährten von einst fungieren als Schatten von Menschen, die man hätte sein können; ungeborene Ichs. Das Individuum, das sich seiner unverwechselbaren Individualität sicher war, wird sich auf einmal gewahr als Glied einer Entwicklung, die die ganze Menschheit umfasst:
Da ist auch der alte Barbar, der Wilde, der Behaarte, der mit den Fingern in Stricken und Därmen wühlt; und frisst und rülpst; dessen Sprache kehlig ist ,aus den Eingeweiden kommt – ja, er ist hier. Er hockt in mir. (…) Er wäscht sich zwar die Hände vor dem Essen, dennoch sind sie behaart. Er knöpft sich in Hosen und Westen, aber sie enthalten dieselben Organe. Er knurrt, wenn ich ihn aufs Essen warten lasse. Er mault und murrt ständig, während er mit halbirren Gesten der Gier und Lust auf das zeigt, was er begehrt. Ich kann Ihnen versichern, es fällt mir oft sehr schwer, ihn zu bändigen. Dieser Mann, der behaarte, äffische, hat seinen Teil zu meinem Leben beigetragen.
Virginia Woolf hat auf der Suche nach der eigenen Identität das ganze Spektrum möglicher Selbstbespiegelungen ausgebreitet, um die Gewißheit zu haben, alle infrage kommenden Deutungsmöglichkeiten ausgelotet zu haben. Indem sie Facetten ihres Selbst auf andere Figuren verlagert, offenbaren sich Konturen der eigenen Individualität. Dabei bedient sie sich der Erzählform des selbstreflexiven, inneren Monologs ebenso wie der wechselseitigen Wahrnehmung der Personen untereinander, die sich ihrer gemeinsamen Lebensgeschichten bewusst sind:
Ich rief mir meine Freunde ins Gedächtnis (…). Unsere Freunde, wie selten aufgesucht, wie wenig gekannt – das stimmt; und doch, wenn ich einem Fremden begegne und versuche (…), das, was ich >mein Leben< nenne, loszulösen, ist es nicht ein einziges Leben, auf das ich zurückblicke; ich bin nicht eine Person; ich bin viele Menschen; ich weiß nicht genau, wer ich bin.
Die Suche nach der eigenen Identität mündet in Resignation. Oder wie Alain Ehrenberg es ausgedrückt hat: Die Angst davor, man selbst zu sein, wird zur Erschöpfung davon, man selbst zu sein.
Die Dinge haben ihre Eindeutigkeit eingebüßt. Selbst die Sprache erweist sich als unzulänglich. Es bedürfte einer Sprache, wie Liebende sie verwenden oder einsilbiger Wörter, wie Kinder sie sagen. Damit wäre alles gesagt, aber nichts ist damit gewonnen.
Ernüchtert stellt sie fest: Wieviel besser ist das Schweigen; die Kaffeetasse, der Tisch. Wieviel besser, allein zu sitzen wie der einsame Seevogel, der auf dem Pfahl seine Flügel öffnet. Laßt mich ewig hier sitzen mit nackten Dingen, dieser Kaffeetassse, diesem Messer, dieser Gabel, mit Dingen als Dingen, mir selbst als mir selbst.
Nach all den Mühen, den Schein der Dinge zu dechiffrieren, um der eigenen Selbsterkenntnis willen, überwiegt die Verzweiflung darüber, dass alles Bemühen letztlich vergeblich war. Ich, ich, ich, müde wie ich bin, erschöpft wie ich bin, und fast ausgelaugt nach all diesem Herumschnüffeln an der Oberfläche der Dinge (…), muß mich hier davonmachen.
Was als ständige Veränderung der Dinge erscheint, ist doch nur die Wiederkehr des ewig Gleichen. Wieder ein Tag; wieder ein Freitag; wieder ein zwanzigster März, Januar oder September. Wieder ein allgemeines Erwachen. Die Sterne ziehen sich zurück und verlöschen. Die Streifen zwischen den Wellen werden dunkler. Der Nebelschleier auf den Feldern verdichtet sich. Röte sammelt sich auf den Rosen (…) Ja, dies ist die ewige Erneuerung, das unaufhörliche Ansteigen und Verebben, Verebben und Wiederansteigen.
Und auch in mir steigt die Welle. Sie schwillt; sie krümmt ihren Rücken. (…) Welchen Feind sehen wir jetzt auf uns zukommen…? Es ist der Tod.
Wir wissen, dass Virginia Woolf vergeblich gegen den Tod anschrieb. Erschöpft von jahrelanger, intensivster literarischer Arbeit fehlte ihr zuletzt die Kraft, dem Tod zu trotzen. Am 28. März 1941 schrieb sie einen Abschiedsbrief an ihren Mann und bedankte sich für das Leben mit ihm.
Bildquelle: Wikipedia, Post of Romania, public domain