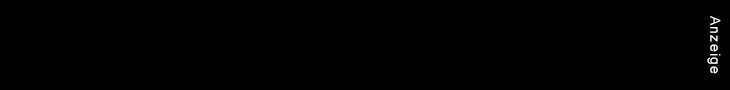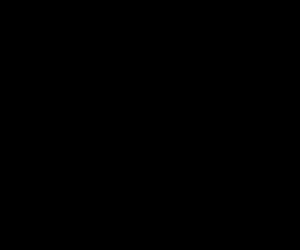Es könnte interessant sein, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie man von dem erzählen könnte, was einem an Erinnerungen im Gedächtnis ist? Diese Frage stellt sich auch einer der Protagonisten des Romans Perlmanns Schweigen von Pascal Mercier. In einem Beitrag zu einem Kolloquium von Sprachwissenschaftlern schreibt dieser: Ich werde darlegen, dass und in welchem Sinne wir dadurch, dass wir unsere Erinnerungen in Worte fassen, diese Erinnerungen und damit die eigene erlebte Vergangenheit allererst schaffen. Und etwas weiter heißt es: Ich arbeite an einem Text über den Zusammenhang von Sprache und Erinnerung. Zu selten wird in unserer Disziplin untersucht, wie Sprache mit den verschiedenen Formen des Erlebens verflochten ist. Und gerade das Erleben von Zeit ist diesbezüglich besonders stiefmütterlich behandelt worden. Das ist für einen Linguisten ein etwas unorthodoxes Thema. Zunächst wolle er zeigen, dass diejenige Art von artikuliertem Selbstbild, auf der unser Erinnern beruhe, nur durch sprachliche Konturierung, durch das Erzählen von Geschichten, zustande kommen könne. Denn der Einfluss, den die sprachliche Artikulation aufs Erinnern hat, ist ja eng verwandt mit dem sprachlichen Verfeinerungsprozess der Phantasie.
Erinnerungen sind wie ein Steinbruch, dem wir einzelne Elemente entnehmen, wobei wir tunlichst darauf achten, dass das Erinnerte das Selbstbild, das wir von uns haben, nicht beschädigt. Im Gegenteil. Zu vermuten ist, dass wir unsere Erinnerungen dazu benutzen, unser Selbstbild zu konturieren oder – wie es im Roman heißt – zu skulpieren. Im Unterschied zum Traum, der sich mehr oder weniger von der Wirklichkeit loslöst, sind Erinnerungen Teil des gelebten Lebens. Man erinnert sich über Gerüche, Gegenstände, Personen oder Situationen. Meist sind es aktuelle Anlässe, die Erinnerungen auslösen; Ereignisse, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben und die einem plötzlich wieder bewusst werden. Dabei steht uns die Vergangenheit nicht als ein Kontinuum zur Verfügung. Die Erinnerung verfährt stets selektiv. So wählt aus, was unser gegenwärtiges Interesse weckt. Es ist, als würde ein äußerer Reiz auf das Unbewusste einwirken und uns etwas wieder ins Bewusstsein rufen, an das wir schon gar nicht mehr gedacht haben. Aber ist das, was uns da wieder bewusst wird, dasselbe, was wir einst erlebt haben? Auch wenn wir noch so sehr davon überzeugt sind, etwas sei so gewesen, wie wir es erinnern, so können wir dessen nicht gewiss sein. Wir neigen dazu, Sperriges und Unangenehmes auszusparen; Gefühle von Scham und Schuld zu glätten. Vor allem aber: wir gehen mit unserem heutigen Verständnis an die Dinge heran und können sie nie mehr so sehen, wie wir sie vor langer Zeit gesehen haben. Wir haben zwischenzeitlich neue Erfahrungen gemacht. Man ist der gleiche Mensch wie damals und doch ein ganz anderer.
Gleichwohl ist die Vergangenheit wie ein Schatten, der uns ständig begleitet. Aber dieser verändert sich; je nach Perspektive wird er länger oder kürzer. Oft nehmen Erinnerungen die Form von Träumen an und dann wissen wir oft nicht mehr, was realer ist: der Traum oder die Erinnerung. Damit ist klar: die Erinnerung ist keine simple Wiederholung dessen, was wir schon einmal erlebt haben. Sie konstruiert das Vergangene stets neu; baut es um. Auf diese Weise überwindet der Mensch seine Gebundenheit an das Hier und Jetzt; indem er träumt, phantasiert, wünscht oder empfindet, überschreitet er seine konkrete Existenz. Er lebt zwar hier und jetzt; aber zugleich auf anderes hin. Er hat Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und gerade letztere zeichnet sich dadurch aus, dass sie noch offen ist; sie lässt sich noch gestalten.
Es fragt sich: Welche Bilder entstehen in einem, sobald wir uns erinnern? Und: Wie lassen sich scheinbar belanglose Alltagsgeschichten in möglichst spannende Erzählungen weiter entwickeln, umformen, ins Phantastische wenden? Könnte man daraus zusammenhängende Episoden konstruieren? Und worin besteht der Zusammenhang von Erinnern und Sprache? Nun gibt es zweifellos viele Episoden, an die wir uns erinnern, ohne dass wir sie in der Form einer Geschichte erzählen. Kann man daher trotzdem von einer Schlüsselrolle der Sprache im episodischen Gedächtnis sprechen? Die Erinnerung ein Neusehen der Vergangenheit im Hinblick auf Gegenwärtiges und Zukünftiges. Wer sich erinnert, verarbeitet ein Erlebtes, das noch nicht vollendet ist. Er holt etwas aus sich hervor, das irgendwo wie in einem abgesperrten Verlies verborgen war und beginnt, sich erneut damit zu befassen, jedoch auf eine neue, nie dagewesene Weise. Aber auf welche Weise geschieht dies? Unsere Gegenwartsempfindung verfügt über eine poröse Struktur und setzt sich aus unzähligen Details zusammen; wenn man so will, aus Haupt- und Nebensachen, aus all den Aktivitäten, die wir verrichten. Jeder Versuch, auch nur den vergangenen Tag als ein zusammenhängendes Ganzes zu schildern, würde sich zu einem unbeherrschbaren Unterfangen auswachsen. Viele Abläufe ließen sich gar nicht mehr erinnern; sie sind schlicht verschwunden – abgetaucht ins Unterbewusste; wir haben sie schlicht vergessen. Wäre dem nicht so und wir würden den ganzen Ballast an Erlebtem ständig mit uns herumschleppen – wir wären unfähig, uns zu einer sinnvollen Handlung aufzuraffen, da wir ständig damit beschäftigt wären, eine Struktur in unsere Lebensgewohnheiten zu bringen. Das alles erledigt die Arbeit unseres Gehirns, das uns das Vergessen und Verdrängen ermöglicht, indem es Wichtiges von Unwichtigem trennt.
Worauf es beim Schreiben ankommt ist: eine literarische Form zu finden, die dem Erlebten Rechnung trägt. Oder anders formuliert: wie lässt sich das Problem der Erzählbarkeit des Lebens lösen? Nach Auffassung des Protagonisten im Roman spielt sich dies wie folgt ab:
Beim Erzählen erinnerter Szenen handelt es sich um eine schlichte Schilderung auftauchender Bilder, um eine sprachliche Bestandsaufnahme eines festgefügten Materials, das durch seine eindeutig bestimmten Konturen die Logik der Erzählung diktiert. Das ist weder bei den objektiven Fixpunkten einer Szene so, noch bei den Facetten des hineingelesenen Selbstbilds. Erzählen der eigenen Vergangenheit, das ist jedes Mal von neuem ein Unternehmen, bei dem ganz andere Kräfte am Werk sind als die Absicht, Aufgezeichnetes in detailgetreuer Weise abzurufen. Da ist vor allem das Bedürfnis, aus der erinnerten Szene und der eigenen Anwesenheit in ihr ein sinnvolles Ganzes zu machen, und entsprechend wird mangelnder Sinn als Unvollständigkeit des Erinnerns gedeutet…Die stärkste Kraft im erzählenden Erinnern ist der Wunsch, das vergangene Selbst in seinem Tun zu verstehen. Aus diesem Wunsch heraus legt man sich die vergangenen Szenen so zurecht, dass die eigenen Handlungen und auch die Empfindungen als einsehbar und vernünftig erscheinen. Das heißt nicht, sie an einem abstrakten Katalog von Vernunftmerkmalen zu messen. Es heißt einfach dies: Die erzählte Vergangenheit muss aus der Sicht des jetzigen Erzählers nachvollziehbar sein. Der Erzähler wird nicht ruhen, bevor er sich in seinem vergangenen Selbst wiedererkennen kann. Und das bezieht sich nicht nur auf Fragen der Klugheit und Zweckmäßigkeit des damaligen Handelns, sondern vor allem auch auf seine moralischen Aspekte. Erzählendes Erinnern ist stets auch ein Rechtfertigen, ein Stück erfinderischer Apologie. So beruht die Fähigkeit zu erzählen und die Fähigkeit, sich eine eigene, ganz individuelle Vergangenheit zu schaffen, letztlich auf den sprachlichen Möglichkeiten des Erzählers. Auf diese Weise sind Sprache und erlebte Zeit sehr viel enger miteinander verknüpft, als man zunächst vermuten würde. Niemand hat das Wesen der Sprache verstanden, solange er sie nicht als Medium sieht, welches vor allem anderen eine differenzierte Erfahrung von Zeit ermöglicht.
Ein Schlüsselbegriff ist die Idee der Aneignung, die immer auch mit einem Akt des Verstehens einhergehen muss. Man eignet sich die eigene Vergangenheit an, indem man daraus einen Sinn macht. Das Verstehen, das durch das erzählerische Erinnern erreicht wird, bringt das entscheidende Gefühl der Zugehörigkeit zu einem selbst hervor. Sobald einem das vergangene Erleben fremd erscheint, handelt es sich offenbar um eine Lücke im Verstehen. Durch das erzählerische Erinnern bekommt eine Person allererst eine seelische Identität über die Zeit hinweg: Also: ohne Sprache keine seelische Identität.
Wie verhält sich nun aber die Idee der Aneignung zu der These, dass Erinnern in gewissem Sinne immer auch ein Erfinden ist? Aneignen setzt immer auch eine Struktur von erinnertem Erleben voraus, die es zu festigen gilt. Aber kann es diese Struktur überhaupt geben, wenn, wie der Verfasser meint, das vergangene Erleben durch das Erzählen erst geschaffen wird? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich noch einmal vergegenwärtigen, was mit dem Begriff der Aneignung gemeint ist: Im Prozess des erzählerischen Erinnerns bewältigt man einen Teil der eigenen Vergangenheit und bringt sie sich dadurch näher. Man könnte auch sagen: man macht sie sich zu eigen. Gleichwohl eignet man sich die eigene Vergangenheit nicht wie eine Sache oder ein Stück Wissen an. Aneignen der Vergangenheit heißt immer auch, sie anzuerkennen, zu ihr zu stehen, sie sich in gewisser Weise einzuverleiben. Auf diese Weise wird es dann auch möglich sein, sich mit ihr zu identifizieren oder anders gesagt: über die Aneignung der Vergangenheit eine eigene Identität zu entwickeln. Das aber wiederum setzt voraus, dass man die Erinnerung als sinnvoll, als Teil eines Ganzen, des eigenen Selbstbildes versteht, wobei die Ausdifferenzierung des die Erinnerung tragenden Selbstbildes nur durch Sprache möglich ist. Dabei kann das erzählerische Erinnern durchaus skrupellos verfahren, indem es das vergangene Erleben umschichtet oder umdeutet; vor allem wenn es darum geht, die moralische Integrität des Selbst zu verteidigen. Und wenn der Verfasser davon spricht, dass das Erzählen vergangener Episoden immer auch ein (Neu-) Erfinden ist, meint dies auch, dass der Erzähler sich seine individuelle Vergangenheit schafft; er schneidet sie auf bestimmte Weise auf sich zu.
Die Tatsache, dass man sich seine Vergangenheit durch erzählerisches Erinnern aneignet, beruht auf der Annahme, dass das Erinnern immer auch einen erfindenden, schöpferischen Charakter aufweist. Vor allem muss man sich klarmachen, dass das erzählende Selbst nichts anderes ist als die erzählten Geschichten. Außer den Geschichten gibt es da nichts. Oder besser: niemanden. Eine wahre Geschichte über die erlebte Vergangenheit gibt es nicht.
Bildquelle: pixabay, user johnhain, CC0 Creative Commons