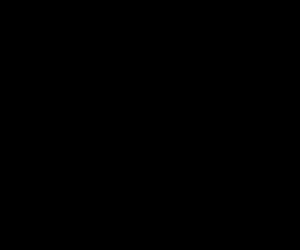Alexander Lukaschenko hat wählen lassen, Donald Trump will die Wahlen torpedieren. Verkehrte Welt? Nein. Die beiden Strategien mögen auf den ersten Blick unterschiedlich scheinen, sind sich aber ähnlicher als gedacht – und führen womöglich am Ende in die Niederlage.
Demokratie ist bekanntlich Herrschaft auf Zeit. Diese Lektion, die man heute googeln kann, haben viele beherzigt, auch wenn sie lange mitregieren durften. So wie Norbert Blüm, der im Jahre 2009, als er schon länger in Pension war, der Westfalenpost anvertraute: „Demokratie ist Herrschaft auf Zeit. Wir sind alle keine Heiligen, keine Helden, keine Götter. Wir sind Menschen, die aus einem Versuch, einem Irrtum lernen.” Auch sein Chef Helmut Kohl musste das lernen, als er 1998 nach langer Kanzlerschaft abgewählt wurde. Wie man einen Kanzler, einen Prime Minister, einen President oder wie der Staats- oder Regierungschef auch immer heißen mag, wieder los wird, ist eine noch wichtigere Frage als die, wie er oder sie ins Amt gekommen ist. Nur wenige dürfen bis an ihr Lebensende bleiben: der Papst zum Beispiel. Aber auch da haben wir eine Neuerung erleben dürfen, als Papst Benedikt XVI im Jahr 2013 zurücktrat.
Wozu Wahlen gut sind: Schmeißt die Schurken raus!
Doch einfach so wie der Papst auf’s Amt verzichten, ist nicht jedermanns Sache. Bekanntlich werden deshalb in Demokratien regelmäßig Wahlen abgehalten. Dann hat das Wahlvolk die Möglichkeit, die Schurken loszuwerden. „Throw the rascals out“, heißt die Devise. Das Problem dabei ist: Sind die Schurken wirklich Schurken, klammern sie sich an die Macht. Denn nach dem Rauswurf droht Ungemach: Verhaftung, ein Prozess, vielleicht ein Urteil, Haft oder Schlimmeres. Langjährige Machthaber tendieren dazu, korrupt zu sein. Und das lässt sich dann irgendwann nicht mehr verbergen. Eine korrupte Herrschaft schafft kein Gemeinwohl. Meist stopfen sich wenige die Taschen voll, die große Mehrheit geht leer aus. Dann bleibt den Menschen oft nur eins: Protestieren. Wie kürzlich im Libanon, nach der Verwüstung der Hauptstadt Beirut durch eine massive Explosion. Oder in anderen arabischen Ländern im so genannten „Arabischen Frühling“, der zum Sturz einiger Diktatoren führte, aber nicht unbedingt zur Demokratie. Oder jetzt in Weißrussland, nach der Wiederwahl des Präsidenten Alexander Grigorjewitsch Lukaschenko.
Schaut man auf Belarus und Herrn Lukaschenko, stellt sich unweigerlich die Frage: Warum ließ der Herr überhaupt wählen, wo ihm doch klar war, dass er die Macht unter keinen Umständen abgeben wollte? Ein erster Versuch einer Antwort: Es tut einfach gut, auch wenn man als Autokrat regiert, wenn man von seinem Volk mit Mehrheit gewählt wird. Auch in Fassadendemokratien, so könnte man sagen, brauchen Machthaber einen Anschein von Legitimität. Das macht sich gut, nach innen wie nach außen. Ein Grund für Autokraten, sich auf Wahlen einzulassen. Dann gibt es einen scheinbar noch zwingenderen Grund: die Verfassung sieht Wahlen vor. Auch eine Scheindemokratie kommt heutzutage nicht ohne Verfassung aus. Und die von Belarus sieht in Artikel 81 vor, dass der Präsident direkt vom Volk für einen fünfjährige Amtszeit gewählt wird, und zwar in allgemeinen, freien, gleichen und geheimen Wahlen.[Geht es nach dem Buchstaben der Verfassung, dann ist mit der Wahl tatsächlich das Risiko verbunden, abgewählt zu werden, also sein Amt zu verlieren. Das sind keine schönen Aussichten für einen Autokraten. Der möchte aus den schon genannten Gründen lieber im Amt bleiben oder zumindest seinen Nachfolger bestimmen. Geht es nach der Verfassung, ist auch ein Autokrat gezwungen, das Risiko eines Amtsverlusts einzugehen. Man kann das Risiko minimieren, indem man der Opposition den Zugang zu den Medien versperrt, Demonstrationen verhindert, ihre Kandidaten mitfadenscheiniger Begründung verhaftet. Aber ein gewisses Risiko bleibt, auch wenn die Wahl keine Zitterpartie wird.
Daher mein letzter Vorschlag, warum Autokraten wählen lassen: Mit Hilfe einer Wahl lässt sich wunderbar ermitteln, wer die politischen Gegner sind. Sie trauen sich aus der Deckung, ihre Anhänger schöpfen Hoffnung, und alles, was die Staatsmacht vor und nach der Wahl tun muss, ist, die Gegner mundtot zu machen. Anders als in einer Diktatur, wo die Opposition nur im Untergrund agieren kann, lässt ein moderner Autokrat seine Gegner offen antreten, um sie danach umso besser in den Griff zu bekommen. „Lasst hundert Blumen blühen“, hatte Mao im Jahr 1956 gefordert, und zur Kritik an der Regierung eingeladen. Ob Mao wirklich eine „gesittete, konstruktive, intellektuell-akademische Systemdiskussion“ wollte, wie man bei Wikipedia nachlesen kann, darf bezweifelt werden. Auf jeden Fall landeten viele Kritiker im Arbeitslager. Ähnlich repressiv scheinen Autokraten zu verfahren, denn Wahlen sind ja eine Einladung zur Kritik an ihrer Politik. Wer sich nicht mundtot machen lässt, landet im Gefängnis. Die Gegner hinter Gittern zu wissen, wo man selbst nicht landen möchte: dafür lohnt sich das Risiko, eine Wahl abzuhalten. Ohne Repression gibt es für einen Autokraten keinen Machterhalt, also kann man auch Wahlen dafür als Anlass benutzen. Was kann schon schiefgehen?
Wahlen nur zum Schein?
Wahlen nur so zum Schein? Das waren wir bislang nur aus Ländern gewohnt, in denen die Demokratie noch nicht fest verankert ist, also aus demokratischen Schwellenländern. Wo lange autokratisch regiert wurde, fehlt den Bürgerinnen und Bürgern oftmals noch das Gefühl, dass es eigentlich selbstverständlich ist, mitreden zu dürfen, zumindest bei Wahlen. Aus leidvoller deutscher Geschichte wissen wir, dass eine Demokratie ohne Demokraten scheitern kann, wenn die Verfassung nicht in den Köpfen der Menschen verankert ist. Natürlich nicht Wort für Wort, aber mit den darin gewährten Freiheits- und Mitwirkungsrechten. Wenn die Verfassung Teil der „politischen Kultur“ geworden ist, könnte man sagen. Auch wenn politische Kultur ein schwammiger Begriff ist, sie einem Pudding gleicht, den man an die Wand zu nageln versucht. Doch auf die politische Kultur, die kognitive und affektive Verankerung der Verfassung in den Köpfen der Menschen, kommt es an.
Inzwischen geht es nicht mehr nur um demokratische Schwellenländer, wenn Wahlen als ein Risiko betrachtet werden, das es zu minimieren gilt. Der berühmteste Fall ist derzeit die USA. Vor ein paar Jahren wäre noch ausgelacht worden, wer behauptet hätte, die USA seien vor Autokratie nicht gefeit. Wer Belarus und die USA in einem Atemzug genannt hätte, hätte Spott geerntet. Das politische System der USA galt zwar nicht als besonders effizient, aber als robust. Das System der Gewaltenteilung zwischen Exekutive (Präsident), Legislative (Kongress) und Judikative (Supreme Court), „Checks and Balances“ genannt, gehörte zum Allgemeinwissen auch von Schulkindern hier in Deutschland. Doch das altehrwürdige System leidet an einem großen Mangel: einer Spannung zwischen demokratischer politischer Kultur und einer Verfassung, die im Jahr 1787 fertig gestellt wurde. Diese Verfassung ist nicht demokratisch, so urteilte der Urvater der Demokratietheorie in den USA, der Politikwissenschaftler Robert A. Dahl. In seinem 2001 erschienenen Buch „How Democratic is the American Constitution?“ nennt Dahl die Demokratiedefizite der Verfassung beim Namen, vor allem die mangelnde politische Gleichheit der amerikanischen Bürgerinnen und Bürger. Zwar habe es eine demokratische Revolution im Lande gegeben, wenn man auf die Erweiterung des ursprünglich nur weißen, besitzenden Männern zustehenden Wahlrechts auf weitere Bevölkerungsgruppen anschaue. Aber an Gleichheit mangele es immer noch, wenn man die Repräsentation im Senat in den Blick nehme, wo ein großer Staat wie Kalifornien zwei Senatoren stelle, ein kleiner wie Maine aber auch.
Die Amerikaner stehen sich selbst im Weg, wenn es um eine demokratischere Verfassung geht. Denn es gibt, so Dahl, eine kaum aufzulösende Spannung zwischen der Verehrung der Verfassung und den demokratischen Überzeugungen der Bürgerinnen und Bürger. Beide gelten als legitim, die Verfassung als Dokument des sehr begrenzten Vertrauens der Verfassungsväter in die Mitwirkungsrechte des Volkes und die Demokratie, zu deren Grundsätzen es gehört, dass die Bürgerinnen und Bürger die politische Führung auswählen und, wenn nötig, die Schurken aus dem Amt jagen können. Die politische Mitwirkung in Wahlen ist fest verankert in der politischen Kultur des Landes, die Institutionen, die den Wählerwillen nur unvollkommen in politische Repräsentation umsetzen, aber auch.
Die Autokratische Versuchung
Dieses Dilemma führt nicht geradewegs in die autokratische Versuchung, die die Präsidentschaft Donald Trumps darstellt, aber in Kombination mit anderen Faktoren wie politischer Polarisierung, Zersplitterung der veröffentlichten Meinung in „Echokammern“, wo man die passenden Fakten zu seinen Überzeugungen geliefert bekommt, massiver wirtschaftlicher Ungleichheit, ja, und Rassismus, hat dieses Dilemma zur Machtübernahme eines Autokraten geführt, der nun um seine Wiederwahl fürchtet.
Zwei Lager haben sich gebildet: Die einen, in der Regel weiß, auf seltsame Weise religiös, zumeist wohlhabend, klammern sich ängstlich an die alte, in der Verfassung vorgegebene Ordnung. Sie werden zur Minderheit im eigenen Land, hat man ihnen prophezeit, und nun fürchten sie, dass „ihr Amerika“ den Bach runtergeht. Die ungleiche Repräsentation im Senat sichert die Herrschaft dieser Minderheit, ebenso ein konservativer Supreme Court, aber das reicht ihnen nicht. Deshalb haben sie Trump gewählt, weil sie in ihm ein Werkzeug für die Umsetzung ihrer Wünsche sehen. Sie sehen in ihm einen Präsidenten, der die Grenzen dichtmacht, die Soldaten hach Hause holt, den Rest der Welt sich selbst überlässt und den delinquenten Verbündeten vors Schienbein tritt. Ein Autokrat, der sündig, vulgär und charakterlos sein mag, aber der das Ausbluten Amerikas beendet und den Gulliver Amerika von seinen Fesseln befreit.
Die anderen, das progressive Lager, sind frustriert ob des langen Kampfes um mehr soziale Gerechtigkeit, um ein besseres Amerika, das die Kluft zwischen der Lebenswirklichkeit der Vielen und den bei der Gründung des Landes verkündeten Idealen Stück um Stück verringert. Auch sie spielen mit dem Gedanken, dass ein Präsident viel Gutes tun könnte, auch wenn die Unterstützung dafür im Kongress fehlt: „Using Presidential Power for Good“ lautete das Schwerpunktthema der im linken Spektrum zu verortenden Zeitschrift „The American Prospect“ im Herbst 2019. Die Verfassung auf Bundesebene macht den Progressiven das Leben schwer, also haben sie sich auf die Einzelstaaten konzentriert und versuchen, die Verfassung auf Umwegen zu ändern. Ein Stolperstein auf dem Weg zu einer Mehrheitsherrschaft ist das so genannte „Electoral College“, das die Verfassungsväter geschaffen hatten, um die Wahl des Präsidenten vor allzu viel Volkswillen abzuschirmen. Das könnte man umgehen, wenn die einzelnen Staaten beschließen, dass ihre Elektoren ihre Stimme dem Kandidaten geben, der die Mehrheit landesweit bekommt. Der Frust darüber, dass die Wünsche der Mehrheit sich nicht in der Politik des Landes widerspiegeln, hat auch auf dieser Seite des politischen Spektrums zu mehr Radikalität geführt. Radikalität, die im Vergleich zu der der Rechten, bislang eher verpufft ist.
Die Präsidentschaft Trumps ist in vielerlei Hinsicht ein Produkt eines Regierungssystems, das es ermöglicht, dass eine Minderheit das ganze Land mithilfe des Präsidenten in Geiselhaft nimmt, während die Gegner, zwar in der Mehrheit, aber ohnmächtig sind, ihm das Handwerk zu legen. Mit geballter Faust in der Tasche und Wut im Bauch müssen sie nun mitansehen, wie Trump Zweifel an der Legitimität der Wahl säht und sie praktisch behindert, um nicht in die Fußstapfen anderer Autokraten zu treten, die nach der Abwahl im Gefängnis landeten.
Weißrussland als Vorbild für die USA?
Ermutigung kommt erstaunlicherweise aus einem Land wie Weißrussland, wo die Menschen es leid sind, bei der Auswahl der politischen Führung ihres Landes nicht mitreden zu dürfen. Wie es scheint, hat ihr Präsident sich verkalkuliert, als er Wahlen zuließ. Und auch ohne eine lange politische Kultur und Tradition des Wählens fordern die Bürgerinnen und Bürger nun ein, was in Demokratien, auch der amerikanischen, selbstverständlich ist: Geht wählen und „Schmeißt die Schurken raus!“
Ich gehöre zu den Optimisten, die daran glauben, dass die Tage Lukaschenkos im Amt des Präsidenten gezählt sind, weil die Menschen im Lande die Verfassung ernst nehmen wollen und das Recht zu wählen Teil der politischen Kultur geworden ist. Auf die darf man auch in den USA bauen: Das Recht zu Wählen gehört zum innersten Kern der politischen Kultur des Landes, auch wenn viele von diesem Recht keinen Gebrauch machen. Der Präsident wird durch Wahlen ermittelt, wie unvollkommen aus demokratischer Perspektive das Verfahren auch immer sein mag. Und mit ihm werden viele weitere Ämter durch Wahlen besetzt auf der Bundes-, Landes- und Kommunalebene. „Viele Wahlen, wenige Wähler“, konnte man bislang sagen.
Ermutigend ist, dass man schon jetzt die Alarmglocken rührt, um den Präsidenten daran zu hindern, das Wahlergebnis zu seinen Gunsten zu manipulieren. Denn er lässt nichts unversucht: Erst säht er Zweifel, dass der Wahltermin überhaupt einzuhalten ist, dann versucht er nach Kräften die Briefwahl zu verhindern, weil die stärker von Menschen in Anspruch genommen wird, die eine Infektion mit dem Corona-Virus befürchten müssen. Es gibt viele Schrauben, an denen man drehen kann, wenn man in den USA eine Wahl scheitern lassen will. Auch wenn Wahlen tief in der politischen Kultur verankert sind: das System ist kompliziert und fehleranfällig. Deshalb scheint Trump nun auf eine Alternative zu sinnen, die ihm die Widerwahl sichern könnte: Eine Wahl nach einem besonders undemokratischen Verfahren im Repräsentantenhaus.
Der jüngsten Umfrage des Pew-Instituts kann man entnehmen, dass 83 Prozent der registrierten Wähler glauben, dass es einen Unterschied macht, wer die Wahl gewinnt. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden mag zwar die Nase vorn haben, aber Trumps Unterstützung ist solider: 66 Prozent seiner Unterstützer sind mit Begeisterung und Entschlossenheit dabei, bei Joe Biden sind es nur 46 Prozent. Hoffen wir, dass Trumps Gegner in ihrer Entschiedenheit noch aufholen und die ihnen in den Weg gelegten Hindernisse überwinden. Sonst dürfen wir mit Szenen rechnen, wie wir sie jetzt in Belarus beobachten können. „Ballots“ statt „Bullets“ – diese Formulierung fand ich einst in einem der Lehrbücher über das amerikanische Politische System. Stimmzettel statt Kugeln, Wählen statt Bürgerkrieg. Hoffentlich kriegen die Amerikanerinnen und Amerikaner das in diesem Jahr noch hin.
Bildquelle: Wikipedia, Ben P L from Provo, USA / CC BY-SA