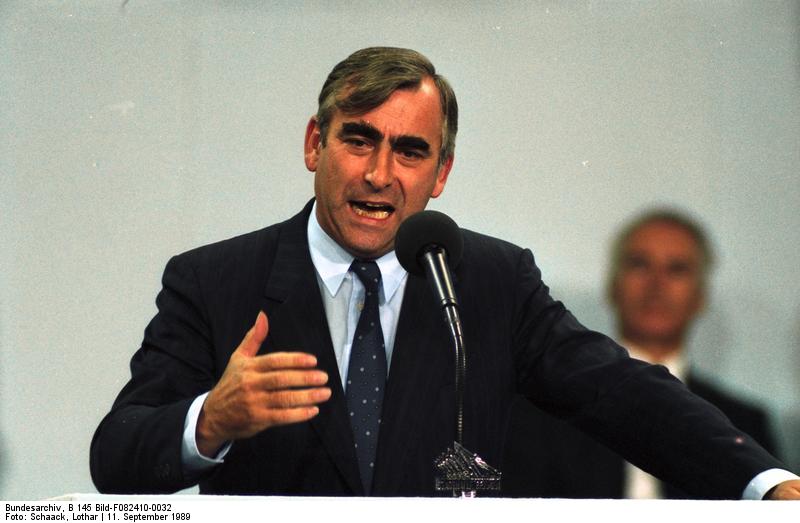Der amerikanische Schriftsteller Walker Percy (1916 – 1990) war uns lange Zeit gänzlich unbekannt, bis wir auf einen Hinweis von Juli Zeh stießen, die ihn als einen ihrer Lieblingsautoren bezeichnete. Das weckte unsere Aufmerksamkeit. Für seinen Erstlings-Roman The Moviegoer ( ins Deutsche übersetzt von Peter Handke) erhielt er 1962 den National Book Award. Auch den hier vorgestellten Roman Der Idiot des Südens, den Percy 1966 schrieb,hat Handke übersetzt.
Percy hat in seinen Romanen den inneren Zustand der USA schon früh überaus kritisch, aber auch ironisch, dargestellt. In Liebe in Ruinen aus dem Jahre 1971heißt es beispielsweise: Unsere geliebten alten USA sind in einem schlimmen Zustand. Amerikaner haben gegeneinander den Arm erhoben; Rasse gegen Rasse, Rechts gegen Links, Gläubige gegen Heiden, San Franzisko gegen Los Angeles, Chicago gegen Cicero. Ranken sprießen in Teilen von New York, wo nicht einmal Neger leben wollen. Wölfe sind im Zentrum von Cleveland beobachtet worden wie in Rom während des Schwarzen Todes. Einige Südstaaten haben diplomatische Beziehungen zu Rhodesien aufgenommen (einem Staat, in dem die Rassentrennung Staatsdoktrin war, Anm. d. V.); Minnesota und Oregon haben eigenen Konsulate in Schweden (wo so viele Deserteure aus diesen Staaten leben). Gemeint sind die jungen Männer, die sich der Einberufung zum Vietnam-Krieg entzogen haben.
William Barrett ist der Protagonist seines Romans Der Idiot des Südens. Er ist der vorläufig letzte Spross einer Südstaaten-Familie, von der es heißt, sie sei ehrbar und zugleich unbändig gewesen; aber die Unbändigkeit hatte sich mehr und mehr nach innen gekehrt. Und weiter heißt es von ihr: Die Familie hatte sich im Lauf der Zeit der Ironie zugewendet und die Fähigkeit zu handeln verloren.
Vom Urgroßvater wird berichtet, er habe noch unterscheiden können; seine Sprache und seine Handlungen gehorchten diesem Maß, und er scherte sich nicht darum, was ein andrer darüber dachte. Auch der Großvater hat noch unterscheiden können, war sich aber in Wirklichkeit nicht so sicher. Er war tapfer und grübelte zugleich viel, wie er tapfer sein könnte. Letzteres wird auch vom Vater gesagt, der vor allem darauf aus war, als ehrenvoll zu gelten und ein angesehener Mensch zu sein. So strengte ihn das Leben an, und er wurde zum Ironiker…Schließlich starb er an seiner eigenen Ironie und Traurigkeit, sowie an der Anstrengung, einen gewöhnlichen Tag in einem vollkommenen Tanz von Ehrbarkeit zu durchleben.
Wie lassen sich diese Verhaltens- und Wahrnehmungsveränderungen in der Generationenfolge deuten? Dass der Urgroßvater noch unterscheiden konnte, dürfte daran liegen, dass die traditionelle Wertehierarchie zu seiner Zeit noch intakt war: die gesellschaftlichen Verhältnisse waren klar strukturiert; etwa zwischen den Klassen und den Rassen; in den Geschlechterbeziehungen; innerhalb der Familie. Autoritäten galten noch etwas; die Religion hatte ihren Stellenwert. Alles war gewissermaßen an seinem Platz. Schon vom Großvater heißt es, er war sich der Wirklichkeit nicht so sicher. Zu vermuten ist, dass die ehemals stabilen gesellschaftlichen und moralischen Differenzierungskriterien sich bereits in Auflösung befanden; der Hang zum Grübeln könnte darauf hindeuten, dass Zweifel und Unsicherheiten die Oberhand gewannen. Beim Vater scheint dann der Konformitätsaspekt zu dominieren; er möchte als ehrenvoll und angesehen gelten. Aber da die alten gesellschaftlichen Wertmaßstäbe nicht mehr gelten, wird es schwierig, sich zu orientieren; er flüchtet sich in die Ironie und Traurigkeit und die Anstrengung, nach Anerkennung zu streben und sich anzupassen, wird auf Dauer zu groß; er stirbt daran.
William selbst lebt ziel- und orientierungslos dahin: er wusste nicht, wie er leben sollte. Man könnte auch fragen: woran sollte er sich halten, wenn doch alles sich ins Ungefähre aufgelöst hatte? So scheint die Flucht in eine Scheinwelt unvermeidlich: Als Kind waren ihm >Verzauberungen< zugestoßen, namenlose Ereignisse, die nicht bedacht, geschweige denn ausgesprochen werden konnten. Eine dieser Verzauberungen besteht in sog. Déjà-vu-Erlebnissen; einer Art Erinnerungstäuschung, bei der er das Gefühl hat, ein gegenwärtig Erlebtes in gleicher Weise schon einmal erlebt zu haben; oder ihn überfiel die übermächtige Empfindung, dass etwas sich schon längst ereignet hätte, und dass etwas andres bevorstünde: und wenn es einträfe, dann wüsste er um das Geheimnis des eigenen Lebens. Hinzu kommt: er leidet an gelegentlichen Gedächtnislücken; er war nicht im Gleichgewicht…und war auch sonst oft nicht ganz fähig, zu unterscheiden…Er glitt weg in Untätigkeit und Alleinsein. Er streifte umher. Und dann wieder durchlebt er Phasen, in der er war wie alle Welt. Er konnte so sachlich sein und so kühl wie ein Wissenschaftler, las Bücher über geistige Gesundheit und glaubte nach der Lektüre ein paar Minuten lang eine klare Einsicht gewonnen zu haben…er war informiert über die rechte Weise, zu emotionalen Befriedigungen zu kommen – etwa mit Hilfe der Künste…Darüber hinaus hatte er begriffen, dass es die Menschen sind, die zählen; die Beziehungen mit Menschen, die Wärme und Verständnis für sie. In solchen Perioden setzte er es sich zum Ziel (welches er auch oft erreichte), >lohnende interpersonale Partnerschaften mit wechselnden Individuen zu kultivieren< – um einen unvergesslichen Ausdruck zu verwenden, auf den er einmal gestoßen war.
Wie seine männlichen Vorfahren besucht er die Princeton Universität; er ist ein guter Student; wird Mitglied eines angesehenen Klubs und sogar des Boxteams; gleichwohl aber nimmt er – im Unterschied zu seinen Vorfahren – Reißaus. Das geschah folgendermaßen: An einem schönen Herbstnachmittag in seinem dritten Jahr, als er in seinem Schlafraum saß, wurde er angefallen von bestürzenden déjà vus. Eine unermessliche Schwermut überwältigte ihn. Er wußte, dass er sich in genau dem Lebensabschnitt befand, wo er am aufnahmefähigsten sein sollte, in einer Zeit der Suche und zugleich des festen Auftretens; der Vollkraft und der Pracht der Jugend. Doch wie trist erschien ihm diese Tatsache; ein Universitätsjüngling zu sein, einer aus einer langen Folge von Geschlechtern, welche allesamt dieselben alten Gebäude bewohnten, und mit denselben Pförtnern herumzualbern wie der Jahrgang von 1937. Er beneidete die Pförtner. Wieviel schöner wäre es doch, ein Pförtner zu sein, am Abend heimzugehen zu einer gemütlichen Hütte neben den Eisenbahngleisen, und einen kleinen Schluck zu nehmen mit seiner Alt-Angetrauten – anstatt froh-steif, feierlich, hier in diesen geheiligten Buden herumzusitzen.
Es ist dieses ambivalente Verhältnis zur Normalität, ja zur Wirklichkeit selbst, das dem Protagonisten zusetzt und ihn zu panischen Handlungen verleitet. Einerseits leidet er an der Normalität mit ihren Verhaltensanforderungen; und dann wieder sehnt er sich nach einem einfachen, überschaubaren, normalen Alltagsleben, wie dem eines Pförtners, wohl ahnend, dass er ein solches Leben nicht lange aushalten würde. Spätestens mit einem erneuten Déjà-vu-Erlebnis wäre der Traum von einem harmonischen Zusammenleben dahin. Er würde wieder das Gefühl haben, alles wiederhole sich ständig nur; sei schon einmal dagewesen; sei schon viele Male durchlebt worden.
Schon als Kind hatte er einmal ein Feriencamp Hals über Kopf verlassen, weil er es dort nicht mehr aushielt. Und an dieser Stelle erfährt man auch warum: Der Grund seiner Schwierigkeiten waren die Gruppen. Obwohl er so umgänglich und gewinnend war, wie man es sich nur wünschen konnte, fiel es ihm schwer, zu tun, was die Gruppe von ihm erwartete. Zunächst erfolgreich, passte er doch auf die Dauer in keine Gruppe – und das war etwas Ernstes. Sein Arzt redete eingehend über die Gruppe: was denn seine Rolle darin sei? Und genau das war die Schwierigkeit: entweder verschwand er in der Gruppe, oder er kehrte ihr den Rücken.
William ist dem Anpassungsdruck, der von einer Gruppe ausgeht, nicht gewachsen oder zumindest will er sich dem nicht fügen. Das hat damit zu tun, dass er sich in einer Phase seines Lebens befindet, in der er noch auf der Suche ist. Die Frage des Arztes nach seiner Rolle in der Gruppe deutet sein Problem an: er hat seine eigene Rolle weder in der Gruppe, noch im Leben, bisher gefunden. Was ist nur mit mir?, fragt er sich. Seine Selbstzweifel rühren daher, dass allen anderen die Anpassung an die Gruppengepflogenheiten zu gelingen scheint: seine Mitstudenten fanden ein gewisses Wohlgefallen an sich selber; sie hatten eine entsprechende Sprechweise angenommen; auch eine eigene Manier, die Hände in die Taschen zu stecken und das Kinn in einen bestimmten Winkel zum Kehlkopf zu bringen. Sie waren dabei nette Burschen – wenn man sich einmal an eine karge Nordstaaten-Freundlichkeit gewöhnt hatte.
William wird bewusst, dass er während seines Studiums am gleichen Pult sitzt, an dem schon sein Großvater gesessen hatte. Diese Erinnerung scheint ihn zu beunruhigen. Dann versuchte der junge Mann aus dem Süden, der immer noch an seinem Pult saß, sich zu erheben; doch seine Gliedmaßen waren befallen von einer seltsamen Trägheit, und er bewegte sich faultierhaft: nur so bewahrte er sich davor, zu Boden zu stürzen…Endlich – und wider den eigenen Willen – brachte er ein lautes Stöhnen hervor, welches ihn erschreckte und seine Klassen-Genossen für den Augenblick verstummen ließ. Er betrachtete seine Augen im Spiegel und murmelte: >Das ist kein Ort für mich – nicht für die nächste halbe Stunde, geschweige denn für zwei Jahre<. Kaum eine Stunde später saß er in einem Bus, beschwingt wie eine Lerche, auf dem Weg nach New York, wo er dann recht zufrieden in seiner Y.M.C.A.-Unterkunft lebte.
Wieder zeigt sich das gleiche Verhaltensmuster: sobald William spürt, dass er drauf und dran ist, sich an irgendeine Form der Normalität zu gewöhnen, erfasst ihn Panik: er will nicht so werden, wie die anderen, weiß aber auch nicht, wie er sein Leben gestalten soll. Schließlich – nach einigen Umwegen – lässt er sich in New York zum Wartungstechniker ausbilden. Er findet problemlos ein Stelle, weil er bereit ist, Nachtschichten zu machen. Jetzt ist er eine Art Pförtner, sitzt in einem winzigen Raum an einem Prüfpult und vergewissert sich von Zeit zu Zeit, ob die elektrischen Schaltungen ordentlich arbeiten. Seine Arbeitszeit ging von Mitternacht bis acht Uhr früh, eine Schicht, die niemand sonst wollte. Aber ihm war das recht so. Nicht nur, dass er viel Zeit zum Lesen und Nachdenken hatte: die Stelle bot auch große Vorteile, was medizinische Versorgung und Pensionierung betraf. Er konnte sich nach dem Ablauf von dreiundzwanzig Jahren pensionieren lassen und heimkehren…
Natürlich überkommt ihn auch jetzt nach einer gewissen Zeit eine lastende Schwermut und ein Leergefühl. Er nimmt sich einen Psychiater, den er fünf Jahre lang fünfmal die Woche besucht. Seine Schwierigkeit, das waren immer noch die Gruppen. Nach mehreren Jahren der Analyse und der Gruppentherapie war er da allerdings um einiges wendiger geworden. Er richtete sich so sehr nach seinen augenblicklichen Gruppengenossen aus und wurde so gewitzt im Rollenspiel (wie die Sozialwissenschaftler das nennen), dass er geradezu in der Gruppe verschwand. Wie jedermann weiß, ist New York bekannt für die Vielzahl der verschiedenen Gruppen, zu denen man gehören kann, so dass zuzeiten sogar ein Normalmensch nicht mehr weiß, wo sein Platz ist. Folglich wechselte der junge Mann, der ohnedies schon nicht mehr wusste, wo sein Platz war, von Tag zu Tag sein Gesicht. Zwischendurch war sein Rollenspiel so vollkommen, dass er aufhörte, der zu sein, der er war, und jemand anderer wurde.
Die therapeutischen Maßnahmen, die sein Psychiater ihm vorschlägt, können nicht dazu beitragen, dass William eine eigene Identität ausbildet. Er passt sich an bis zur Selbstaufgabe, lernt gewisse Sozialtechniken, aber findet nicht zu sich selbst. Als er bei einer dieser Maßnahmen mit seinen Gruppengenossen in einer Skihütte am Feuer sitzt, da spürte der Mann aus dem Süden einen so vertrauten wie fürchterlichen Schmerz in der Brust. Die kleine Szenerie, die in jeder Hinsicht erfreulich war und die jeder Normalmensch nach seinem Geschmack gefunden hätte, wurde ihm unversehens verhaßt…Unwillkürlich begann sein Knie zu zucken, und bei der ersten Gelegenheit entzog er sich und stürzte aus der Hütte. Draußen rannte er durch die verschneiten Wälder und warf sich in ein Dorngestrüpp, wie die Heiligen früherer Zeiten.
Wieder beginnt der Kreislauf aus Widerstand gegen jede Form von Normalität und Selbstzweifel. Stimmt es denn nicht, dass die Amerikanische Revolution ein Erfolg ist…, so dass buchstäblich jedermann in den Vereinigten Staaten die Freiheit hat, in Schihosen rund um ein heimeliges Feuer zu sitzen? Ist denn etwas falsch daran? Was fehlt dir eigentlich, armer Kerl?
Man fragt sich, worin Williams Abneigung gegen ein Leben, wie alle anderen es führen, ihren Grund hat; ist es seine Südstaaten-Mentalität, die ihn die Lebensgewohnheiten des Nordens ablehnen lässt? Es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden: klar ist jedenfalls, dass ihm die geforderten Anpassungsleistungen nicht gelingen. Nur dann, wenn er unter seinesgleichen ist, scheint er aufzuleben und Anflüge von Wohlbefinden zu spüren. Manchmal, bei einem Zusammentreffen mit seinen Landsleuten aus dem Süden, nahm er von einem Augenblick zum anderen die liebenswürdige und leicht ironische Art an, welche die Umgangsform des Südstaatler ist, wenn sie von zuhause weg sind. Dann scheint es ihm zu gelingen, wenigstens zeitweise so etwas wie eine eigene Identität zu finden. Aber sobald er wieder allein ist, verfällt er in die alte Schwermut: es gelingt ihm nicht, im normalen Leben Fuß zu fassen. Im Gegenteil: sein Zustand scheint sich, allen Bemühungen seines Psychiaters zum Trotz, zu verschlimmern: Er entdeckte jetzt ein zusätzliches, sehr beunruhigendes Symptom. Er fing an, die Dinge als verkehrte Welt zu erleben. Es ging ihm schlecht, wenn andere Leute sich wohl fühlten, und gut, wenn sie sich schlecht fühlten. Zum Beispiel ein üblicher Tag in New York: die Sonne scheint, die Leute leben auf, sind unterwegs, ihre Bedürfnisse zu stillen und ihre Ziele zu erreichen, arbeiten in einem Beruf, der sie erfüllt, besuchen kulturelle Veranstaltungen, nehmen teil an fruchtbaren Gruppierungen – wie es, dem Kalkül nach, auch wünschenswert wäre. Doch gerade an solch einem Tag, an einem üblichen Mittwoch oder Donnerstag, kam es, dass er in sich die tiefste Bangigkeit spürte. Und als sein Arzt, um ihn aufzurichten, meinte, in diesen unsicheren Zeiten habe ein Mensch Grund zu solch einem Gefühl (>nur die Unempfindlichen<, usw.), da ging es ihm schlechter als je zuvor. Der Analytiker hatte alles missverstanden: nicht die Aussicht des Weltuntergangs bedrückte ihn, sondern eher die Aussicht, einen üblichen Mittwochmorgen vor sich zu haben.
Die Therapie, der William sich aussetzt, ist darauf gerichtet, ihn mit einer Wirklichkeit zu versöhnen, die die Ursache seiner Leiden ist. Den Grund sucht sie folglich in seinem (Fehl-)Verhalten und nicht in der Umwelt, die ihn krankmacht. Sie fordert Anpassungsleistungen von ihm, die er nicht zu bringen bereit ist. Zwar verfügt er über kein eigenes Lebenskonzept; aber er scheint zu spüren, was ihm nicht bekommt: das normale Leben, wie alle anderen es führen. Oder wenigstens die meisten von ihnen, denn immerhin scheinen die Sensibleren ebenfalls ihren Psychiater zu benötigen, wie man überhaupt den Eindruck gewinnt, dass die meisten Angehörigen der Mittelschicht sich in psychiatrischer Behandlung befinden; und das scheinbar jahrelang. Dabei ist es kein Wunder, dass sich der Zustand der Patienten kaum ändert: man bringt ihnen gewisse Sozialtechniken bei, mit ihrem Leben zurechtzukommen; die gesellschaftlichen Zustände bleiben indes, wie sie sind, und so beginnt der Kreislauf stets von neuem. So verläuft auch das Abschlußgespräch zwischen William und seinem Psychiater wie folgt:
Er zog sich an für einen letzten Besuch bei Dr. Gamow, seinem Psychoanalytiker. Zum tausendsten Mal nahm er Platz auf dem verstellbaren Stuhl, dessen Lehne mit Absicht weder ganz aufgerichtet war noch ganz umgeklappt…Dr. Gamow hatte ihn selbst entworfen und konstruiert, und nannte ihn seinen >mehrdeutigen< Stuhl. Er erfuhr sehr viel von seinen Patienten durch die Art und Weise, wie dieser auf dem Stuhl saß…Zum tausendsten Mal blickte Dr. Gamow auf seinen Patienten (der wie üblich aufmerksam und freundlich dasaß) und spürte eine kleine Aufwallung von Ärger. Er kam zu dem Schluß, dass es gerade diese Liebenswürdigkeit war, die ihn aufbrachte. Es war daran etwas Verschlagenes und Undurchsichtiges, das einen in Verwirrung stürzte. Zwischen ihnen war es nicht immer so gewesen. Das erste Jahr hatte den Analytiker begeistert – nie hatte er einen zugänglicheren Patienten gehabt. Noch nie hatten seine eigenen Theorien eine bessere Bekräftigung gefunden als in den, dem Anschein nach, freien Assoziationen und den reichen Träumen, welcher der andere da vor ihm ausbreitete wie eine Eroberungsbeute. Das folgende Jahr gefiel ihm immer noch. Aber es verblüffte ihn auch. Alles war ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Schließlich begann er zu argwöhnen, er, der Arzt, werde unterhalten, auf prächtige Weise (und zudem dafür noch bezahlt)…Bitterer noch war der zweite Verdacht: dass sogar die Träume und Erinnerungen des Patienten, welche des Arztes Theorien belegten und eine Hypothese nach der anderen bekräftigten, eine Art Rollenspiel waren…Darauf angesprochen, legte der Patient natürlich ein entsprechend bezauberndes Geständnis ab…Das letzte Jahr der Analyse hatte den Arzt vollends verstimmt. Er kam zu dem Schluß, vor sich eine >Southern belle< zu haben: einen guten Tanzpartner: leichtfüßig und ausdruckslos. Er hatte keine Ahnung davon, dass es überhaupt etwas auszudrücken gab. Fünf Jahre lang hatten die zwei nun den seltsamsten Tanz der Geschichte getanzt, jeder auf den anderen abgestimmt und auf Wohlgefallen aus, und entschwanden so, im Krebsgang, ins Nirgendwo…
Der Techniker hatte andererseits eine hohe Meinung von seinem Analytiker. Besonders gern hörte er ihm zu, wie er redete…Anders als die meisten Amerikaner, die sprechen, als schlürften sie Haferschleim, wählte er die Wörter aus wie Bonbons, so dass seine Patienten, deren Leben eine trübselige Angelegenheit war, den allererfreulichsten Eindruck von dem Reichtum und der Ergötzlichkeit solcher Alltagsdinge, wie Wörter es sind, bekamen. Im Unterschied zu manchen Analytikern gebrauchte er weder große Worte noch Fachbegriffe; doch die kleinen, gewöhnlichen Wörter, die er benutzte, wurden gesetzt mit einem besonderen Glanz.
Eines Tages teilte er Dr. Gamow mit, er habe eine Entscheidung getroffen. Er war überzeugt, die Möglichkeiten der Analyse erschöpft zu haben – obgleich er gewaltig davon profitiert hatte -, und meinte im Scherz, er könnte ab jetzt mit dem Analytiker den Platz tauschen. Nachdem er beinahe fünf Jahre das Objekt einer, freilich hocheinzuschätzenden, Technik gewesen sei, schwebe es ihm vor, auf die andere Seite hinüberzuwechseln und einer von denen dort, ein Wissenschaftler, zu werden. Vielleicht hatte er sogar diese und jene Idee zum >Versagen der Kommunikation< und dem >Identitätsverlust< in der modernen Welt (er wusste, dass das bevorzugte Themen Dr. Gamows waren). Es sei an der Zeit, sich ein wenig auf die eigenen Füße zu stellen.
Der vom Entschluß des Patienten überraschte Analytiker versucht noch einmal, mit seinem Patienten ins Gespräch zu kommen. Es wäre vielleicht von Nutzen herauszufinden, weswegen Sie verdreht sind.< >Einverstanden<, sagte der Patient, der mit allem immer gleich einverstanden war. Und dann erinnert der Psychiater ihn daran, dass er in der letzten Sitzung eine Art Umgebungs-Theorie erwähnt hatte. Sie bemerkten, selbst unter idealen Bedingungen fühlten Sie sich irgendwie – ich meine, das Wort, das Sie benutzten, war hohl.< Dr. Gamow fragt ihn dann, was er unter ‚hohl’ versteht; ob er vielleicht seinen Körper oder ein Organ gemeint habe. Er erinnerte sich jetzt, dass er gekränkt gewesen war über Dr. Gamows Meinung, er fühle sich wirklich ausgehöhlt; etwa, als seien Hirn oder Milz ihrer Substanz beraubt worden. Es hatte ihn gekränkt, dass Dr. Gamow ihn verdächtigte, verrückt zu sein.
Der hier geschilderte Dialog zwischen Arzt und Patient, der zuweilen einer Szene auf dem Theater ähnelt, ist eine der Schlüsselstellen des Romans. Dem Analytiker scheint es gar nicht ungewöhnlich, dass er auch nach fünf Jahren noch nicht in der Lage ist, die Ursachen für die Leiden seines Patienten gefunden zu haben; seine Hohlstellen. Das ist insofern nicht verwunderlich, als er an den falschen Stellschrauben zu drehen scheint. Er sucht Ansatzpunkte z.B. in Versprechern, hinter denen er Geheimnisse vermutet, die ihm Hinweise auf die seelischen Befindlichkeiten der ihm Anvertrauten geben könnten; sog. Freudschen Versprechern. Immer dann scheint er Bestätigungen für seine Theorien und Diagnosen gefunden zu haben. Und vor allem: er sucht die Ursachen für deren Leiden in den Patienten selbst; in deren Verhalten und der Art, wie sie sich äußern. Vollends verwirrt ihn scheinbar der Hinweis Williams, selbst unter idealen Bedingungen fühle er sich hohl. Dem Arzt kommt gar nicht die Idee, dass irgendetwas mit diesen Bedingungen, der gesellschaftlichen Umwelt, nicht stimmen könnte; er vermutet vielmehr körperliche Gebrechen, so als wären die psychischen Probleme des Patienten eine materielle Substanz, der man mit Hilfe von Medikamenten oder technischen Geräten beikommen kann.
Das scheint eine Kinderkrankheit der Psychoanalye gewesen zu sein: schon an Freuds Praxis soll das Motto: Für soziale Krankheiten nicht zuständig gehangen haben. So versucht der Analytiker den Patienten mit einem Realitätsprinzip auszusöhnen, ohne sich die Frage zu stellen, wie es um diese Realität bestellt ist. Und vor allem: um wessen Realität es eigentlich geht. Ist es diejenige, die von der Mehrheit als normale angesehen wird, weil deren Konventionen und Erwartungen allgemein akzeptiert sind? Oder ist es diejenige, die sich ein individuelles Subjekt gemäß seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen zu schaffen versucht und die durchaus konträr zu derjenigen sein kann, die alle anderen präferieren? Indem der Arzt sich als Repräsentant der ersten Version versteht, verfehlt er nahezu systematisch dessen Symptome und kann diese folglich auch nicht heilen.
Wunderbar ironisiert Percy diese (vergeblichen) Ansinnen des Arztes: Der Mann aus dem Süden lehnte sich zurück und betrachtete den Druck mit den Kolibris (an der Wand der Praxis; Anm. d. V.). Dr. Gamow hatte im Spaß erklärt, sie versinnbildlichten Ideen – glückliche Ideen, von denen er hoffte, sie sprängen in die Köpfe seiner Patienten über. Diese Patienten scheinen ein komplettes Abbild der gehobenen amerikanischen Mittelschicht zu sein. Es handelt sich um Leute wie Sie, denen es schwerfällt, mit anderen in einer selbstverständlichen Weise umzugehen. Wie Sie befinden sie sich in dieser oder jener Phase einer Identitätskrise. Unter ihnen ist ein Romanschriftsteller, der nicht mehr schreiben kann, ein Techniker wie Sie, der mit Digitalrechnern arbeitet und Zustände von Depersonalisation hat. Es ist auch eine Schauspielerin dabei, die ihren Text nicht mehr behält. Dann ist da eine Hausfrau mit ein wenig mehr Angst, als sie bewältigen kann – einerseits psychisch labil, andererseits auf Erfolg aus. Außerdem ein außerordentlich empfindsamer Schwarzer, der nicht auf Erfolg aus ist – für ihn ein echtes Identitätsproblem. Und schließlich noch vier Sozialarbeiter.
Die letzte Begegnung zwischen Arzt und Patient endet damit, dass ihn der Analytiker fragt, was sich denn in dem hübschen Lederfutteral befindet, das William im Empfangszimmer abgelegt hat. Es ist ein Teleskop, das er sich kurz zuvor gekauft hatte. Dafür hatte er seine gesamten Ersparnisse geopfert. Daraufhin fragt ihn der Arzt: Haben Sie denn vor, ein Sehherr zu werden? >Ein Sehherr?<, fragt William irritiert zurück. >Ein Seher. Schließlich ist ein Seher ein Sehherr; jemand, der imstande ist, zu sehen. Könnte es sein, dass Sie glauben, es gäbe eine letzte verborgene Wahrheit, und Sie seien im Besitz der Zaubermittel, sie zu ent-bergen?< Der Patient lachte. >Ja, da könnte etwas dran sein. Ein Seher!< Warum nicht, scheint William zu denken. Vielleicht ist es ja nicht die Wahrheit, die sich auf diese Weise finden lässt, sondern etwas viel Näherliegendes. Als er eines Tages im Central Park einen Wanderfalken mit seinem Teleskop beobachtet, entdeckt er zufällig eine Frau, die augenblicklich sein Interesse weckt. Er lernt sie kurze Zeit später kennen, verliebt sich in sie und geht mit ihr zurück in seinen geliebten Süden. Wenigstens für kurze Zeit scheint er gerettet.
Bildquelle: Pixabay, Bild von katermikesch, Pixabay License