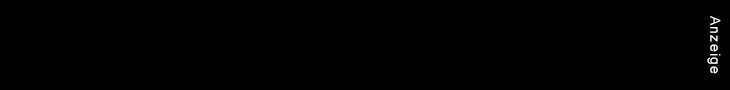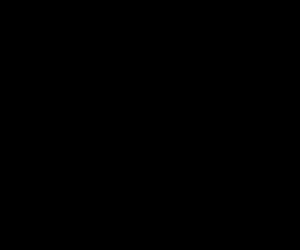Es ist Schicht im Schacht im deutschen Steinkohlebergbau, der letzte Pütt, die Zeche Prosper hat dicht gemacht. Zum Gedenken an 200 Jahre Kohlebergbau, zur Erinnerung an goldene und dunkle Zeiten, an Aufstiege und Abstiege, an Maloche, an Tragödien kam sogar der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, es erschien selbstverständlich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und 500 geladene Gäste. Feierlich ging es zu, wie es immer zugeht in deutschen Landen bei Anlässen wie diesen. Man gibt sich die Ehre zu Ehren der Kohle, würdigt die Leistungen der Kumpel unter und über Tage. Man singt noch einmal das alte Lied: Glückauf, der Steiger kommt- und man hätte hinzufügen müssen: nicht mehr. Es ist das Ende einer Ära, die das Ruhrgebiet geprägt und ihre Wunden in die Landschaft geschlagen hat. Ohne die Kohle wäre das Wirtschaftswunder in Deutschland nicht machbar gewesen, ohne die Kohle kein Stahl, ohne Kohle und Stahl keine Kanonen von Krupp für die Kriege gegen Frankreich oder später den Rest der Welt.
Am Ende war der Bergbau Kult. Seit Jahren strömen Millionen Touristen ins Revier, das heute teils einer Museen-Landschaft gleicht, man wandelt auf den Spuren des Bergbaus, staunt über Geschichtliches und Industrielles, bewundert einstige Fördertürme wie den von Zollverein in Essen oder den Landschaftspark Duisburg-Nord, dort, wo einst das Stahlwerk von Thyssen-Krupp stand. Aus und vorbei, die Pütts sind dicht, Landschaftsparks oder Museen zieren die Region. Man kann dort spazieren gehen, sogar im Anzug und Kostüm mit weißer Bluse, die Luft ist sauber.
Eine Region wird hochgejubelt
Ich komme aus dem Ruhrgebiet, einer Ecke in der Nähe des Schiffshebewerks Henrichenburg in Waltrop. In meiner Familie war niemand unter Tage, meine Mutter war ein paar Jahre in der Lohnbuchhaltung der Zeche Emscher-Lippe in Datteln beschäftigt. Es gab keinen Bergmann in der kinderreichen Familie meines Vaters, Schneider war der eine, der andere Elektriker. Dennoch war der Bergbau bei uns zu Hause Alltag, es wurde geheizt mit Kohle, die überall gefördert wurde, Zechen gab es in Datteln, Oer-Erkenschwick, in Castrop-Rauxel, ringsum waren Fördertürme zu sehen, konnte man die Industrie riechen. Es gab in den 50er Jahren noch keine Zentralheizung in vielen Häusern, ein Bad mit Heizung war Luxus, gebadet wurden wir Kinder einmal die Woche in einer Zink-Badewanne. Die Toilette war entweder auf dem Hof oder am Ende des Hauses. Dort, wo andere Ställe für Hühner oder anderes Kleinvieh hatten, war das Plumpsklo. Man sollte das nicht vergessen in dieser Zeit, da die Region hochgejubelt wird. So schön war es nicht in den Jahren nach dem Krieg, die späteren Bilder von Zechensiedlungen verschönern das, was Wirklichkeit war. Es sah grau aus und trist. Die Leute hatten Arbeit, mit dem Geld kam man zu Recht, aber mehr nicht.
Über 5 Millionen Menschen leben heute noch im Ruhrgebiet, das sich früher eher seiner Industrie schämte. Wer vor Kohle arbeitete oder mit dem Stahl bei Thyssen und Krupp zu tun hatte, machte sich gezwungenermaßen die Hände schmutzig. Wer je eingefahren ist unter Tage, konnte sich einen Eindruck verschaffen von dieser völlig anderen Welt da unten. Ich hatte mehrfach die Gelegenheit, mit dem Förderkorb in atemberaubender Geschwindigkeit bis in 1200 Meter Tiefe zu rauschen. Mal sind wir ins Bergwerk Haard in Oer-Erkenschwick eingefahren, vor ein paar Jahren auf Prosper in Bottrop, der modernsten Zeche der Zeit. Wir wurden wie alle eingekleidet, mussten alles bis auf die Unterhose ablegen und zogen stattdessen baumwollene Unterwäsche an, Schuhe, die bis über die Knöchel gingen, ein blau-weiß gestreiftes Hemd, was nichts mit Schalke 04 zu tun hat, eine dicke Hose, ein Halstuch, einen Helm mit Grubenlampe, das Atemschutzgerät hing einem am Gürtel, damit man im Falle eines Brandes überlebte. Und dann mussten wir unter Leitung eines erfahrenen Steigers wegen eines Wasserrohrbruchs einen ziemlichen Umweg nehmen, uns lief der Schweiß am ganzen Körper herunter. Ja, da unten ist es warm, sehr warm.
Platzangst im Streb
Wir konnten in den Streb krabbeln, dort, wo sie die Kohle abbauen, es staubte, ein Gast, der früher beim Fernsehen gearbeitet hatte und der nun Pressechef eines Unternehmens an der Ruhr war, kroch nach zwei Metern wieder raus aus dem Streb. „Ich habe Platzangst.“ Da unten sind Maschinen über Maschinen, dicke Kabel, Schienen, auf denen kleine Züge rollen. Riesig die Ausmaße. Man stelle sich nur kurz mal vor, wie die Kumpel vor 100 Jahren arbeiten mussten, ohne maschinelle Hilfe, Knochenarbeit war das und ungesund, weil sie fast alle Staublunge kriegten und später keine Luft mehr hatten zum Atmen. Diese Industriealisierung hat eine ganze Region verändert. Aus Dörfern wurden Städte, Großstädte wie Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Recklinghausen. Aus Kohle machten sie in der Kokerei Koks, sie brannten ihn, und erzeugten im Hochofen Stahl.
Gerade vernahm ich aus dem Mund eines Umweltfreundes die Ansicht, für die Umwelt wäre es besser gewesen, man hätte die Kohle da gelassen, wo sie war. Unter Tage. Eine ziemlich naive Vorstellung. Ohne Kohle keine Eisenbahn, kein Ruhrgebiet, kein Wirtschaftswunder.
Vorbei die Geschichte. Der Steiger kommt nicht mehr. Es ist vorgesorgt, dass das Revier nicht absäuft. Die dafür eingerichteten Pumpen verhindern das, sorgen dafür, dass sich Grubenwasser und Grundwasser nicht vermischen. Das kostet Geld, viel Geld und wird ewig dauern. Sonst würde aus einer Stadt wie Essen und den umgebenden Gebieten eine riesige Seenplatte.
Früher hieß es, das Ruhrgebiet sei eine Region aus Kohle und Stahl, dann wurde es eine Ecke mit Kohle und Stahl, weil die Zechen starben und anderen Industrien sich ansiedelten. Heute ist das Ruhrgebiet nicht mehr schwarz, voller Ruß, sondern grün und der Himmel fast so, wie es Willy Brandt einst versprach, nämlich blau. Es gibt Universitäten, die der Kaiser damals ausgeschlossen hatte, der Arbeiter sollte arbeiten und nicht auf dumme Gedanken kommen. Heute studieren in Dortmund, Bochum, Essen-Duisburg und an der Fern-Uni Hagen rund 300000 junge Menschen aus aller Welt. Ruhrgebiet-Kulturgebiet, das ist längst kein Traum mehr, man denke an das Schauspielhaus Bochum oder die Jahrhunderthalle mit ihren Konzerten, das Museum Folkwang in Essen und die dortige Oper, das Schauspiel in Dortmund.
In Schalke singen 60000
Wer ans Ruhrgebiet denkt, kommt an Schalke nicht vorbei. Dort leben sie die Tradition, die Kohle, das Revier. Das alte Stadion, die Glückauf-Kampfbahn wurde auf einem Gelände errichtet, das einst der Zeche Consolidation gehörte, Schalke 04, die Knappen, wie man sie immer noch nennt, obwohl schon in den Glanzzeiten nur noch Ernst Kuzorra ein ehemaliger Kumpel war. Später zählte Willi Koslowski, den sie am Schalker Markt den Schwatten nannten, zu den wenigen Bergleuten unter den Fußballern. Koslowski war Nationalspieler, wie Klaus Fichtel, der aus Ickern nach Gelsenkirchen kam, er hatte unter Tage auf Zeche Viktor gearbeitet. Schalkes Ehrenpräsident Gerd Rehberg war einst ein Bergmann, wer ihm begegnet, wird ihn schätzen, seine Bescheidenheit und Natürlichkeit. Auf Schalke hat man diese Tradition verinnerlicht, man singt neben der Vereins-Hymne das Steigerlied, inbrünstig, wie sie es nur hier auf Schalke können. Aus 60000 Kehlen. Wenn ihre Fußballer nur halb so gut spielen würden…
Es ist nun vorbei. Der Abschied, die Tränen der Rührung, die Lobeshymnen. Was bleibt fürs Revier?! Dem Süden der Städte von Essen bis Bochum geht es gut, im Norden sieht es ziemlich dürftig aus, armselig. Der Strukturwandel läuft, ja seit Jahren und er wird dauern. Aber er wird nur Erfolg haben, wenn man die von der Kohle geschundenen Städte endlich von ihren Altschulden entlastet. Sie mussten, obwohl sie kaum Geld hatten, welches aufnehmen, um auf Pump in den Fonds Deutsche Einheit einzuzahlen. Ein schlechter Witz war das, Proteste aus dem Ruhrgebiet blieben unerhört in Düsseldorf wie in Berlin. Die Städte im Ruhrgebiet stöhnen unter der milliardenschweren Schuldenlast, sie werden von ihr nahezu erdrückt die Städte an Emscher und Ruhr. Sie haben keine Luft, um in die Zukunft zu investieren, in Kindergärten, Schulen, in neue Wohnsiedlungen, neue Industrien. Wer in den Norden des Reviers schaut, sieht das Elend an jeder Ecke. Arbeitslose, Hilfsarbeiter, Flüchtlinge sind in die Viertel gezogen, wo einst die Malocher der Zechen lebten, die aber nach dem Zechensterben wegzogen. Stadtteile verkommen.
Der Pott braucht Hilfe zur Selbsthilfe, damit er nicht absäuft und die Menschen nicht verloren gehen. Dass in bestimmten Vierteln des Reviers schon bei den letzten Wahlen die Rechtspopulisten von der AfD sehr viele Stimmen bekamen zu Lasten der SPD und der CDU, ist ein Warnschuss, den hoffentlich alle gehört haben.
Bildquelle: Wikipedia, Goseteufel, CC BY-SA 3.0