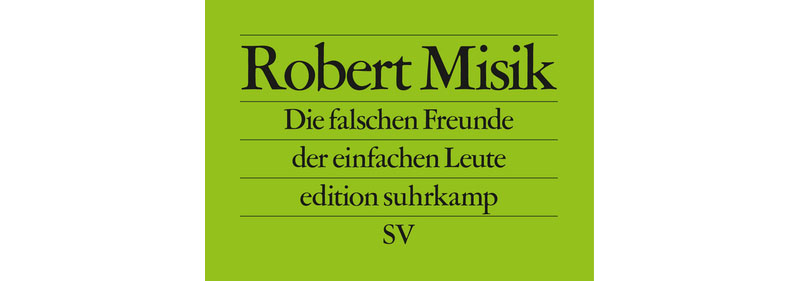Im Frühjahr 2017 erschien Joan C. Williams Buch „White Working Class“, eine ebenso aufschlussreiche wie bewegende, ja dramatische Situationsschilderung der weißen US- amerikanischen Arbeiterschaft. Robert Misik hat in einem eben bei Suhrkamp erschienenen Reader „Die falschen Freunde der einfachen Leute“, an diese grandiose Autorin und Frauenrechtlerin und deren Positionen erinnert.
Joan C. William führt mitten hinein in die Debatte über die Vergangenheit und die Zukunft der Sozialdemokratie.
Ja, es stimmt: Es bildet sich auf einem höheren Niveau an sozialen Rechtsansprüchen eine neue Arbeiterklasse in der Bundesrepublik. Ähnlich der alten industriellen Arbeiterklasse in den fünfziger und sechziger Jahren muss sich diese neue in die heutigen Bildungsangebote hinein kämpfen – was teils gelingt. Sie muss sich ihren relevanten Teil der Umverteilung noch erkämpfen. Gesellschaftlich ist sie abgehängt. Sie existiert in den hauswirtschaftlichen Teilen der Sozialwirtschaft mit ihren 900 €- Löhnen ebenso wie in den Sub-und Sub-Sub- Unternehmen der warenverteilenden Unternehmen, in den hunderttausenden Cafes, Suppenrestaurants und Brunch-Kneipen. Sie fegen die Banken und Ämter sauber. Die Züge und Busse sind morgens zwischen fünf Uhr dreißig und sieben Uhr dreißig voll von ihnen. Wir nehmen sie wahr und dennoch sind sie in unseren Köpfen nicht wirklich präsent.
Auf der politischen Ebene sind sie durchaus präsent: Mindestlohn; Lohn-Gleitzone bis 1300 Euro; fünf Jahre Lohnsubstitution gegen Arbeitslosigkeit; Rechtsanspruch auf Rückkehr in die volle Erwerbstätigkeit, besserer Unterhaltsvorschuss und ein höheres, leichter zu erreichendes Teilhabepaket für Schülerinnen und Schüler, sowie manches andere mehr. Da tut die Sozialdemokratie ihre Pflicht; allerdings entgeht das denen, die ansonsten jeden Hustenreiz unter den Promis mitkriegen, die die Ratesendungen der öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle im Pulk bevölkern.
Stolz auf eigene Fähigkeiten
Williams hat die weiße US- Arbeiterschaft als vergessene und vernachlässigte Minderheit beschrieben; deren Leistungen, deren Stolz auf die eigenen Fähigkeiten und deren Stolz darauf, auf eigenen Füßen zu stehen, keine Rolle mehr spielen. Eine verletzte und missachtete soziale Gruppe, der die Funktionseliten keine Orientierung mehr gegeben hätten. Die letzte Persönlichkeit, die in diesem Zusammenhang wirklich etwas galt, war wohl Michael Dukakis, der 1988 gegen Bush Senior angetreten war, aber verlor und 87-jährig seit mehr als 50 Jahren mit derselben Frau verheiratet in Brookline Massachusetts lebt, wo er geboren wurde.
Und hier, bei uns? Was gelten die Leistungen der Millionen Arbeiterinnen und Arbeiter während der fünfziger, der sechziger und siebziger Jahre heute? Spielt deren Stolz auf Gelerntes und Erreichtes, auf das eigene Können noch eine Rolle? Ist deren Wollen, auf den eigenen Füßen zu stehen und durchs Leben zu kommen ohne gleich nach dem Staat zu rufen, noch von Bedeutung? Das ist eine der in der alten Arbeiterklasse sehr weit verbreiteten Eigenschaften, die freilich kaum noch gewürdigt wird.
Wo bleiben die kleinen Leute?
Ich versuche mir vorzustellen, was im Kopf eines ehemaligen Ford-Arbeiters aus meiner Heimat vor sich geht, der liest, dass man in Berlin, im Görlitzer Park das Dealen (also auch das Versorgen von Heranwachsenden mit „Stoff“) unter das Toleranzgebot stellt. Was denkt er sich, wenn seine Kinder und Kindeskinder immer wieder darüber klagen, dass Busse und Bahnen unzuverlässig fahren, so dass es ständig schwierig ist, pünktlich zur Arbeit zu kommen.
In den großen Toleranzdebatten unserer Zeit spielen diese „einfachen Leute“ keine große Rolle. Sie gelten „irgendwie“ als spießbürgerlich, weil sie auf das Acht geben, was sie haben und was uns allen nutzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Plastiktüten mit Müll gefüllt anderen Leuten vor die Tür oder an der Bushaltestelle hinstellen und verschwinden. Es sind aber „diese Leute“, deren Spind neben dem des Kollegen aus Diyarbakir oder aus Agadir stand, und die mit diesen Kollegen die Arbeit teilten: Weil sie wussten, was sie selbst wert sind, wussten und wissen sie auch, was diese Kollegen aus anderen Ländern wert sind.
Welches Bewusstsein bildet sich in der neuen Arbeiterklasse? Haben sie einen „Michael Dukakis“, dem sie politisch vertrauen? Wie viele sind stolz darauf, einen Job zu haben, die Familie zusammen mit dem Partner ernähren zu können? Stolz darauf, dass die Kinder auf der Gesamtschule vorankommen? Wissen wir das? Warum wissen wir das nicht?
Man werde die „grundlegende verbreitete Unzufriedenheit nicht verstehen“, schrieb Misik dieser Tage in der TAZ, „wenn man nicht die Werte und Normen versteht, die sich in den letzten 200 Jahren in den real existierenden arbeitenden Klassen durchgesetzt haben“. Da ist was dran. Das könnte erklären, warum die Sozialdemokratie, gesellschaftlich gesehen, humpelt und strauchelt.
Bildquelle: Suhrkamp Verlag