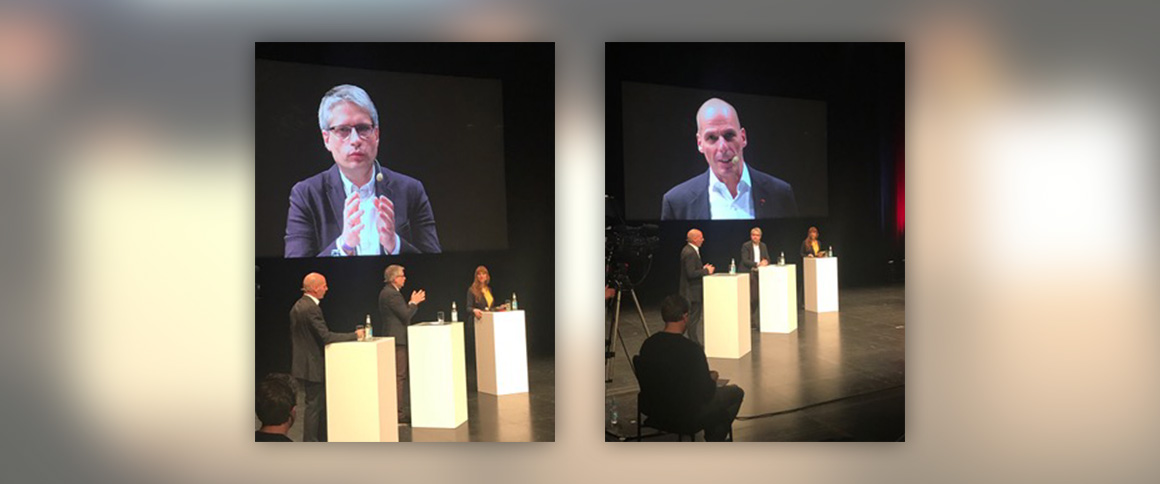Der ehemalige griechische Finanzminister Yannis Varouvakis und Sven Giegold, Spitzenkandidat der Grünen für die Europa-Wahlen, waren die Zugpferde des EuropaCamp der ZEIT-Stiftung am 26./27. April in Hamburgs Kulturzentrum Kampnagel. Die Veranstalter titelten das Aufeinandertreffen der Protagonisten des Green New Deals als „Europa Battle – Who Has the Best Ideas for Europe“. Statt ins Schlachtfeld um die besten Ideen zu ziehen, starteten der Charismatiker Varouvakis und der grüne Realo Giegold als Freunde. Sie wollten keinen „Battle“, sondern bestenfalls einen Wettbewerb der Ideen, lautete ihr Eingangsstatement. Während der deutsche Finanzexperte und Grüne für Akzeptanz des Green New Deal warb, nutzte der Grieche die Konferenz auch für eine Abrechnung mit den europäischen Finanzinstitutionen. Schon nach kurzer Zeit wurde erkennbar, dass der Zeitplan für die Session aus dem Ruder laufen werde. Nur wenige der 200 Zuhörer im Auditorium des Kulturzentrums ließen sich davon abbringen, auch die Verlängerung mitzuerleben, zu einzigartig war der Schlagabtausch dieser alternativ-ökonomischen Schwergewichte.
Mehr Transparenz, um das Vertrauen der Bürger (zurück) zu gewinnen
Giegold betonte das Erreichte in Europa und ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass Wohlstand und Frieden in der Union der 28 Staaten ohne die gemeinsame Politik und die Wertegemeinschaft nicht möglich gewesen wären. Wortstark betonte der grüne Ökonom die Probleme, die zuweilen die aus seiner Sicht insgesamt gute Bilanz im Schatten stehen ließen. So mangele es im Hinblick auf die politischen Entscheidungsprozesse in Brüssel an Transparenz. Nur selten würde sichtbar, welche Institutionen die politischen Ergebnisse beeinflusst hätten. Auch sei das Lobbying eine große Schwachstelle in Brüssel und Straßburg. Dabei warnte er, dass in dem Maße, wie sich in Folge unzureichender Offenheit das Misstrauen verstärke, die EU an Legitimation verlöre damit würden jene Kräfte an Gewicht gewinnen, die die EU in Frage stellen. Um gegen diese Bedrohungen gewappnet zu sein und die EU zu festigen, forderte Giegold die Transformation in eine Europäische Republik.
Varouvakis nahm diesen Ball dankbar auf und beklagte die unzureichende Transparenz in der EU, wollte dies aber nicht auf die Politik beschränkt sehen, sondern verortete die Unzulänglichkeit in erster Linie bei den europäischen Finanzinstitutionen. Sicher verständlich, standen ihm doch in seiner Zeit als griechischer Finanzminister eine kompromisslose Phalanx europäischer Institutionen gegenüber. In diesem Kontext muss man sicher sein Urteil sehen, dass hinter den verschlossenen Türen der Europäische Kommission und der Europäische Zentralbank transparenz- und demokratiefreie Zonen entstanden seien. Ein besonderer Wert der Ausführungen des wortstarken Griechen war die Metaphorik, so bezeichnete er die EZB als die am „wenigsten unabhängige Bank auf diesem Planeten“; ein Urteil, dass sicher nicht viele Fürsprecher im europäischen Finanzestablishment finden wird. Mit Finanzmitteln aus der EU, erhoben über Steuern, will er auch den Migrationsbewegungen im Binnen-Europa den Druck nehmen. Die Griechen kämen sicher nicht des schönes Wetters wegen nach Deutschland oder England.
Auf die Frage, wie die Transparenz erhöht und der Europa-Skeptizismus der Bürger begrenzt werden könne, hatten die beiden Streiter für die Europäische Republik weitgehend übereinstimmende Ideen. Sichtbar auf konstruktive Weiterentwicklung ausgerichtet, forderte Giegold, an der Verwirklichung einer Transnationalen Europäischen Demokratie weiter zu arbeiten, statt permanent die Defizite aufzuzeigen, ein – wenn auch nicht wirklich streitbarer – Gegenpol zur Haltung seines Gegenübers. Seiner Auffassung nach bräuchten wir einen institutionellen Reformprozess für die Strukturen in Europa. An diesem müssten die Bürger aktiv beteiligt werden, um die Akzeptanz des Erreichten zu sichern. „Wir brauchen eine echte Verfassung für Europa“, schloss er seinen Aufruf zu mehr partizipative Demokratie.
Giegolds Vorschläge klangen zwar wenig spektakulär, waren aber ungeachtet dessen noch entfernt von der Realität. Die Brüsseler Politik müsse mehr mit den Bürgern kommunizieren. Es brauche mehr Offenheit darüber, wer die Entscheidungen zugunsten oder zulasten der Bürger gefällt habe. Die Ergebnisse würden national verzerrt. So würden die positiven Ergebnisse als nationale Erfolge ausgegeben, während für die negativen Brüssel herhalten müsse. Bei der Bürgerbeteiligung lobte er die Öffentlichen Konsultationen in der EU und bescheinigte ihnen einen Erfolg, der auf der nationalen Ebene keine Entsprechung fände. Und trotzdem hätten die „Open Consultations“ in der EU den Makel, bei den Bürgern zu wenig bekannt zu sein und überwiegend von Verbänden und anderen Lobbyisten genutzt zu werden. Ein Erfolgsmodell, so Giegold, sei die Europäische Bürgerinitiative. Wir erinnern uns, dass die erste Europäische Bürgerinitiative, right2water, im Kampf gegen die, durch die Europäische Kommission befürchtete Privatisierung des Wassers in Europa, mit über 1,7 Millionen Unterschriften für Furore gesorgt hatte. Auch Varouvakis sprach sich für mehr Partizipation aus, verspricht sich eine höhere Europa-Akzeptanz aber in Folge einer größeren institutionellen Transparenz und Glaubwürdigkeit der Institutionen.
500 Milliarden Euro jährlich für den New Green Deal
Unter dem Titel des „Green New Deal“ fanden die beiden dann wieder eine Gemeinsamkeit. Spätestens bei der Frage dessen Finanzierung trennten sich dann ihre argumentativen Wege. Varouvakis sorgte mit der Forderung nach EU-Finanzmitteln für den Green New Deal für hörbares Durchatmen im Auditorium. „Wir müssen 500 Milliarden Euro jährlich investieren, um Gesellschaft und Umwelt zu stabilisieren. Giegold dagegen ließ in seinen Ausführungen den Realisten durchblicken: „Wir müssen das vorhandene Kapital in umweltfreundliche und grüne Industrien umlenken. Diese Bereiche müssen wir stärken. Das wird die alten Industrien ihre Kraft entziehen.“ Das Motto muss sein, entweder schafft reformiert ihr euer Geschäftsmodell oder ihr werdet sterben.“ Damit öffnete er sich einerseits einem eher marktwirtschaftlich orientierten Prinzip des Green New Deals und bezog anderseits eine Umlenkung der europäischen Finanzmittel ein. Varouvakis dagegen setzt auf Anleihen, um die Maßnahmen mittels staatlicher Kredite zu finanzieren. Giegold schloss mit der Feststellung, „wir brauchen keine zentral gesteuerten Instrumente, sondern ein umfassendes grünes Investitionsprogramm und eine grün-orientierte Regulierung, die zuverlässige Rahmenbedingungen schafft.“
Resümierend bot dieser Schlagabtausch der Ideen im Rahmen des EuropaCamps den Zuhörern einen beträchtlichen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die Schaffung einer stärkeren Akzeptanz der europäischen Institutionen und die ökonomische Umsetzung des Green New Deals. Weit mehr als zwei Stunden mit Varouvakis und Giegold boten aber noch mehr: einen Unterhaltungswert, der die ZEIT-Stiftung als Veranstalter motivieren sollte, das EuropaCamp nicht auf Hamburg zu beschränken. Der Kampf für Europa und gegen die rechten Populisten wird auch nach der Wahl am 26. Mai weitergehen.
Bildrechte: Siegfried Gendries