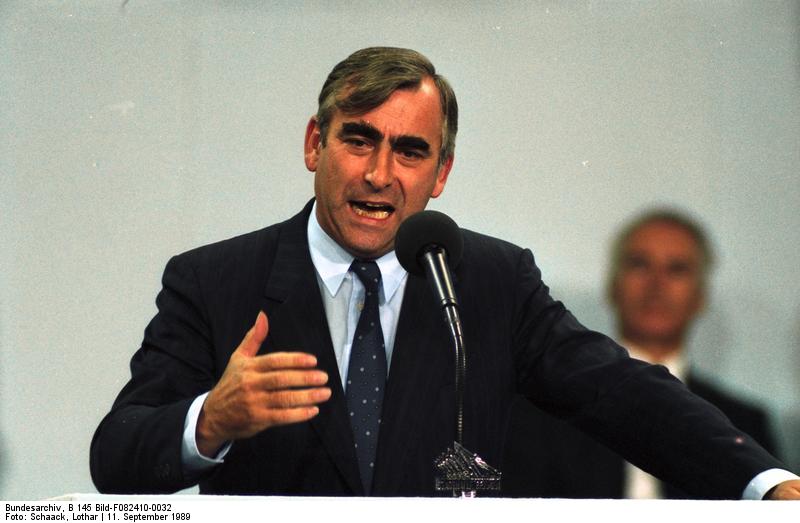Den langjährigen Beobachter der politischen Szene in Deutschland verwundert ein wenig, wie ruhig es bei der SPD zugeht, zumindest vordergründig. Die Schlagzeilen, für die sonst die Genossen ein feines Händchen hatten, liefern seit Wochen andere. Die CDU und die FDP scheinen die Bühne gepachtet zu haben, auf der sie den Zuschauern ein Spektakel liefern, das es in dieser Form schon länger nicht mehr gegeben hat. Der Fall Thüringen wurde zum schlimmen Beispiel, das sich Demokraten zuvor nie hätten vorstellen können. Mit der Wahl eines FDP-Mannes zum kurzzeitigen Ministerpräsidenten mit den Stimmen der CDU, der FDP und der rechtsradikalen AfD mit dem Faschisten Höcke als Landeschef schlitterte ein Land in die Krise. Und in der Folge zeigte sich die ganze Führungsschwäche der CDU unter Annegret Kramp-Karrenbauer, die ihre Thüringer „Parteifreunde“ nicht einfangen konnte.
Die Union ist weit weg von dem, was ihr Name besagt: Einigkeit, Eintracht. Der Streit über Thüringen und den Umgang mit der AfD und den Linken offenbarte die Kopflosigkeit der Christdemokraten. Dass das so ist, hängt natürlich vor allem damit zusammen, dass die langjährige CDU-Chefin Angela Merkel, Kanzlerin seit 2005, den Parteivorsitz abgegeben hat und bei der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 nicht mehr antritt als Kanzlerin. Also erleben wir im Herbst 2021 erstmals seit vielen Jahren eine Wahl ohne den Amtsinhaber, keiner kann mit dem Amtsbonus in den Wahlkampf ziehen. Das macht es spannend. Und zwar in allen Parteien, auch in der SPD, bei den Grünen. Eine Groko wird es nicht mehr geben, für eine christlich-liberale Koalition sind nach heutigem Stand beide Partner zu schwach, Jamaika wäre eine Lösung, aber auch Schwarz-Grün ist denkbar und, sollte sich die SPD ein wenig erholen, ist auch ein Linksbündnis Grün-Rot-Rot oder Rot-Grün-Rot möglich. Die Karten werden neu gemischt.
Kanzlerkandidat und CDU-Vorsitz gehören im Sprachgebrauch der Christdemokraten stets zusammen. Dass gleich drei Kandidaten sich um ein wichtiges Amt in der Partei bewerben, kann man zwar positiv sehen, weil es zeigt, dass die CDU über ausreichend Führungspersonal verfügt. Mehr noch ist es aber ein Signal der fehlenden Kompetenz bei jedem der Kandidaten, ist es ein Beleg für die Zerstrittenheit dieser Partei, die sich im übrigen immer viel darauf eingebildet hat, dass sie nicht so zerstritten sei wie ihr Haupt-Konkurrent, die SPD. Und dass die CDU Kanzlerwahlverein war, der regieren wollte und sich dann eben hinter einer Person vereinigte. Das ist Geschichte.
Laschet oder Merz, das ist die Frage
Nicht umsonst wollte vor allem Armin Laschet eine harmonische Lösung ohne Kampfkandidatur erreichen, er wollte ein Team bilden aus Friedrich Merz, Jens Spahn und sich selber. Der Haken dabei war für den selbstbewussten Sauerländer Merz, dass Laschet die Führung des Teams für sich beanspruchte. Also machte Merz nicht mit. Jens Spahn dagegen, der Jüngste in der Runde, ließ mit sich reden und reihte sich hinter Laschet ein, dem Landesvorsitzenden der CDU in NRW und immerhin Ministerpräsidenten des bevölkerungsreichsten Landes in der Republik. Spahn ist jung genug, um auf seine Chance später warten zu können. Bliebe noch einer wie Norbert Röttgen, ein Strahlemann, der schon mal eine Wahl hochkant verloren hat-in NRW- und der als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses ein Amt hat, das ihm immer wieder ein Podium bietet, um sich auch international darzustellen. Er war derjenige, der als erster seinen Anspruch auf die Spitzenposition im Konrad-Adenauer-Haus angemeldet hatte. Truppen hat er wohl keine hinter sich. Mithin haben wir auf dieser Seite zwei Einzelkandidaten und ein Duo.
Es darf darüber spekuliert werden, wen der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder favorisieren wird, kommt es zum Schwur. Dass er mitredet, musste er beim Aschermittwoch in Passau nicht so laut betonen, wie er das tat. Aber in dieser Atmosphäre der bayerischen Bierzeltstimmung muss man wohl auf den Tisch hauen, um sich Gehör zu verschaffen. Söder will selber in München bleiben, redet aber mit beim Gerangel um den Kandidaten, der das wichtigste Amt der Republik für die Union wieder gewinnen will. Söder kann rechnen, drum haute er auf die Grünen, weil die der stärkste Gegner sein werden 2021. Und weil er nicht sicher sein kann, dass diese Grünen am Ende nicht mit SPD und Linken gemeinsame Sache machen. Kaum denkbar, dass er für Röttgen ist, eher glaube ich, dass er einen Laschet einem Merz vorziehen wird, weil er davon ausgehen kann, mit dem Rheinländer Laschet seine politischen Wünsche durchsetzen zu können. Andererseits weiß Söder um die Nähe des Merz zur Wirtschaft, kennt die Distanz des Mittelstandes zu Laschet, der aber seinerseits über Regierungserfahrung verfügt. Laschet ist breiter aufgestellt als Merz, polarisiert nicht wie der Mann aus dem Sauerland, er umarmt mehr die, die er für seine Mehrheiten braucht. Oder wie es ein SPD-Mann mal formulierte: „Armin Laschet ist wie Johannes Rau, nur katholisch.“ Aber: Für Merz hat sich der wichtige CDU-Landesverband Baden-Württemberg ausgesprochen, offen ist, wie die Hessen stimmen, die Niedersachsen. NRW stellt auf einem Parteitag rund 40 Prozent der Delegierten, das ist eine Macht, der sich Laschet aber nicht sicher sein kann. Merz und Röttgen kommen ebenfalls aus diesem Land.
Die Entscheidung Laschet/Merz/Röttgen fällt auf dem CDU-Sonderparteitag am 25. April in Berlin. Es dürfte eine Vor-Entscheidung sein, was die Kanzlerkandidatur betrifft. Denn dabei wird Markus Söder ein Wörtchen mitreden. Die Frage wird aber sein, bleibt nach dem Sonderpartetiag der Christdemokraten und der Wahl des neuen Vorsitzender CDU alles beim alten? Will sagen: Darf Angela Merkel in Ruhe bis zum Ende der Legislaturperiode weiterregieren? Selbst Friedrich Merz konnte man bei seiner Aschermittwoch-Rede in Thüringen so verstehen, dass er als CDU-Chef Merkel das Kanzleramt nicht streitig machen würde. Von Laschet erwartet man sowieso keinen Zoff mit Merkel, mit der er im übrigen gut kann. Also hätte die Wahl des Kanzlerkandidaten der Union Zeit bis Jahresende.
Sieg in Hamburg lässt Probleme vergessen
Ich komme zur SPD und lese in der „Süddeutschen Zeitung“ unter dem Titel „Ohne Kraft und Zentrum“ die übliche Kritik am immer noch neuen Führungs-Duo Esken/Walter-Borjans. Der Erfolg der SPD in Hamburg habe der Partei eine Verschnaufpause verschafft und ihr Gelegenheit gegeben, „für einen Moment die eigenen Probleme vergessen zu machen.“ Und dann folgen die üblichen Aber, wie sie die Berliner Hauptstadtmedien vom ersten Tag der Wahl der beiden SPD-Vorsitzenden liefern. Sie haben sich damit nie anfreunden können, sie sind immer noch beleidigt, dass die Partei anders entschieden hat, als einige Hauptstadt-Journalisten vorhergesagt hatten.
Noch einmal: Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sind Anfang Dezember letzten Jahres vom SPD-Parteitag bestätigt worden. Seitdem sind noch keine 100 Tage vergangen, die man normalerweise neuen Amtsinhaberinnen und -inhabern gewährt. Dennoch haben einige ihr Urteil gefällt: keine Autorität, eine machtlos ins Amt gestartete Parteispitze. Also sei die SPD bei 14 bis 15 Prozent in Umfragen festgenagelt. Die SPD werde keineswegs aus dem Willy-Brandt-Haus gesteuert, ganz nebenbei war das immer schwierig, weil die Parteizentrale seit vielen Jahren ein Eigenleben geführt hat. Man frage mal die Amtsvorgänger. Die SPD sei ohne Kraft und ohne Zentrum. Auch wenn einiges davon stimmen mag, richtig ist auch, dass es ruhiger geworden ist in der SPD und das ist durchaus mit ein Verdienst der neuen Führung. Eine SPD ohne Streit, wann habe ich das das letzte Mal erlebt?
Aber lassen wir das mal so stehen. Und kommen zur wichtigen Frage: Wer wird der nächste Kanzlerkandidat der SPD? Hier hatte sich Walter-Borjans anfangs falsch ausgedrückt, denn natürlich wird die Partei, die mit Willy Brandt, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder drei Kanzler gestellt hat und deren früherer Kanzlerkandidat Frank-Walter Steinmeier seit ein paar Jahren Bundespräsident ist und sich in diesem Amt Tag für Tag mehr Meriten verdient, mit einem Kanzlerkandidaten ins Rennen gehen. Franziska Giffey wird es nicht machen können, sie hat sich festgelegt, sich um die Nachfolge von Michael Müller als Regierender Bürgermeister von Berlin zu bewerben und zu kandidieren. Daran wird man nicht rütteln, die Ministerin Giffey wird froh sein, dass sie die Turbulenzen um ihre Doktorarbeit einigermaßen unbeschadet überstanden hat.
Ich würde auf Olaf Scholz wetten
Gefragt als SPD-Kanzlerkandidat wird ein Politiker sein mit internationaler Erfahrung, gerade in dieser Zeit des Umbruchs, der wachsenden Gefahr des Rechtsextremismus, der Sorgen in weiten Teilen der Bevölkerung wegen einer Epidemie des Corona-Virus, ungelöster europäischer Fragen, wegen der Digitalisierung, der anstehenden Veränderungen in der Energie- und Automobilwirtschaft, der Diskussion um unser Klima und und und. Wenn ich heute wetten müsste, würde ich auf Olaf Scholz setzen, den Bundesfinanzminister und erfahrenen Bundespolitiker, wenn er denn will nach der Niederlage in der SPD und wenn die SPD sich hinter ihm versammelt, wenn das Führungs-Duo Esken und Walter-Borjans ihn fragt und unterstützt. Gemeinsam ist man stark, man schaue auf die Konkurrenz, die sich gerade in den Haaren liegt.
Vor der Abstimmung über die neue SPD-Führung habe ich in diesem Blog auf Walter-Borjans gesetzt. Da ich davon ausgehe, dass der frühere NRW-Finanzminister und auch die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken selber nicht ins Rennen um die Kanzlerschaft gehen, plädiere ich für Olaf Scholz. Hamburg hat gezeigt, dass die SPD noch Wahlen gewinnen kann. Mit einem seriösen Kandidaten, dem dazu passenden Programm, das die Sorgen der Menschen im Auge hat, und der nötigen Solidarität in der eigenen Partei. Olaf Scholz wäre keine schlechte Wahl. Aber wie gesagt, die SPD kann sich Zeit lassen, sie muss nichts überstürzen und sollte den anderen Parteien weiter die Schlagzeilen überlassen.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Pete Linforth, Pixabay License