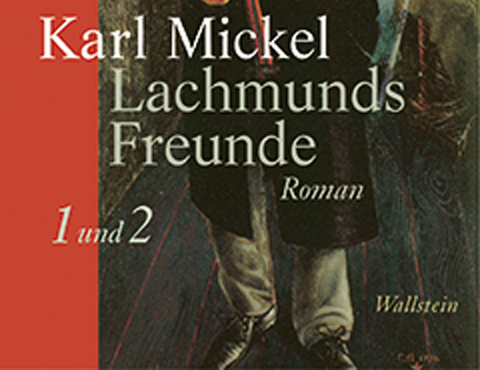Karl Mickels Roman Lachmunds Freunde ist nur wenigen Eingeweihten bekannt. Ich stieß durch Hinweise in den biografischen Skizzen von F.C. Delius auf ihn. Dieser hatte Mickel in seiner Zeit als Lektor des Rotbuch-Verlages kennen und schätzen gelernt.
Der Roman besteht aus zwei Teilen: der erste Teil erschien 1991; der zweite Teil bricht kurz vor Vollendung des 5. Kapitels ab. Es ist das Verdienst des Literaturwissenschaftlers Klaus Völker, der als Nachlaßverwalter den zweiten Teil des Romans ediert hat, dass der vollständige Roman 2006 im Wallstein-Verlag erscheinen konnte. Es ist der einzige Roman Mickels. Daneben schrieb er Gedichte, Theaterstücke und Libretti.
Karl Mickel (1935 – 2000) entstammte einer Arbeiterfamilie; ein Umstand, der ihm immer bewusst blieb. Nach dem Abitur in Dresden, wo er im Februar 1945 die Bombardierung der Stadt erlebte – ein Ereignis, das ihn zeitlebens verfolgte – studierte er Volkswirtschaftsplanung und Wirtschaftsgeschichte bei Jürgen Kuczynski und Hans Mottek in Berlin. Nach dem Studium arbeitete er als Assistent an der Hochschule für Ökonomie in Berlin, schrieb für eine Wirtschaftszeitung und wurde Redakteur der Zeitschrift Junge Kunst. Nach einem Publikationsverbot holte ihn Helene Weigel als wissenschaftlichen Mitarbeiter und Dramaturg ans Berliner Ensemble, wo er insbesondere mit Ruth Berghaus zusammenarbeitete. Danach ging er als Dozent an die Schauspielschule Ernst Busch, wo er in seinen letzten Lebensjahren zum Professor ernannt wurde.
Mickel war ein kritischer, klassisch gebildeter Geist. Delius schreibt über ihn: Er schwärmte für Pindar und John Donne, erklärte Hölderlin. Nicht Germanisten, sondern dieser Ökonom brachte mir Respekt vor Schiller und Goethe bei, er zeigte, wie kühn sie dachten und in welchen Details die Größe der Klassiker steckte. Und er verfügte über ein dialektisches Lachen, ein über den Dingen stehendes, ein sächsisch oder goethisch gefärbtes Weltgeist-Lachen. „Lachmund“ ist nicht umsonst der Name der Titelfigur seines bedeutenden Romans.
Auch Volker Braun schildert seinen Dichterkollegen als einen Sprachmeister und hochsensiblen Gelehrten. Völker zitiert ihn in seinem Nachwort wie folgt: Er studierte die Klassiker und das Chaos. Er war ein Dichter in der Zeit der Volkswirtschaft (nach uns die Warenflut) – ein Dresdner Arbeiterkind, sein Beruf die Hochkultur. Er setzte dichtend ein Menschenmaß, mit Strenge und Gelächter.
Mickels Werk ist im Westen nahezu unbekannt und infolgedessen auch kaum rezipiert worden. Das mag zum einen dem Zeitpunkt des Erscheinens seines Romans geschuldet sein (nach der sog. Wende war diese Art Literatur noch weniger gefragt als vorher); hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass eine derart anspruchsvolle Literatur, wie Mickel sie geschrieben hat, ohnehin nicht gerade marktgängig ist. Klaus Völker schreibt: Fernsehkompatibel, talkshowgeeignet oder kanonverdächtig sind Mickels Spracheigenheit, sein Witz, seine Kreuz- und Querdenkerei nie gewesen, obwohl er lesend oder vortragend durchaus sein Publikum zu unterhalten, mit Verve zu attackieren und zu herzhaftem Lachen zu bringen verstand. Er war ein König des Lachens, ein Freund guten Weins, sinnlicher Freuden und intelligenter Späße.
Mickel schrieb den ersten Teil seines Romans im Wesentlichen in der Zeit von 1965 bis 1983. Er hielt es wohl für zu gewagt, den Roman in der Zeit der DDR zu veröffentlichen. Am zweiten, unvollendeten Teil arbeitete er bis zuletzt. Das Motto des Romans stammt von Jean Paul: Ja, wir haben keine Gegenwart, und die Vergangenheit muss ohne sie die Zukunft gebären.
Der Roman Lachmunds Freunde handelt von drei Männern, deren Wege sich immer wieder einmal kreuzen. Ihr Verhältnis zueinander wird gleich zu Beginn des Romans wie folgt umschrieben: Erzählt wird die Geschichte dreier Männer; ihre Lebenswege sträuben auseinander, dennoch bleiben sie Freunde. Der eine heißt Bär, der andere Günter Hammer, der dritte Eckart Immanuel Lachmund. Merkwürdige Frauen und rührende Mädchengestalten streifen und kreuzen ihre Bahnen oder schwenken auf sie ein. Jede dieser Personen ist selbst wieder Zentrum eines beweglichen Kreises. Wo treffen sie zusammen, die Dreie? Dort, wo der Luftkreis zu stocken scheint, im Auge des Taifuns, am Ort, da die Wirbelstürme untersucht werden.
Die Drei begegnen einander im Jahr 1953. Bär hat gerade sein Abitur bestanden und geht zum Studium nach Berlin. Dort gerät er – eigentlich will er eine Opernaufführung des Don Giovanni von Mozart besuchen -, unversehens in den Aufstand des 17. Juni:
Viele Leute kamen ihm entgegen, schienen auch in den Seitenstraßen zu verschwinden, einzeln. Wohin er sah, sah Bär aufgehobne Sohlen. Dennoch stieg die Bevölkerungsdichte kontinuierlich an, als könne der Platz sich nie leeren und der Zustrom sei größer als der Abfluß. Irgendwoher, von unten, aus der Kanalisation, schien es die Massen aufwärts zu drücken; vielleicht, durch Urzeugung, sind sie dort entstanden. Die Zwischenräume zwischen den Individuen füllte feuchte Hitze; die schwere Luft (Sonne über dem Talkessel) klebte alle an alle. Bär sah verzerrt atmende Münder, die den vergasten Schweiß kauten.
Nun war er im Zentrum; ein runder Pavillon bildete die Mitte des Platzes: von dort aus wurde gemeinhin der Straßenbahnverkehr geregelt, nachts, ein Lautsprecher sagte die letzten Bahnen an. Der Lautsprecher sprach Unverständliches krächzend; niemand achtete weiter auf ihn. Am Rand, von allen reinlich geschieden, standen zwei Polizisten (Unterwachtmeister); ihre Hände hielten sie gemütlich auf dem Rücken verschränkt. Das war die Ursache, dass Bär, auch als er ans Krächzen sich gewöhnt hatte, den Text nicht zu rezipieren vermochte. Der Text lautete: man solle die Regierung absetzen.
Bär gerät in den Ereignisstrudel ohne zunächst zu verstehen, was da vor sich geht. Er stürzt sich ins Getümmel und hält es für seine Pflicht, Partei zu ergreifen. Aber seine Worte gehen im allgemeinen Tumult unter. Er schafft es nicht, sich Gehör zu verschaffen und fühlt sich als Versager. Als schließlich Panzer anrollen, löst sich der Tumult schlagartig auf. Bär wird in der Masse mit fortgerissen und kann sich schließlich aus der unübersichtlichen Lage befreien.
Bär wendet sich an seinen alten Lehrer Bruno Kirpse, genannt Massa, um sich das Ereignis des 17. Juni deuten zu lassen:
Bär umschrieb (stammelnd) das Problem. „Ja“, sagte der Lehrer, „das Menschenwerk fügt sich den Formeln nicht. Es sträubt sich mit Händen und Füßen. Auf eine elegante Lösung dürfen wir nicht hoffen. Ich will aber versuchsweise zusammentragen, was über den Kasus allenfalls gegenwärtig gedacht werden könne … Jener Tag ist der deutschen demokratischen Geschichte, was der Vendée-Aufstand der französischen war; die Bauern der Vendée hatten die französische Revolution mit einem grimmigen Kampf gegen diese und für ihre alten feudalen Ausbeuter beantwortet; irregeführt durch Tradition und, vielleicht, eine gewisse Vorahnung, dass die neue Gesellschaft, weit entfernt davon, die beschreite Freiheit herbeizuschaffen, neue Drangsale bereiten möchte, die, weil ungewohnt und deshalb schwer berechenbar, planmäßiger stiller Renitenz sich entziehen und die Renitenten von der ungedeckten Seite treffen könnten. So wurde der Widerstand, rückverlegt auf bekanntes Schlachtfeld, prinzipiell und erlangt tragische Größe. Hebt also die Vernunft den Naturstaat auf, wie sie notwendig muß, wenn sie den ihrigen an die Stelle setzen will, so wagt sie den physischen und wirklichen Menschen an den problematischen sittlichen, so wagt sie die Existenz der Gesellschaft an ein bloß mögliches (wenn gleich moralisch notwendiges) Ideal von Gesellschaft. Sie nimmt dem Menschen etwas, was er wirklich besitzt, und ohne welches er nichts besitzt, und weist ihn dafür an etwas an, das er besitzen könnte und sollte … Der 17. Juni verhielt sich zur Vendée wie der Holzkasper zum Achill; altes Übel der Deutschen, wer ist Mephistoles?
Derlei Operationen freilich sind mit den 53er Sommerkrächen nicht vornehmbar; nur soviel: die guten Deutschen, welche zwölf Jahre mit Scheußlichkeiten gefüllt hatten, wie sie vor dem in tausend Jahren nicht unterlaufen waren, begannen aufzumucken, weil eine forcierte und nicht unnötige, wenngleich vielleicht halbfalsch gezielte Investitionspolitik zu gewissen Härten geführt und die neue Obrigkeit die lautgewordne Kritik mit gelinder Schroffheit zurückgewiesen hatte; außerdem, der Klassenfeind.
Es handelt sich um Historie minderen Ranges; retardierendes Moment; Epizykel, scheinhafter Rücklauf.
„Aha“, sagte Bär, „das also habe ich gesehen?“, oder er dachte es. Ich werde also die Augen offen halten und ihnen nicht trauen.
Massa Kirpse: Trauen Sie nicht. Halten Sie offen.
Solcherart belehrt, spürt Bär, dass er gebraucht wird. Zwar könnte er noch in die Oper gehen – wenn sie denn stattfände; stattdessen aber geht er nach Hause, um sich seine Funktionärsjacke anzuziehen; dann meldet er sich bei einer der von der Partei organisierten Treffpunkte. Bär wird zum Leiter einer Gruppe ernannt – die aus seinem Jugendfreund Barthel und einer gewissen Ilse besteht und zu deren Aufgabe es gehört, ein sogenanntes Aufklärungslokal gegen etwaige Angriffe zu verteidigen. In so eines kam Bär. Der Augenschein lehrte, dass eine Verteilung der Truppe unnötig war. Vorn stabile dichtschließende Rolleaux, das Fenster des Hinterzimmers vergittert. Drei Stufen führten zum Hinterzimmer; im Winkel zwischen Stufen und Rückwand die Falltür zum Keller, über der Falltür das Plakat: Wie wir heute arbeiten werden wir morgen leben. Das Foto der Köchin, die diesen Satz der Staatsraison geprägt hatte, erinnerte Bär an die Sängerin, die jetzt, die Uhr zeigte 20.53, wenn die Oper nicht ausgefallen wäre, als Donna Anna die Rachearie beginnen würde: du kennst den Verräter!
Mickel verknüpft die verschiedenen Handlungsstränge (Bärs Ankunft in Berlin; den geplanten Opernbesuch; seine Verwicklung in die Ereignisse des 17. Juni, deren Deutung durch seinen Lehrer Kirpse sowie die Interpretation des Don Giovanni) auf eine surreale Weise miteinander. Das Ganze mündet in einen – angesichts der Situation – skurrilen, durchaus komischen, auf jeden Fall aber gelehrten Dialog unter den Gruppenmitgliedern, in dessen Verlauf Bär seine Lektüre eines Zeitschriften-Artikels über Don Giovanni referiert:
Bär: Die jüngste Nummer der Zeitschrift Säule und Sockel, ihr kennt sie, enthält eine Rezension von Einsiedel –
Ilse: Wer ist Einsiedel?
Bär: über Dieckmanns Don-Juan Buch. – Niemand hat Einsiedel je gesehn. Er soll anständig durch die scheußlichen Jahre gekommen sein und jetzt unter Pseudonym, als Dramaturg an einem Mundart-Theater, eine bürgerliche Existenz fristen. – Dieckmanns Opus habe ich noch nicht vor Augen gehabt; Einsiedel lobt es stark. Die Fabel der Mozart-Oper muß ich ja nicht referieren.
Barthel (rappelnd und brummend): Nee. Keen Referat nich. Die quatschen Opern genuch.
Bär (weitläufig): Referieren bedeute verknappt berichten, gleichsam in Regestenform übermitteln, das heiße, die entkleidete Substanz vorweisen.
Ilse: Was steht denn in dem Buch über diesen Don Juan? Ist es dick? Sind Bilder drin?
Bär: Portraits der Autoren und zeitgenössische Stiche diverser Aufführungen. – Dieckmann, sage Einsiedel, und das sei eine rare Tugend, könne erzählend analysieren. Als säße er bei uns und läse uns die Fragen von den Augen ab. Er bestimme soziologisch genau, wogegen der Protagonist jeweils rebelliere, welche strukturell-ästhetischen Lösungen dies provoziere. Die subtilen Beziehungen zwischen Autoren, Monarchen und Schranzen schienen ihm, Einsiedel, so einsichtig dargestellt, dass der Leser argwöhnen müssen, der Verfasser sei den Mächten innig vertraut gewesen. Anekdotisches, wovon auch der umfängliche Apparat wimmele, sei wahrhaftes Fleisch der Historie. – Ohne Kenntnis des Buchs dürfe künftig kein Don-Juan-Stück inszeniert werden.
Die scharfsinnige Interpretation des Mozartschen Werkes, seiner Entstehungsbedingungen und vieler Details enthält Implikationen, die sich durchaus auf Mickels Intentionen beziehen lassen. Auch er versucht soziologisch genau zu analysieren und sucht nach strukturell-ästhetischen Lösungen für die dargestellten Kontexte. Überaus belesen scheint der Autor gewesen zu sein. So reiht er eine gelehrte Ausführung an die nächste; Zitate aus den verschiedensten Bereichen finden sich so zahlreich, dass man zuweilen Schwierigkeiten hat, den Zusammenhang zu vergegenwärtigen: Zitiert wird z.B. aus dem Offiziellen Lehrbuch des Tischtennis-Verbandes; aus der Geschichte der Wettinischen Territorialherrschaft; daneben finden sich Anleitungen zum Boxkampf oder detaillierte Beschreibungen zum Handballsport; aber auch philosophische oder volkswirtschaftliche Abhandlungen, oder ein überaus kenntnisreicher Goethe-Essay.
Eine überaus lesenswerte Abhandlung findet sich im vierten Kapitel des zweiten Teils. Es enthält eine sozialästhetische Studie unter dem Titel Naturform und Menschenwerk. Ein Versuch, den gegenwärtigen Begriffsinhalt des Wortes „Landschaft“ zu bestimmen. Im Petrarca-Kapitel findet sich eine Definition dessen, was Lachmund (Mickel) unter Landschaft versteht: Das Wort Landschaft meint nicht die außermenschliche Natur: der Begriff bezeichnet menschlich vermittelte Natur; wo Naturform und Menschenwerk einander weiträumig, stereometrisch durchdringen, gestaltet sich das, was wir Landschaft nennen. Alsdann werden Genres wie Malerei, Literatur, Musik, Gartenbau, Industrie, Theater und Bühnenbild nach dem Landschaftsbegriff durchforstet.
Die vielfältigsten und scheinbar willkürlich aufgeführten Reflexionen und Erinnerungen der Freunde werden bis ins Detail durchgespielt und mitunter auch dialogisch abgehandelt, so dass sich ein bunter Reigen aus Anekdoten, Farcen und witzigen Einfällen entfaltet, der einen in Atem hält. Wer mithin eine stringente, sich sukzessive entwickelnde Fabel zu finden hofft, sucht bei Mickel vergebens. Dafür aber erhält er ein Feuerwerk an Geistesblitzen, intelligenten Erörterungen und überraschenden Kehrtwendungen.
Völker berichtet, Mickel sei sehr daran gelegen gewesen, dass sein Roman als work in progress verstanden werde – als eine Kollektion Bärischer Gedanken, poetischer Kleinigkeiten, geharnischter Nachrichten, launiger Abmahnungen, wahnsinniger Sprünge, Entwürfe, Miszellen, Summula nach Art Jean Pauls, Kreuz- und Querzüge.
Wiederum nur beispielhaft die folgende Disputation der Freunde Bär und Amboß (alias Hammer) über die Bedingungen eines unentschiedenen Ausgangs eines Boxkampfes. Der Kampfsport Boxen ist eines der zentralen Motive des Romans: das Leben als Kampf? Oder Körperertüchtigung als Ergänzung zur geistigen Tätigkeit – als Element der allseitigen Entwicklung des sozialistischen Menschen? Mickel ironisiert die aufgesetzten Losungen der Politik auf seine Weise: Im Anschluß an eine eher harmlose Rangelei zwischen Amboß und Bär, die von Kommilitonen unterbrochen wird, diskutieren die Freunde über Modalitäten und den unentschiedenen Ausgang ihrer Auseinandersetzung. Sie suchen offenbar nach einer Lösung, mit der sie beide leben können:
Amboß und Bär hatten die theoretischen Weiterungen ihrer albernen und dilettantischen Prügelei weder gelöst noch vergessen. Der Kampf musste ja erst wirklich ausgetragen werden; dafür waren Bedingungen zu schaffen, welche dem Resultat die unumstößliche Beweiskraft sicherten. Trübende Zufälle mussten ferngehalten werden. Damit war auch das Ziel des Fights neu definiert. Es ging fürderhin nicht um brachiales Schlichten temporärer und peripherer Kollision, sondern um inneres Wissen. Jedes rechte Verbündnis tritt mächtigem Dritten unverbrüchlich gegenüber; wer was, qualitativ und quantitativ, leisten könne, worauf also Verlaß sei: das sei, unter Berücksichtigung aller wirkenden Faktoren, von vornherein fair und pur zu erforschen und zu fixieren. Zwecks durchdachter Versuchsanordnung konsultierten die Freunde Dr. Sephardy.
Der Gelehrte saß auf einem Küchenstuhl inmitten seiner Bücher und vernahm die Frage: Wie enden Kämpfe, wenn beiden Seiten fehlerlos kämpfen? Er lehnte sich zurück, sodaß der Stuhl nur noch auf den Hinterbeinen stand, hob seine Füße vom Teppich, schlang die Füße (: sie staken in hohen Schnürschuhen, die Socken schlotterten) um die schräg ragenden Vorderbeine des Stuhles, verschränkte die Arme vor der Brust, verharrte so, sann und lobte den hohen Abstraktionsgrad der Frage.
Er meine das Boxen: sagte Hammer.
Bär: Und man unterstelle selbstverständlich die gleiche Gewichtsklasse und nähme an, bestimmte natürliche Vorteile des einen Kombattanten, z.B. bezüglich der Schlagstärke, seien durch andere des Anderen, z.B. der Schnellkraft, ideal kompensiert.
Dr. Sephardy: Boxerischen Auseinandersetzungen habe er zwar nie beigewohnt, könne sich aber denken, es gelte, selbst zu treffen und gegnerische Treffer tunlichst zu hindern.
Hammer: Genau das sei das Problem.
Die Freunde deduzierten nun, im Wechselgesang, die Impossibilität unentschiedenen Ausgangs. Träfen nämlich beide Boxer gleichermaßen, würden folglich beide gleichermaßen getroffen; meide Jeder jeden gegnerischen Schlag, träfe er selbst nie. Das Urteil Unentschieden dokumentiere also bündig Fehler beider Parteien, während ein Siegspruch immerhin Fehlerlosigkeit der einen Partei im Reich des Möglichen belasse. Letztere Asymmetrie sei jedoch nicht gefragt.
Dr. Sephardy (stärker und stärker schaukelnd): Er wolle ad hoc nicht bestimmen, ob hier ein Zenonsches Paradoxon oder eine Kantsche Antinomie vorläge. Er neige jedoch, gefühlsmäßig, zur Ansicht, kein denkbares Koordinatensystem umgreife den Casus. Auch eine Kollision zweier Systeme läge nicht vor, da ja gemeingültige Vorgaben gesetzt wären. Ein Chaos, welches aber mit sich selbst nicht kämpfe: und das sei gänzlich widersinnig. Das schlechthin Andere. Furchtbar. – Vielleicht möchten subtilste Winkelzüge der Spieltheorie einen Strohhalm erspüren. Abscheulicherweise streife die Vorstellung multiplen fehlerfreien Handelns den Begriff Vollkommenheit, und das boxerische Gedankenexperiment verpflichte diesen dem Chaos.
Amboß: Ob man nicht einfach zwei perfekte Kämpfer aufeinandertreffen und die Praxis entscheiden lassen solle?
Bär: Woran, ohne vorangegangenem Kampf, misst du die Perfektion?
Dr. Sephardy: Empirismus? – nein. Die bestgeplante endliche Versuchsserie bereitet auch lediglich einen induktiven Schluß vor, der Allgemeingültigkeit nie und nimmer beanspruchen kann. – (Rufend:) Frau Walther! (Frau Walther kommt.) Bestellen Sie doch bitte die Leibniz-Akademie-Edition. Ja, alle siebenundvierzig Bände. Auf meinen Namen, für die jungen Männer. (Frau Walther ab; zu Bär und Amboß:) Fernleihe. Es wird etwa 3 Wochen dauern. Bis dahin regenerieren Sie Ihr Latein und Ihr Französisch. Weil Leibniz, das wissen Sie ja aus der Grundschule, dem Vollkommenen spieltheoretisch das Fell krault. Sie können mich jederzeit anrufen.
Der Stuhl senkte die Vorderbeine, Dr. Sephardy löste die Knöchel; die Studenten strebten rasch dem nächsten tüchtigen Biere zu.
Die Freunde beschließen, sich Boxkämpfe anzuschauen und sich von einem intelligenten Boxer die Grundbegriffe des Boxens erklären zu lassen. Und dann folgt eine der denk-würdigsten Passagen des Romans: Als die Freunde eine Sporthalle betreten, entdecken sie in der Vorhalle Säulen; Betonguß-Statuen; nackte Männer mit Karabinern und bekleidete mit Schwertern. Auf dem Vorplatz Marmor, auf den Kinder Himmel und Hölle gekritzelt haben. Sturm war aufgesprungen; eine Stadt-Taube steuerte den Himmel an und suchte daselbst zu fußen. Sie schwebte 2 cm über der harten Ebene; sie faltete die Flügel halb ein, je jewölbter die Wölbung, desto festeren Sturm fing sie; der Vogel berührte den Boden, seiner Anstrengung wegen, nicht. Der Vorgang währte 57´´ (stoppte Hammer) dann trieb das Tier rückwärts hoch und ab.
Unmittelbar danach zitiert Mickel die berühmte Passage aus den Geschichtsphilosophischen Thesen Walter Benjamins: Es gibt ein Bild von Klee, das Angelus Novus heißt. Ein Engel ist darauf dargestellt, der aussieht, als wäre er im Begriff, sich von etwas zu entfernen, worauf er starrt. Seine Augen sind aufgerissen, sein Mund steht offen, und seine Flügel sind ausgespannt. Der Engel der Geschichte muß so aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm.
Deutet diese Text-Montage darauf hin, dass auch Mickel das Kontinuum der Geschichte als Katastrophe deutet? Dass er spürt, dass der Sozialismus à la DDR gescheitert ist? Wir können es nur vermuten. Völker weist zurecht daraufhin, dass der Roman weder eindeutig ist, noch das Benjaminsche Denkbild erzählerisch einlöst. Stellen wie diese verweisen jedoch auf einen dunklen, skeptischen Grundton, der sich zuweilen in schwarzem Humor ergeht. Der Roman gleicht überhaupt einem Aggregat, hält das Erzählte im Zustand der Unvollständigkeit, des Versuchsspiels. Er provoziert uns, selbst zu entdecken und zu explizieren.
Vor diesem Hintergrund deutet Völker den Lachmund-Mickelschen Goethe-Essay als einen Schlüsseltext des Romans: Literatur wird wichtig und bleibt wichtig, wenn sie ihre Gegenstände und die gesellschaftlichen Gegebenheiten, die sie reflektiert, nicht harmlos verplaudert, sondern lieber durch das, was sie schweigend ausspart, beredt Zeugnis ablegt, wenn sie das, was das Experiment Sozialismus einst ausgemacht oder sich vorgenommen hat, doch durch menschliches Unvermögen, Machtmissbrauch oder pragmatische Unvernunft bis zur Unkenntlichkeit auf den Hund gekommen ist, subversiv kenntlich zu machen versucht. Und hohnlachend Trauer bekundet über die zunehmenden Verluste bei der Umsetzung sozialer Utopien.
Mickel bedient sich eines Kunstgriffs, um seine Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse der DDR in einen historischen Kontext zu stellen: indem er die Goethe-Zeit als Teil der gegenwärtigen Welt begreift, konfrontiert er die Gegenwart der DDR-Verhältnisse mit Bruchstücken utopischer Perspektiven, wie sie einmal vorhanden gewesen sein mögen. Mickel analysiert in seinem Essay u.a. den eigenständigen, dem Zeitgeist widerstrebenden Charakter der Goetheschen Dichtung: Goethes lyrische Reaktion auf die sog. Befreiungskriege, welche die deutschen Staaten mit Chauvinismus und dumpfem Freiheitsstreben überschwemmten, gipfelten in einer Art blasphemischer Verspottung und Missachtung derselben. Alle schlechten Dichter Deutschlands dichteten Schlachtgesänge; Goethe blieb, was ihm seit früher Jugend vorgeworfen worden war: kalt und schockierend; er erklärte die glorreichen Siege über den Mann, den, neben wenigen, sich ranggleich erachtete, schlankweg für langweilig.
Und etwas später heißt es: Goethe macht sich, indem er die Kriegsbegeisterung der Deutschen, namentlich die Begeisterung der deutschen Jungfrauen für deutsche Helden, zu teilen vorgibt, über alles lustig und hält den Schein der Oberflächlichkeit, welcher in Wirklichkeit böser Zynismus ist, Jahre hindurch.
Mickel verweist darauf, dass Goethe in den kriegerischen Zeiten höchste Produktivität entwickelt; er hätte, wie Brecht in unserm Jahrhundert, ausrufen können: „Wahrlich, ich lebe in finsteren Zeiten!“ und „In den finsteren Zeiten/Wird da auch gesungen werden? /…/ Von den finsteren Zeiten.“ Goethe sang nicht von den finsteren Zeiten. – Goethe liebte es überhaupt, den Untergrund seiner Dichtungen, namentlich wenn er unmittelbar entsetzlicher oder sonst sozialer Art war, lediglich ahnen zu machen.
Dies könnte auch die Maxime des Mickelschen Schreibens sein. Wie Goethe dürfte auch ihm missfallen haben, aus einer ästhetischen Sache eine Parteisache zu machen und mich auch als Parteigesellen heranzuziehen, ohne zu bedenken, dass man recht gut über eine Sache spaßen und spotten kann, ohne sie deswegen zu verachten und zu verwerfen. Und noch ein ästhetisches Prinzip Goethes dürfte sich Mickel zu eigen gemacht haben: Das Benutzen der Erlebnisse ist mir immer alles gewesen; das Erfinden aus der Luft war nie meine Sache: ich habe die Welt stets für genialer gehalten als mein Genie … das ´benutzte´ Erlebnis ist mehr als das Erlebnis, das Kunstwerk keine platt-quantitative Verdopplung des Faktischen.
Der Goethe-Essay ist deshalb so aufschlussreich für das Verständnis Mickels, weil hier ästhetische Kriterien entwickelt werden, die für das Verständnis des Romans von großer Bedeutung sind. Denn: Die Produktivkraft des Dichters und das Material, worin sie sich ausdrückt, war entscheidend von äußern Umständen abhängig; die Lähmung, die von den deutschen Zuständen stetig ausging, wusste er durch Umgang mit gebildeten, vielfältigen und an konkreten Gegenständen arbeitenden Freunden sowie sonstigen Gästen immer wieder partiell aufzuheben. Das ist auf Goethe gemünzt; lässt sich aber genau so gut auf Mickel beziehen. Lachmunds Freunde sind gebildete und an konkreten Gegenständen arbeitende Leute, die hungrig sind auf Erfahrungen und Erkenntnisse, die die Wirklichkeit für sie bereithält. Dieser subjektive Aspekt ist zu trennen vom Gelingen des sozialistischen Experiments. Ja – man könnte sogar sagen, dass dadurch ein Spannungsbogen entsteht, der große Literatur ihr Material verdankt. Oder in Goethes Worten formuliert: Hier gelingt es, sociale Verhältnisse und die Konflikte derselben symbolisch gefasst darzustellen.
Ein weiterer Zugang zum Roman erschließt sich dadurch, dass man viel über Innenansichten des Arbeits- und Lebensraums DDR erfährt. Insofern betreibt Mickel Biotoperkundung; und zwar aus eigener Anschauung und eigenem Erleben. Die drei Freunde, die im Mittelpunkt des Romans stehen, verfolgen je ihre eigenen individuellen Ziele. Aber es gibt Schnittmengen zwischen ihnen, und das ist ihr eigentlicher Kommunikationsraum – und das erklärt auch, dass sie allen Konflikten und Missverständnissen zum Trotz Freunde bleiben. Eine Besonderheit des Romans besteht nun darin, dass Mickel den Bildungsweg der Freunde nicht aus deren Perspektive von unten nachzeichnet – sie kommen allesamt aus einfachen Verhältnissen; sondern Mickel schaut aus der Perspektive der Hochkultur auf die Verhältnisse. Aufgrund dieses Blickwinkels gelingt es ihm, Fehlentwicklungen und Verzerrungen in der Realität überaus scharf wahrzunehmen, ihnen aber auch eine gewisse Komik, vor allem aber ein Maß an Distanz abzugewinnen, die dem Roman über weite Strecken eine frappierende Leichtigkeit verleiht. Der Parforceritt durch alle möglichen Wissens- und Lebensbereiche, verlangt dem Leser viel ab; jedoch Mickel auf diesen anspruchsvollen Exkursion zu folgen, mag zwar anstrengend sein, macht aber auch den Reiz dieses ungewöhnlichen Lesevergnügens aus.
Bildquelle: https://www.wallstein-verlag.de/9783892449997-karl-mickel-lachmunds-freunde.html