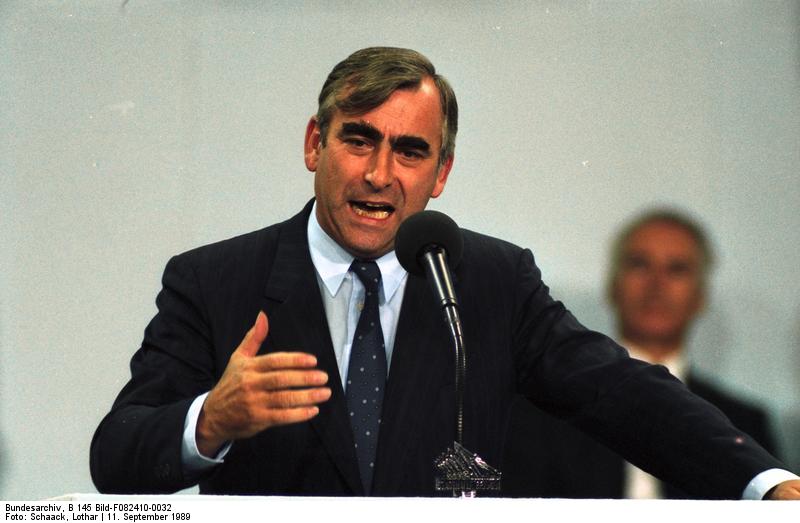Warum reist man ins Baskenland? Die Frage stellt sich der Zeitgenosse, die Frage wird ihm gestellt, denn zum Baden und Sonnen fährt der Tourist nach Mallorca, Valencia oder Malaga. Aber was weiß man schon vom Baskenland, von den Basken? Vorweg das mit der Mütze: Es gibt sie in Geschäften für Touristen in vielen Farben, der eine oder andere ältere Baske trägt sie auf dem Kopf, aber im Straßenbild taucht sie so gut wie nicht auf. Das mit der ETA haben wir in Deutschland über Jahrzehnte verfolgt, ihre tödlichen Anschläge haben uns erschreckt, der Kampf um Unabängigkeit dieses Völkchens hat uns aber nicht sehr beschäftigt. Guernika, der Name steht für den mörderischen Krieg, den der Diktator Franco durch die deutsche Luftwaffe namens „Legion Condor“ über diese Kleinstadt brachte und sie in Schutt und Asche legte. Aber wo in Europa hat Nazi-Deutscland nicht seine häßlichen Spuren hinterlassen? Kulturelle Höhepunkte des Baskenlandes, so der Titel des Reiseprogramms und der verspricht nicht zu viel von jenem Flecken Europas, der in knapp zwei Stunden zu erreichen ist, das uns aber so fern liegt, weil wir es nicht kennen.
Warum reist man ins Baskenland? Die Frage stellt sich der Zeitgenosse, die Frage wird ihm gestellt, denn zum Baden und Sonnen fährt der Tourist nach Mallorca, Valencia oder Malaga. Aber was weiß man schon vom Baskenland, von den Basken? Vorweg das mit der Mütze: Es gibt sie in Geschäften für Touristen in vielen Farben, der eine oder andere ältere Baske trägt sie auf dem Kopf, aber im Straßenbild taucht sie so gut wie nicht auf. Das mit der ETA haben wir in Deutschland über Jahrzehnte verfolgt, ihre tödlichen Anschläge haben uns erschreckt, der Kampf um Unabängigkeit dieses Völkchens hat uns aber nicht sehr beschäftigt. Guernika, der Name steht für den mörderischen Krieg, den der Diktator Franco durch die deutsche Luftwaffe namens „Legion Condor“ über diese Kleinstadt brachte und sie in Schutt und Asche legte. Aber wo in Europa hat Nazi-Deutscland nicht seine häßlichen Spuren hinterlassen? Kulturelle Höhepunkte des Baskenlandes, so der Titel des Reiseprogramms und der verspricht nicht zu viel von jenem Flecken Europas, der in knapp zwei Stunden zu erreichen ist, das uns aber so fern liegt, weil wir es nicht kennen.
Beginnen möchte ich mit der ETA. Unsere Reiseleiterin hatte uns ein Buch ans Herz gelegt, das der in Hannover lebende Baske Fernando Aramburu geschrieben hat. „Patria“ hat er es genannt, Heimat, seine Heimat. Der Schriftsteller stammt aus San Sebastian und er beleuchtet, wie es im Klappentext des 750-Seiten langen Werkes heißt, über 30 Jahre dunkler baskischer und spanischer Geschichte, blutüberströmt, ein Roman über „Schuld und Vergebung, Freundschaft und Liebe, der zeigt, wie Terrorismus den inneren Kern einer Gemeinschaft angreift und wie lange es dauert, bis die Menschen wieder zueinander finden“. Ein Roman, der gleich zu Beginn das Ende der ETA erwähnt, das Ende eines Albtraums für viele Basken, ein Weg der Hoffnung. Das Fernsehen berichtet darüber, dass sie den Kampf einstellen, die Waffen niederlegen, heißt es in dem Buch. Und der Autor stellt in den Raum, was man heute noch an Häuserwänden und Fenstern als Klage, Anklage lesen kann: „Und die Gefangenen sollen weiter im Gefängnis schmachten.“ Sie sollen nach Hause, frei sein. Nach all den Jahren hinter Gittern.Sagen die einen, andere bleiben in Rachegedanken.
ETA- die Aussöhnung mit Tätern
Das Thema ETA beschäftigt Spanien, der Tourist bekommt davon wenig mit. Also lese ich in „Patria“ vom Fall des Joxe Mari, 43 Jahre alt, 17 davon im Gefängnis. Er entsagte der ETA in der Zelle, weil er die Genossen verstanden habe, die er anfangs als Deserteure betrachtet habe. Es ist vorbei und er sinniert noch darüber, über die Wunden, die er geschlagen hatte. „Weswegen? Die Antwort erfüllte ihn mit Bitterkeit: wenig. nichts. Nach all dem Blut kein Sozialismus, keine Unabhängigkeit, gar nichts. Er war zu der tiefen Überzeugung gelangt, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.“
Aramburu geht es um die Frage, ob über alle Schrecken hinweg eine Aussöhnung mit den Tätern von früher möglich ist. Sie muss sein. Aramburu lässt in seinem ergreifenden und zugleich spannenden Roman einen Basken die Aussage treffen: „Wir alle sind Opfer.“ Der Autor gab den Opfern des Terrors .eine Stimme. Das Buch beschreibt, wie der Terror aus befreundeten verfeindete Familien machte, wie er einen Riss durch die Gesellschaft trieb.
Rund 90 Terroristen der ETA sitzen noch in Gefängnissen, einige schon 25 Jahre. Die Loslösung von Spanien war ihr Traum. 2011 hat die ETA ihren blutigen Unabhängigkeitskampf für beendet erklärt, nach 4000 Anschlägen mit 864 Toten. Seit 1959 hatte die Separatisten-Organisation mit Waffengewalt für ein selbstbestimmtes, politisch souveränes „Euskal Herria“ gekämpft, ein autonomes Baskenland.
Angriff auf Guernika ein Verbrechen
 Nicht unschuldig an der Entwicklung war General Franco, der die Basken nicht mochte, später deren Sprache verbot, deren Unabhängigkeitsbestreben unterdrückte und der 1937 Hitler-Deutschland zu Hilfe rief. Die „Legion Condor“ unter Leitung von General von Richthofen-ein treuer Gefolgsmann Hitlers- warf am 26. April 1937 tonnenweise Bomben-es sollen 7000 gewesen sein- auf die Kleinstadt Guernica, es war ein Angriff auf eine unbewaffnete Stadt ohne Bunker, auf Zivilisten. Die Piloten knallten auch mit Maschinengewehren Zivilisten ab wie die Hasen. Es mögen 1000 bis 1500 Menschen getötet worden sein, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Richthofen macht anschließend Karriere, er wird Deutschlands jüngster Feldmarschall. Nach einer Ortsbesichtigung am 3. April 1937, dem Tag der Einnahme der Stadt diurch Francos Milizen, schreibt er in sein Tagebuch: „Buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Einfach toll.“ Einen Monat später korrigiert er seinen Jubel in einem Schreiben an einen Freund: „Ich hatte mich bei Guernika wohl etwas rüpelhaft benommen.“ Nicht nur er, auch andere seiner Fliegerstaffel ließen ihre Mentalität des arischen Herrenmenschen erkennen. Ein junger Pilot notiert vor dem Abheben, um zur Zerstörung anzusetzen: „Ein Gefühl unbeschränker Macht. Es ist die absolute Erregung und Befriedigung.“ Mich macht es fassungslos.
Nicht unschuldig an der Entwicklung war General Franco, der die Basken nicht mochte, später deren Sprache verbot, deren Unabhängigkeitsbestreben unterdrückte und der 1937 Hitler-Deutschland zu Hilfe rief. Die „Legion Condor“ unter Leitung von General von Richthofen-ein treuer Gefolgsmann Hitlers- warf am 26. April 1937 tonnenweise Bomben-es sollen 7000 gewesen sein- auf die Kleinstadt Guernica, es war ein Angriff auf eine unbewaffnete Stadt ohne Bunker, auf Zivilisten. Die Piloten knallten auch mit Maschinengewehren Zivilisten ab wie die Hasen. Es mögen 1000 bis 1500 Menschen getötet worden sein, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Richthofen macht anschließend Karriere, er wird Deutschlands jüngster Feldmarschall. Nach einer Ortsbesichtigung am 3. April 1937, dem Tag der Einnahme der Stadt diurch Francos Milizen, schreibt er in sein Tagebuch: „Buchstäblich dem Erdboden gleichgemacht. Einfach toll.“ Einen Monat später korrigiert er seinen Jubel in einem Schreiben an einen Freund: „Ich hatte mich bei Guernika wohl etwas rüpelhaft benommen.“ Nicht nur er, auch andere seiner Fliegerstaffel ließen ihre Mentalität des arischen Herrenmenschen erkennen. Ein junger Pilot notiert vor dem Abheben, um zur Zerstörung anzusetzen: „Ein Gefühl unbeschränker Macht. Es ist die absolute Erregung und Befriedigung.“ Mich macht es fassungslos.
 Im so genannten Friedensmuseum kann der Tourist die Folgen der tödlichen Angriffe deutscher Flieger sehen. Man schämt sich als Deutscher, wenn man diesen Ort betritt, wenn man liest, wie er systematisch binnen weniger Stunden buchstäblich rasiert wurde. Es waren Tausende Menschen in dieser kleinen Stadt, es war Markttag, die Basken waren zum Einkaufen unterwegs, es gab so gut wie keinen Schutz gegen die Flieger mit ihrer mörderischen Fracht. Der Angriff der „Legion Condor“ war für Hitler und Göring ein Test, um zu erkunden, was Jahre später dann mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Tat umgesetzt wurde: der Vernichtungskrieg mit Bomben gegen Zivilisten, das in Schutt-und-Asche-legen von Städten, ohne Rücksicht auf Verluste. Zunächst versuchten Francos Leute die Zerstörung Guernikas der Opposition anzulasten, also den Basken in die Schuhe zu schieben.
Im so genannten Friedensmuseum kann der Tourist die Folgen der tödlichen Angriffe deutscher Flieger sehen. Man schämt sich als Deutscher, wenn man diesen Ort betritt, wenn man liest, wie er systematisch binnen weniger Stunden buchstäblich rasiert wurde. Es waren Tausende Menschen in dieser kleinen Stadt, es war Markttag, die Basken waren zum Einkaufen unterwegs, es gab so gut wie keinen Schutz gegen die Flieger mit ihrer mörderischen Fracht. Der Angriff der „Legion Condor“ war für Hitler und Göring ein Test, um zu erkunden, was Jahre später dann mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs in die Tat umgesetzt wurde: der Vernichtungskrieg mit Bomben gegen Zivilisten, das in Schutt-und-Asche-legen von Städten, ohne Rücksicht auf Verluste. Zunächst versuchten Francos Leute die Zerstörung Guernikas der Opposition anzulasten, also den Basken in die Schuhe zu schieben.
Der Angriff der Legion Condor wurde an den in Paris weilenden Pablo Picasso übermittelt, der seine Arbeiten für ein großes Werk für die Weltausstellung sofort einstellte und das Monumentalgemälde „Guernika“ malte, mit dem er die Faschisten und deren tödliche Politik anprangerte. Das Werk- das Original hängt im Museo Reina Sofia in Madrid- ist als Kopie in vielen Teilen der Welt zu sehen, auch in Guernika selbst. Als wir das Bild betrachteten, stürmten Schulkinder auf das Gemälde Picassos zu und setzten sich unter Lachen und Kichern vor das Werk, das eigentlich zur Ruhe mahnt. Aber die Schülerinnen und Schüler waren unbekümmert. Man kann nur hoffen, dass sie das Thema später in der Schule erörtert haben.
Ausgestreckte Hand der Deutschen
Erst 1996, zum 60. Jahrestag der Zerstörung der Stadt, hat sich die Bundesrepublik durch ihren Botschafter zum Kriegsverbrechen bekannrt und die Überlebenden um Versöhnung gebeten. Die wenigen Überlebenden haben die ausgestreckte Hand der Deutschen gern ergriffen, wie man in Guernika nachlesen kann. Auch ein Nachkomme Wolfram von Richthofens, Dieprand von Richthofen, hat sich mit Überlebenden des Infernos getroffen. Er fand öffentliche Worte der Scham und des Mitgefühls. Und er wirkte mit, als am 26. April 2017 junge Basken, Enkel der Betroffenen, wie jedes Jahr eine Alarmsirene mahnend zum Krieg und Kriegsverbrechen heulen ließen.
Warum wurde Guernika zerstört? Weil es die heilige Stadt der Basken ist, das Symbol für das Streben der Basken nach Unabhängigkeit bedeutet. In Guernika ist der Sitz des Parlamensgebäudes mit dem Sitzungssaal für die Versammlungen der Provinzregierung der Biskaya. Vor dem Gebäude wächst ein mythischer Baum, der Rest einer Eiche, der als Wahrzeichen für die baskischen Gesetze und Freiheiten gilt. Er wurde beim Angriff auf die Stadt nicht getroffen, wie auch das Parlament nicht, die in der Nähe stehende Kirche wurde leicht beschädigt. Hinter dem Rest der Eiche erstreckt sich der Park der Völker Europas mit Statuen von Henry Moore und Eduardo Chillida. Am Plaza de los Fuentos ist auch die Statue von Don Tello zu besichtigen, der die Stadt Guernika im Jahre 1366 gegründet hatte. Seit dem Mittelalter versammelte sich der Ältestenrat im Schatten der Eiche. Die Könige Kastiliens schworen unter dem Baum, die Autonomie der Basken zu achten und zu wahren.
Aber das Baskenland ist mehr als ETA und Guernika, es ist das grüne Spanien, in dem es genügend regnet und in dem die Sonne zwar auch reichlich scheint, aber das Land nicht verbrennt, eine Region mit Landwirtschaft, mit Wein und Olivenbäumen, mit schönen Tälern und Gebirgen. Es ist ein Landstrich voller idyllischer Dörfer und geschichsträchtiger Städte mit Kathedrahlen, Klöstern und Bodegas. Das Weinanbaugebiet Rioja ist hier im Baskenland. Es wird Wein angebaut auf jedem Quadratmeter, man sieht kleine Weinstöcke von vielleicht 30 cm Höhe so weit das Auge reicht.
Guggenheim-Museum statt Werften
 Wir begannen unseren Trip in Bilbao, eine Stadt am Fluss, die eine erstaunliche Verwandlung hinter sich hat. Im Ruhrgebiet spricht man von einem Strukturwandel. Die einstige Industriestadt Bilbao ist zu einer Metropole geworden, die einstigen Werften und Hochöfen sind mit wenigen Ausnahmnen modernen Bauten entlang des Flusses gewichen, vor allem das Guggenheim-Museum-ein Meisterwerk des Architekten Frank O. Gehry- hat die neue Landschaft geprägt, vieles nach sich gezogen, man kann durchaus von einer Stadterneuerung sprechen, davon, dass sich Bilbao neu erfunden hat. Von der einst grauen Industriestadt ist heute nur noch wenig zu sehen, die Schwerindustrie hat Dienstleistungsbereichen Platz gemacht, Bilbao ist eine lebens- und liebenswerte Kunst- und Kulturstadt mit Lebensqualität geworden. Touristen sollten sich für die rund 350000 Einwohner zählende Stadt ein wenig Zeit nehmen. Es lohnt sich, nicht nur der Blick auf das Guggenheim-Museum, auch Brücken und renovierte, ja wunderbare Häuserfassaden ziehen den Besucher an. Ein Besuch der Altstadt sollte nicht fehlen und anstelle eines größeren Menues reicht oft der Gang in eines der Pintxos-Bars, in denen Schinken aller Art, Wurst, Fisch, Käse, Gemüse auf Weißbrot gereicht werden, dazu ein Rueda-Weißwein oder ein Crianza-Roter und wer mehr ausgeben möchte, bestellt sich einen Grand Reserva, alles kann man zu überschaubaren Preisen genießen.
Wir begannen unseren Trip in Bilbao, eine Stadt am Fluss, die eine erstaunliche Verwandlung hinter sich hat. Im Ruhrgebiet spricht man von einem Strukturwandel. Die einstige Industriestadt Bilbao ist zu einer Metropole geworden, die einstigen Werften und Hochöfen sind mit wenigen Ausnahmnen modernen Bauten entlang des Flusses gewichen, vor allem das Guggenheim-Museum-ein Meisterwerk des Architekten Frank O. Gehry- hat die neue Landschaft geprägt, vieles nach sich gezogen, man kann durchaus von einer Stadterneuerung sprechen, davon, dass sich Bilbao neu erfunden hat. Von der einst grauen Industriestadt ist heute nur noch wenig zu sehen, die Schwerindustrie hat Dienstleistungsbereichen Platz gemacht, Bilbao ist eine lebens- und liebenswerte Kunst- und Kulturstadt mit Lebensqualität geworden. Touristen sollten sich für die rund 350000 Einwohner zählende Stadt ein wenig Zeit nehmen. Es lohnt sich, nicht nur der Blick auf das Guggenheim-Museum, auch Brücken und renovierte, ja wunderbare Häuserfassaden ziehen den Besucher an. Ein Besuch der Altstadt sollte nicht fehlen und anstelle eines größeren Menues reicht oft der Gang in eines der Pintxos-Bars, in denen Schinken aller Art, Wurst, Fisch, Käse, Gemüse auf Weißbrot gereicht werden, dazu ein Rueda-Weißwein oder ein Crianza-Roter und wer mehr ausgeben möchte, bestellt sich einen Grand Reserva, alles kann man zu überschaubaren Preisen genießen.
 Die Fahrt mit dem Bus führte uns dann durch das Rioja-Gebiet mit einer Weinverkostung in einer der ältesten Bodegas in Laguardia, einer historischen Kleinstadt, auf einem Hügel liegend und umgeben von einer Mauer, mit der sich die Bewohner einst vor Angriffen schützten.
Die Fahrt mit dem Bus führte uns dann durch das Rioja-Gebiet mit einer Weinverkostung in einer der ältesten Bodegas in Laguardia, einer historischen Kleinstadt, auf einem Hügel liegend und umgeben von einer Mauer, mit der sich die Bewohner einst vor Angriffen schützten.
Laguardia liegt mitten in den Weinbergen, ein Spaziergang durch die mittelalterlichen Gassen gibt einen Eindruck von dieser Kleinstadt mit ihren vielen Bars, in deinen Wein und Pintxos angeboten werden. Ein Merkmal der Stadt sind die Tunnels, die einst unter der Stadt gegraben wurden, damit sich die Einwoher in Sicherheit bringen konnten, Öffnungen sollten im Falle des Falles den Bewohnern die Chance zur Flucht aus der Stadt ermöglichen. Die Tunnels werden heute zur Lagerung von Wein genutzt.
Etwas mehr als 120 Kilometer entfernt liegt San Millan de la Cogolla, bekannt durch seine Klöster, die heute UNESCO-Weltkulturerbe sind. Das Augustinerstift von Yuso gilt als Wiege der spanischen Sprache. Übrigens sind alle die Ortschaften am Jacobsweg gelegen, Pilger begegnen uns täglich an jedem Ort und beinahe zu jeder Zeit, oft allein mit großem Rucksack unterwegs, hin und wieder wandern sie zu zweit oder in kleinen Gruppen, Basken, Japaner, Deutsche, Franzosen und und und. Bis zu ihrem Zielort Santiago di Compostella sind es noch einige Hundert Kilometer. In jedem Ort sieht man kleine Gasthöfe, in denen die Pilger preiswert übernachten können.
Kirche war Küche und Herberge
 Die Stadt Burgos ist das nächste Ziel unserer Reise, eine alte Stadt, die schon im Jahre 850 eine wichtige Festung war im Kampf gegen die Mauren. Im 11. Jahrhundert wurde Burgos Krönungsstadt der Könige von Kastilien. Burgos hat eine sehr schöne Fußgängerzone mit vielen Cafes und Bars. Hier werden die Heldentaten des El Cid besungen, er stammt aus der Nachbarschaft von Burgos. Die Kathedrale der Stadt wirkt überladen, der Besucher weiß nicht, wo er zuerst hinschauen soll, so schön und prunkvoll sind die Altäre. Man darf daran erinnern, dass im Mittelalter die Pilger in der Kathedrahle übernachteten, sie haben in der Kirche sogar gekocht, die Bauern trieben ihr Vieh mitten durch die Kathedrale.
Die Stadt Burgos ist das nächste Ziel unserer Reise, eine alte Stadt, die schon im Jahre 850 eine wichtige Festung war im Kampf gegen die Mauren. Im 11. Jahrhundert wurde Burgos Krönungsstadt der Könige von Kastilien. Burgos hat eine sehr schöne Fußgängerzone mit vielen Cafes und Bars. Hier werden die Heldentaten des El Cid besungen, er stammt aus der Nachbarschaft von Burgos. Die Kathedrale der Stadt wirkt überladen, der Besucher weiß nicht, wo er zuerst hinschauen soll, so schön und prunkvoll sind die Altäre. Man darf daran erinnern, dass im Mittelalter die Pilger in der Kathedrahle übernachteten, sie haben in der Kirche sogar gekocht, die Bauern trieben ihr Vieh mitten durch die Kathedrale.
Über Estella, einer gut erhaltenen Altstadt mit Bürgerhäusern und Adelspalästen geht es über die Kapelle von Eunate mitten im Feld nach Puente la Reina, auch hier sind prachtvolle Kirchenbauten zu bewundern wie Brücken. Man muss es anschauen, man kann es nicht alles beschreiben, das Baskenland ist voller kultureller Höhepunkte, zu denen auch der Ort Olite zählt, wo man den Palast der Könige von Navarra besichtigen kann. Napoleon hatte Olite einst völlig zerstört, man hat es in liebevoller Kleinarbeit wieder aufgebaut. Wir haben dann in einem Klosterhotel des Benediktinerordens von San Salvador de Leyre übernachtet, es liegt mitten im Gebirge, oberhalb eines Stausees, ein idelaer Platz, um von dort Wanderungen zu unternehmen. Wer will, kann den gregorianischen Gesängen der Mönche in der Früh um sechs Uhr oder am Abend nach 19 Uhr lauschen.
Pamplona ist die Stadt der Stierkämpfe, besser des Stierrennens. Sie laufen entlang eines nur für diesen Zweck installierten Zauns durch die Stadt und eine johlende und jubelnde Menge feuert die jungen Männer an, die vor den Stieren davonlaufen. Heute werde darauf geachtet, heißt es, dass diese Männer nicht zu betrunken in die Arena gehen, der Stier lässt nicht mit sich spaßen. Die Szene ist von Ernest Hemingway, der neun Mal hier war, beschrieben worden. In Pamplona trank er im Café Iruna seinen Whiskey. Pamplona ist eine alte Stadt, die einst von Karl dem Großen verwüstet wurde, ehe er sich unter großen Verlusten über die Pyrenäen zurückzog, um gegen die rebellierenden Sachsen zu kämpfen. Das spätbarocke Rathaus ist ein Prachtbau.
Schollenverbundene Basken
 Letzte Station ist das Seebad San Sebastian. Eine Stadt mit wunderschönem Sandstrand, schönen Buchten, einer Altstadt mit Pintxos und vielen kleinen Geschäften, gepflegten Bürgerhäusern, Villen. Auf dem Boulevard entlang des stürmischen Meers wird der Besucher von drei Kunstwerken von Chillida angezogen, tonnenschwere, runde in sich verwundene, rostfarbene Eisenskulpturen, Wind und Wetter ausgesetzt. Die Hauptfigur ähnelt dem Euro-Zeichen, Chillida wurde in San Sebastian geboren. In dieser Windkämme-Skulptur sieht ein Bekannter, der das Baskenland kennt und bereist hat, das baskische Wesen am besten gefasst, wie er schreibt: „Zwar scheinen sie just zu dieser eleganten, ja eher vom europäischen Adel geprägten Stadt am wenigsten zu passen. Doch in der gestalterischen Rohheit, einfachen Klarheit, der Art und der Herkunst des Materials sowie dem Standort fasst für mich diese Skulptur als künstlerische Chiffre die aufrechte, widerstandsfeste, schollenverbundene, freiheitsliebende Natur der Basken am besten zusammen.“
Letzte Station ist das Seebad San Sebastian. Eine Stadt mit wunderschönem Sandstrand, schönen Buchten, einer Altstadt mit Pintxos und vielen kleinen Geschäften, gepflegten Bürgerhäusern, Villen. Auf dem Boulevard entlang des stürmischen Meers wird der Besucher von drei Kunstwerken von Chillida angezogen, tonnenschwere, runde in sich verwundene, rostfarbene Eisenskulpturen, Wind und Wetter ausgesetzt. Die Hauptfigur ähnelt dem Euro-Zeichen, Chillida wurde in San Sebastian geboren. In dieser Windkämme-Skulptur sieht ein Bekannter, der das Baskenland kennt und bereist hat, das baskische Wesen am besten gefasst, wie er schreibt: „Zwar scheinen sie just zu dieser eleganten, ja eher vom europäischen Adel geprägten Stadt am wenigsten zu passen. Doch in der gestalterischen Rohheit, einfachen Klarheit, der Art und der Herkunst des Materials sowie dem Standort fasst für mich diese Skulptur als künstlerische Chiffre die aufrechte, widerstandsfeste, schollenverbundene, freiheitsliebende Natur der Basken am besten zusammen.“
Die Basken- das merkt der Tourist nicht sogleich- gelten als eigenwillig und traditionsbewusst. Uns gegenüber waren sie freundlich, aber selbstbewusst. Wie Wilhelm von Humboldt, dem sie ein Denkmal gesetzt haben, sie beschrieben hat: „Selbst in neueren Zeiten in zwei sehr ungleiche Teile zerrissen und zwei großen und mächtigen Nationen untergeordnet, haben die Basken dennoch keineswegs ihre Selbständigkeit aufgegeben.“ Sie haben ja sogar eine Akademie, die ihre Sprache pflegen und lehren soll. Sie haben Francos Diktatur überlebt, im Baskenland wird baskisch und spanisch gesprochen, die Straßenschilder sind in zwei Sprachen verfasst. In der Schule ist die Grundsprache Spanisch.
Übrigens. An dem Abend, an dem der FC Barcelona gegen den FC Liverpool im Halbfinal-Rückspiel in Liverpool mit 0:4 unterging und damit ausschied, saßen die Basken -oder die Spanier?- vereint und traurig vor dem Fernsehgerät unseres Hotels. Selten habe ich sie in diesen acht Tagen so ruhig erlebt.
Quelle: Fernando Aramburu: Patria. Rowohlt-Verlag Hamburg. 2018. 760 Seiten. ISBN 978 3 49800102 5
Titelbild: Elisabeth Lewe
Bilder im Text: Alfons Pieper