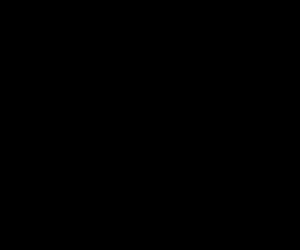In Bayern wird sondiert. Und während der Begriff Sondierungsgespräche nach der Bundestagswahl noch für ein nicht enden wollendes Schauspiel in Schwarz, Gelb und Grün auf dem Balkon stand, bezeichnet er im Freistaat einen kurzen Prozess. Vier Wochen räumt die Verfassung den Parteien für Koalitionsverhandlungen ein. Und dann bleibt wohl alles beim Alten.
Mehr als eine Pflichtübung sind die Gespräche, die die CSU mit allen demokratischen Parteien führen will, nicht. Der Wunschpartner steht mit den Freien Wählern (FW) fest. Schwarz-Orange klingt als neue Farbkonstellation zwar noch nicht so flüssig, wird aber wohl recht geschmeidig zueinander finden. Spezln, wie man in Bayern sagt, unter sich.
Sie kommen aus dem gleichen Stall
Sie kommen aus dem gleichen Stall und sind programmatisch sehr nah beieinander. Die FW sind vielerorts als Abspaltungen der CSU entstanden, ehe sie der ehrgeizige Hubert Aiwanger vor zehn Jahren zum ersten Mal in den Münchner Landtag führte. Das ist eine bayerische Besonderheit. Sogenannte freie Wähler gibt es auch in anderen Ländern, da allerdings nur in den Gemeinderäten, meist von Unzufriedenen aus den jeweils dominierenden Parteien heraus gegründet. Frühe Populisten, wenn man so will, die den innerparteilichen Kampf aufgaben und sich den Wählern vor Ort als neue Kraft andienten – unverbraucht, unverfilzt und parteipolitisch unabhängig.
In Bayern haben sie sich zu einem Landesverband zusammengetan, der aus der Opposition heraus durchaus Dinge bewegte. Eine Kampagne zur Abkehr vom Turbo-Abitur schreiben sich die Freien Wähler ebenso auf ihre Fahnen, wie die Abschaffung der Studiengebühren. Anliegen, die auch andere Landtage beschäftigten, und die nun in Bayern nicht mehr zum Zankapfel werden. Die einzige inhaltliche Kontroverse, die einen Knackpunkt zwischen Schwarz und Orange darstellt, ist der Flughafen München. Die Freien Wähler sagen kategorisch Nein zu einer dritten Startbahn; die CSU will das Projekt durchziehen. Hier braucht die Koalition einen Kompromiss, und sei es ein Aufschieben bis hinter die nächsten Wahlen.
Wenn ein Rebell mitregieren möchte
Zuzutrauen ist ihnen das, denn jede andere Konstellation würde weitaus mehr Kompromissbereitschaft, auch weitaus mehr Umdenken und Neuanfang erfordern. Der Wählerwille mag das verlangen, doch die Beharrungskräfte der Konservativen sind ausgeprägt, Veränderungen unerwünscht. Das kam noch am Wahlabend mit der Formel einer „bürgerlichen Koalition“ zum Ausdruck, die eine Vorfestlegung auf die FW bedeutete. Gerade so, als seien die Grünen nicht auch – zumal in Bayern – eine durch und durch bürgerliche Partei.
„Weiter so“, lautet die Devise von Markus Söder, der Ministerpräsident bleiben will und das Wörtchen „Demut“ in seinen Sprachschatz aufgenommen hat. „Weiter so“, meint auch CSU-Chef Horst Seehofer, der Bundesinnenminister bleiben will, und trotz des Parteivorsitzes behauptet, mit der Landespolitik nichts zu tun zu haben. Und Aiwanger, den einstigen Rebell, scheint es nach zehn Jahren Opposition doch dringend an die Seite der machtverwöhnten CSU zu ziehen.
Spontan forderte er drei Kabinettsmitglieder für seine FW, nach einigem Nachdenken erhöhte er die Zahl auf sechs. Zu billig wollte er sich dann doch nicht verkaufen, oder zumindest den Eindruck übertünchen, dass er um jeden Preis in die Staatsregierung will. Er werde „nicht kuschen“, sagte der FW-Chef, und hob rasch noch Söders Raumfahrtprogramm „Bavaria One“ auf die Verhandlungsliste. Bei den wichtigen Themen jedoch wie Sicherheit, Integration, Zuwanderung, Wohnen und Bildung bewegt sich nichts. Mit der angestrebten Koalition bleibt in Bayern so ziemlich alles beim Alten. Und da das dann wohl auch für die Rolle der CSU in der Bundesregierung gilt, lässt das für Berlin nicht viel Besserung erhoffen.
Bilquelle: maxpixels.com, Creative Commons Zero – CC0