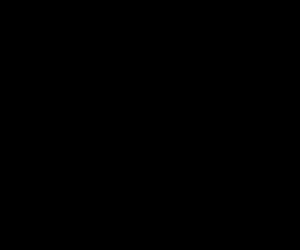Die SPD sei eine Lebensaufgabe, hat mir mal ein Kollege mehr ironisch gesagt, als wir über die Partei diskutierten und uns selber nach dem Sinn des Ganzen fragten. Blickt man in die Geschichte dieser Partei, hat es immer wieder Kämpfe und Intrigen gegeben. Selten verstanden sich mehrere führende SPD-Politiker als Team, lieber arbeiteten sie gegeneinander. Das war zu Zeiten des großen Willy Brandt und des nicht minder großen Helmut Schmidt- und Herbert Wehner darf hier nicht vergessen werden- nicht anders als später bei der so genannten „Enkel“-Generation: Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping, um nur die drei zu nennen, die sich gern das Leben schwer machten. Aber sowohl Brandt/Schmidt wie auch die „Enkel“ hatten einen Machtanspruch. Nicht, dass sie besonders gern hatten, aber die verfolgten ein Ziel.
Die „Enkel“ Brandts hatten ein Ziel, den Dauer-Kanzler Helmut Kohl nach 16 Kanzlerjahren abzulösen. Gerhard Schröder wurde Kanzler, Oskar Lafontaine Finanzminister. Die mochten sich auch nicht, wie sich später herausstellte, hatten aber früh erkennt, dass der eine den anderen brauchte, um ein politisches Ziel zu erreichen. Warum ich das noch einmal? Weil mir angesichts des Durcheinanders, des Kinder-Theaters, des Tohuwabohus, das die jetzige Führungsriege der Öffentlichkeit bietet, nichts mehr einfällt. Übrigens geht es anderen politischen Beobachtern ähnlich. Kopfschütteln überall. Das ist nicht zum Lachen, was die Sozialdemokraten da bieten. Und ein Ende ist wohl nicht in Sicht.
Nichts ist unmöglich, zitierte ein Kollege in einem Telefongespräch den bekannten Werbespruch eines japanischen Auto-Herstellers. Er bezog ihn jedoch auf die SPD. In der Tat. Nichts ist unmöglich. Ich kann weder unten noch oben entdecken, niemanden, der die Partei auch nur im Ansatz führt, es ist niemand da, der für Ruhe und Ordnung sorgen oder der etwa eine Linie aufzeigen könnte, an der entlang der Partei es gelingen würde, Sachlichkeit in die Diskussion zu bringen, Orientierung. Das betonen die Genossen zwar immer wieder, dass es aber jetzt und endlich um die Sache gehen müsse. Und dann diskutieren sie doch wieder Personalfragen. Was ja eigentlich nicht verwundern darf, denn Sache und Person gehören nun mal zusammen. Aber wer steht in der SPD wofür?
Das mit dem Minister hat sich für Gabriel erledigt
Vor über einem Jahr haben sich nicht wenige darüber aufgeregt, wie Sigmar Gabriel die Führung der SPD an Martin Schulz weitergab, er allein hatte das so entschieden. Gewundert hat mich das nicht, weil es ja bekannt war, wie unbeliebt Gabriel bei seinen eigenen so genannten Parteifreunden war. Der Außenminister Gabriel, befreit von der Last des Parteivorsitzes, wurde plötzlich der beliebteste deutsche Politiker und man staunte über die Gelassen- und Erhabenheit, die Gabriel ausstrahlte. Bei allem Respekt für Gabriel: Das Außenamt hat schon viele seiner Minister strahlen lassen. Immerhin, Gabriel, der eher als Raufbold bekannte Politiker, der keinem Streit aus dem Weg ging, der dauernd für eher negative Schlagzeilen sorgte, wuchs zu einer Art Staatsmann heran. Aber, dass der Niedersachse seine Hemdsärmeligkeit, den Hang zu Alleingängen, seine Rücksichtslosigkeit und Gemeinheiten endgültig abgelegt hätte, daran haben Gabriel-Kenner, die diesen Mann schon seit Jahren beobachten, immer bezweifelt. Und spätestens vor ein paar Tagen, als er gegen Martin Schulz und überhaupt gegen die angeblich so undankbare SPD austeilte, da war er wieder der altbekannte Raufbold, der über seine kleine Tochter und einen journalistischen Mittelsmann jene üble Zeile über Schulz -Mann mit Haaren im Gesicht-an eine große Mediengruppe weiterreichte, die viele Genossen auf die Palme brachte. So viel zum Staatsmann Gabriel, den einzubinden kaum möglich erscheint. Und das mit dem Minister Gabriel dürfte sich zumindest fürs erste erledigt haben.
Nur, wer sich damals über ihn aufgeregt hat und es jetzt wieder tat vor Tagen, der musste erleben, dass die anderen kaum besser sind. Wie die Partei mit Martin Schulz umsprang, erst zum 100-Prozent-Mann erhob, dann ihn aber nicht in den Landtagswahlkämpfen haben wollte, weil man schnell erkannt hat, dass Schulz es doch nicht kann, eben die SPD zu altem Ruhm zu führen. Aber man traute sich zunächst nicht, ihn schnell abzusägen, also ließ man ihn gewähren mit Merkel und Seehofer, damit daraus ein GroKo-Programm werde, dem die Parteimitglieder zustimmen mögen. Wobei einzuräumen ist, dass Schulz Parteichef werden wollte, er die SPD bedrängte, dann unbedingt Außenminister werden wollte, um auch Gabriel eine zu verpassen, all das gehört wohl auch zum Thema. Dann die plötzliche Einsicht des Herrn Schulz. Und so weiter. Er hat quasi abgedankt, wobei man nicht dem Glauben anhängen sollte, dass der Martin Schulz nur der Mann sei, der seinen Mantel teilen wollte, nein, so ganz ohne war und ist der auch nicht. Wer ihn in Brüssel erlebte, hat auch aus seinem Mund manches vernommen, was wenig schmeichelhaft klang für Berliner Politiker.
Olaf Scholz- Parteivize mit 59 Prozent
Nun also soll es Andrea Nahles richten, aber nicht sofort, weil es kleine Widerstände gibt, zwei Gegenkandidaten für die Wahl zum Parteivorsitz, weil es Gegrummel an der Basis gibt und die Öffentlichkeit sich nur noch wundert über das Bild, das die Partei Willy Brandts abgibt. Olaf Scholz spring also jetzt als kommissarischer SPD-Chef ein, um den Parteitag vorzubereiten, auf dem Frau Nahles SPD-Chefin werden soll. Derselbe Scholz, der von den Genossen auf dem letzten Parteitag mit 59 Prozent zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt worden war. 59 Prozent, da kann man kaum davon sprechen, dass die Partei hinter Scholz stünde oder diesen besonders schätze. Ohnehin hat seine Ausstrahlung durch die Vorkommnisse um den G-20-Gipfel in der Hansestadt schwer gelitten. So könnte es sein, dass der Hamburger Bürgermeister gern die Seiten wechselt, um in Berlin als Bundesfinanzminister bei Angela Merkel anzuheuern. Mit Andrea Nahles soll er gut auskommen, heißt es. Die beiden SPD-Politiker hätten sich schätzen gelernt, als Scholz im ersten Kabinett Merkel die Nachfolge von Franz Müntefering als Arbeitsminister antrat und Nahles zur gleichen Zeit sozialpolitische Sprecherin der SPD war. Das wäre ja dann etwas Positives, woran man anknüpfen könnte.
Bleibt die Frage, wen die SPD im Falle einer Zustimmung der Partei zum Koalitionsvertrag zum Außenminister machen will. Jeder ist zu ersetzen, auch einer wie Gabriel. Das kennt man aus vielen Jahren der Republik, dass immer mal wieder keiner ersetzt werden konnte, bis sich eine Alternative fand. Übrigens sorgen Amtsinhaber gern für solche Legenden, das heißt, sie lassen sie streuen, in aller Demut und Zurückhaltung.
In Mannheim stürzten die Genossen Scharping
Es wird Zeit für einen Wechsel in der SPD, für einen Handlungswechsel, für mehr Solidarität unter den Genossen, ein Begriff aus der Schatzkammer der ältesten deutschen Partei. 1995 war es, als die SPD in Umfragen bei 23 Prozent angelangt war, ein Tiefpunkt, der dazu führte, dass die SPD ihren Vorsitzenden Rudolf Scharping auf dem Mannheimer Parteitag stürzte, als sich Gerhard Schröder und Oskar Lafontaine zusammentaten. Der eine aus dem Saarland dirigierte als Parteichef die SPD-Ministerpräsidenten-Riege im Bundesrat und ließ keine Geschäfte mit der Kohl-Regierung mehr zu mit der Folge, dass die Steuerreform Kohls und Waigels scheiterte. 1998 gewann Schröder die Wahl mit 40,9 Prozent der Wählerstimmen. Die -SPD wurde stärkste Partei im Bundestag. Heute ist die Lage noch schlechter als damals, heute liegt die SPD in Umfragen bei unter 20 Prozent, vielleicht bei 19 vh, und Experten warnen, die Talfahrt könnte noch weitergehen, wenn man nicht endlich den Karren herum- und sich die Genossen zusammenreißen würden. Der politische Gegner sitzt nicht in den eigenen Reihen, sondern auf der anderen Seite. Wenn Olaf Scholz jetzt sagt, die SPD wolle wieder stärkste Partei werden, dann wird er sich vielleicht an den Tiefpunkt in den 90er Jahren erinnern. Damals lagen die Sozialdemokraten am Boden. Und sogar der gerade gestürzte Rudolf Scharping, gab die Losung aus: Man dürfe mal am Boden liegen, aber nicht liegenbleiben, sondern müsse wieder aufstehen und kämpfen. Es wird nicht einfach für die SPD, aber das lehrt ihre Geschichte: Einfach hatte es die Partei oft nicht, dieses Mal hat sie sich vieles selber eingebrockt. Nichts ist unmöglich. Das gilt für den Ab- wie den Aufstieg.
Die NRW-Genossen wissen davon ein Lied zu singen. Bei der Landtagswahl 2012 gewannen sie 39,1 Prozent der Stimmen, die CDU kam nur auf 26,3 vh. Fünf Jahre später war es wieder vorbei mit der Regentschaft der SPD, sie erreichte nur noch 31,2 vh und die CDU mit Armin Laschet kam auf 33 Prozent. Die Genossen hatten gemeint, einer wie Laschet werde niemals Hannelore Kraft besiegen können. Die Zahlen besagen anderes. Und: Hochmut kommt vor dem Fall.
Bildquelle: pixabay, user aitoff, CC0 Creative Commons