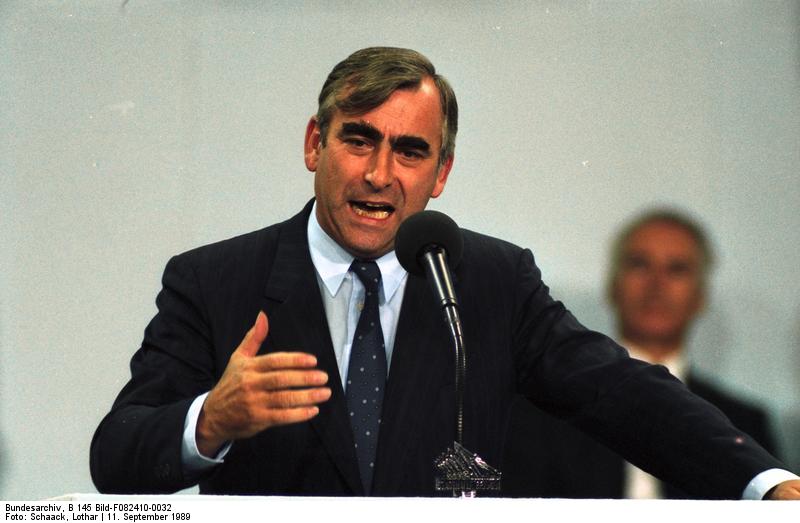Schicke meinen Text Der Idealist und der Zweifler, der im Blog der Republik erschienen ist, an meinen alten Deutschlehrer Manfred Peter, der abwechselnd in Spanien und Kolumbien lebt. Es handelt sich um eine Weiterentwicklung eines Schulaufsatzes von 1967. Er antwortet mir wie folgt:
Ich erinnere mich sehr gut an Ihren Aufsatz von damals und bewundere die weiterführende Reife, die diese initiale Idee gefunden hat. Es geht wie alles in unserem Bewusstsein um die Gegenwart, die wir im Spiegel der Zeugnisse der Vergangenheit wahrnehmen. Es ist sicher richtig, dass weder Cervantes noch Shakespeare im Grunde wussten, was sie taten.
Wissen kommt immer zu spät. Die handelnden Personen verlieren sich im alltäglichen Betrieb, doch ihre sensible Wahrnehmung erhellt, was ihnen widerfährt.
„Zu spät erst weise“ ist ein Satz aus dem Parzival von Wolfram von Eschenbach. Das ist eine schicksalhafte Sentenz. Das Wissen nützt leider sehr wenig. Die Windmühlen und die Wirrnisse eines sinnlosen Fechtens, sind stärker. Dennoch, es gewagt zu haben, nicht konform zu sein, das bleibt letztlich übrig.
Herzlichen Gruß und gute Wünsche für ein Jahr, das mit Sicherheit einen Quijote und auch Hamlet besiegt zurücklassen wird.
*
Elias Weisgärber, mein Künstlerfreund aus Zimmerschied, unserem zweiten Wohnsitz, ruft an. Ich solle nicht vergessen, mir ein Bild von ihm auszusuchen. Anlass ist: ich hatte ihm kurz vor Heiligabend einen kleinen Geldbetrag zukommen lassen. Da es ihm schwerfällt, etwas ohne Gegenleistung anzunehmen, hatte ich eine schöne Geschichte dazu erfunden: Ich hätte unser gemeinsames Buch Tierisch Menschliches, zu dem er Zeichnungen und einige Texte beigesteuert hat, in einem Café in Köln ausgelegt und dies sei nun das Honorar für die verkauften Exemplare. Er schaute mich ungläubig an (im wahrsten Sinne des Wortes ungläubig, denn er glaubte mir natürlich nicht) und meinte dann nur: Gut, gut, wenn es so etwas gibt. Um ihn zu beruhigen, sagte ich zu, in den nächsten Tagen vorbeizukommen.
Elias ist ein Phänomen. Er ist mittlerweile 90 Jahre alt und hat schwere Zeiten durchlebt (Krieg; Vertreibung); als Grafiker hat er wenig verdient und erhält jetzt eine entsprechend kleine Rente. Man kann sagen, er lebte zeitlebens an der Armutsgrenze; wäre da nicht sein kulturelles Kapital. Er hat früher Karikaturen für den Simplizissimus, den Spiegel und Konkret gezeichnet; nimmt bis heute an Kunstausstellungen teil und malt und zeichnet täglich zwei bis drei Stunden, um nicht durchzudrehen, wie er sagt. Er ist ungebrochen, wenn auch mitunter zornig und zunehmend sarkastisch. Die politischen Entwicklungen erzürnen ihn; das Vertrauen in die etablierten Parteien hat er restlos verloren. Zwar würde er niemals die AfD wählen – dann würde mir die Hand abfallen – aber er empört sich über Berichte, wonach Flüchtlinge sich mit mehreren Identitäten ausstatten und dann mehrfach abkassieren. Der Terrorist von Berlin habe Papiere mit zwölf verschiedenen Namen bei sich geführt. Er verstehe nicht, wie das möglich sein kann. Wie soll man sich verhalten? Noch vor einiger Zeit hätte ich von Einzelfällen gesprochen; nunmehr spüre ich – da ich ebenfalls fast täglich ähnliche Berichte lese – dass mir mehr und mehr die Argumente ausgehen. Vor allem aber verstehe ich, dass einer wie Elias, der sein Leben lang um seine Existenz kämpfen musste, sich empört. Da bin ich ganz auf seiner Seite.
*
Im Kölner Stadtanzeiger findet sich am 16.1. folgende Schlagzeile: Acht Superreiche besitzen so viel wie 3,6 Milliarden Menschen. Weiter heißt es in der Meldung: Die soziale Ungleichheit ist noch krasser als angenommen. Zu diesem Ergebnis kommt die Nichtregierungsorganisation Oxfam in ihrem neuen Bericht zur weltweiten Verteilung. Acht Männer vereinen laut der Studie so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung.
Wenn dies das Resultat der uns als alternativlos dargestellten Globalisierung ist, dann ist Schlimmes für die Zukunft zu erwarten: noch mehr Flüchtlingsströme; eine noch größere Kluft zwischen Armen und Reichen und nicht zuletzt: ein weiteres Aufkommen populistischer Strömungen weltweit. Und es ist nicht zu sehen, dass dem wirksam entgegen gearbeitet wird. Bisher gibt es lediglich Appelle: von den G 20-Staaten, dem Papst und selbst vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Aber gerade dort sitzen sie doch, die Reichen und Mächtigen dieser Welt. Glaubt wirklich jemand, dass von dort die Rettung naht?
*
Zum 31.12. hat unser Gemüse- und Fischstand aufgegeben. Über dreißig Jahre lang waren wir dort Kunden. Nahezu jeder Einkauf war mit Geplauder, Scherzen oder auch fachlichen Gesprächen verbunden.
Vor einigen Wochen schloss bereits der letzte Tante-Emma-Laden im Veedel. Die Betreiberin, Frau Bunsen, konnte das Geschäft aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiterführen. Zu ihren Kunden gehörten vor allem ältere Leute aus der Nachbarschaft. Für sie war es ein Treffpunkt, und es standen eigens zwei Stühle bereit, damit sie sich setzen konnten. Man war schnell in ein Gespräch verwickelt und vergaß fast, was man einkaufen wollte. Die Schüler des benachbarten Gymnasiums nannten ihre Schule Bunsen-Gymnasium.
So geht ein weiteres Stück Alltagskultur, wenn nicht gar Heimat, verloren.
*
Finde im Buch „Überlebensglück“ von Oskar Negt folgende Passage über Flucht, Vertreibung, Asyl und Heimat: Die Vorstellung, einen sicheren Ort in der Welt zu finden, wo ich mich auf Dauer ansiedeln kann oder Gastrecht genieße, bis die Leib und Leben bedrohende Gefahr vorüber ist, lässt sich von ihren naturrechtlichen Ursprüngen gar nicht ablösen. Mehr als ein Jahrtausend lang, bis in die Neuzeit hinein, war die Kirche ein solcher Ort des Asyls, nicht immer gefeit gegen die Machtansprüche des Staates, aber doch mit dem Versprechen, die Verfolgten nicht einfach den Henkern auszuliefern. Auch dem modernen Denken ist dieser Topos eines sicheren Ortes, der den Flüchtenden, Herumirrenden, Verfolgten einen Ausweg zeigt, ihnen wenigstens vorübergehend Schutz gewährt, nicht unbekannt. Aber auch das Recht auf Ansiedlung, auf Migration in vollem Wortsinne, lebt, wenn es friedlich beansprucht wird, von einem naturrechtlichen Element des Gemeinbesitzes der Erde. Kant spricht hier sogar von einem erfahrungsunabhängigen, das heißt transzendentalen Prinzip der Hospitalität, von einem weltbürgerlichen Gastrecht auf Erden.
*
Johann (Joke) Bruns aus Emden schreibt mir einen längeren Brief zu meinem Buch Kontinuitäten und Brüche. In meinem Buch schildere ich meine Herkunft aus dem Arbeitermilieu und die Schwierigkeiten, auf dem Zweiten Bildungsweg das Abitur nachzuholen und zu studieren. Joke Bruns hatte mich in den 60er Jahren auf diese Möglichkeit hingewiesen und mich dabei unterstützt. Später ging er in die Politik und wurde Landes- und Fraktionsvorsitzender der SPD in Niedersachsen.
Er schickt mir ein Referat über Luther, das er aus Anlass des Luther-Jubiläums vor Kirchenvertretern gehalten hat. Er weist darin nach, dass Luther alles andere als der Vorläufer der Moderne und ihrer Freiheiten war (wie di Fabio, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, dies vor kurzem behauptet hatte). Bruns weist nach, wie zeitgebunden Luther war; ja in vielem sogar rückwärtsgewandt. Für ihn galt nur, was in der Bibel stand. Die (natur-)wissenschaftlichen Erkenntnisse seiner Zeit ignorierte er oder hielt sie gar für Teufelszeug. Überhaupt hatte er es mit dem Teufel: alles, was ihm nicht in den Kram passte, schrieb er diesem zu.
Luthers Verdienste werden natürlich von ihm auch erwähnt: vor allem die Bibelübersetzung ins Deutsche und damit der Versuch, sie allgemein zugänglich zu machen.
*
Lese einige Erzählungen von Raymond Carver aus dem Buch Erste und letzte Storys. Meisterhaft, wie er eine Geschichten konstruiert. Er springt mitten ins Geschehen, wobei er meist ganz alltägliche Ereignisse schildert, die einem einen Eindruck von der Leere und Sinnlosigkeit des normalen Lebens von Unterschichtsangehörigen gibt. Es wird viel geredet, aber kaum kommuniziert. Man lebt in seinem kleinen Universum und entsprechend eng ist der Horizont. Inmitten dieser sog. Normalität lauert stets die Katastrophe: die bevorstehende Trennung eines Paares; Krankheit oder Tod; Arbeitslosigkeit; Trunk- oder Drogensucht; Verbrechen. Man kann einiges von Carver lernen, der die Atmosphäre derart unprätentiös schildert, dass man das Gefühl hat, den Ereignissen beizuwohnen.
All das verrät viel über das Alltagsleben in den USA – jedenfalls das der kleinen, oft abgehängten Leute. Und man versteht besser, warum diese in ihrer Verzweiflung Donald Trump gewählt haben.
*
Die Kraniche kehren zurück, das jährliche Schauspiel beginnt. Große Schwärme fliegen direkt über uns hinweg. Sie fliegen so tief, dass man ihre langgestreckten Körper und die weiten Schwingen deutlich sieht. Wie Meeresrauschen hört es sich an. Sie fliegen in langen Reihen, und es sind mehrere Züge gleichzeitig. Ein unglaubliches Schauspiel, das wir so intensiv noch nicht erlebt haben. Wir sind jedes Mal beglückt, wenn sie heimkehren, diese Boten des Frühlings.
*
Lese von David Foster Wallace die Erzählung In alter Vertrautheit. Darin schildert er einen Protagonisten, der sich für einen Heuchler hält und an dieser Tatsache schier verzweifelt. Alle Versuche, sich selbst zu therapieren, scheitern. Er sucht einen Psychologen auf, der ihm allerdings auch nicht helfen kann. Im Grunde genommen wollte ich ihm bloß zeigen, dass ich genauso schlau war wie er.
In seinem Ringen um Selbsterkenntnis gelingt es ihm nicht, eine Identität auszubilden, zu der er stehen könnte. Er denkt daran, sich umzubringen, indem er mit dem Auto auf einen Betonpfeiler fährt. Wie wird er den Moment erleben? Wie wird er die Zeit wahrnehmen, wie wird sie vergehen? Diese Vorstellung beherrscht ihn fortan total und führt zu einer Reflexion über die Paradoxa einer Zeit, die angeblich vergeht, und einer so genannten ‚Gegenwart’, die immerzu in die Zukunft abrollt und hinter sich mehr und mehr Vergangenheit erzeugt. Nur: Wenn die Zeit wirklich vergeht, wie schnell vergeht sie dann? Auch wenn man sagt, die Zeit verfliegt oder vergeht, bekommt man es sofort mit einem Paradoxon zu tun. Was ist, wenn es in Wirklichkeit gar keine Bewegung gibt? Was ist, wenn sich dies alles in dem einen Blitz entfaltet, den sie die Gegenwart nennen, diesem ersten, unendlich winzigen Sekundenbruchteil des Aufpralls, wenn die vordere Stoßstange des dahinrasenden Autos gerade den Pfeiler berührt, kurz bevor die Stoßstange zusammengeknautscht wird, das Vorderteil des Autos eindellt, dieses Jetzt in Wahrheit unendlich ausgedehnt ist?
Diese Passagen, die sich mit dem Zeitvergehen während des Todesmoments befassen, gehören zum Höhepunkt der Erzählung, dessen Dramatik darin besteht, dass Wallace sich tatsächlich einige Zeit später umbringt. Er muss von dem Gedanken an den eigenen Tod besessen gewesen sein und schildert diesen Vorgang geradezu analytisch exakt. Es tut übrigens nicht weh. Es wird laut, und Sie spüren die Dinge. Und etwas später heißt es: In Wahrheit ist das Sterben nicht schlimm; es dauert nur ewig lange. Und ewig nimmt keine Zeit in Anspruch.
*
Wir besuchen ein Konzert im Altenberger Hof. Gespielt werden bekannte Hits aus den 70er und 80er Jahren; dazu einige Jazzstücke. Das Publikum besteht überwiegend aus Alten, die hier kostenlos in den Genuss ähnlicher Veranstaltungen kommen. Sie gehen begeistert mit; einige tanzen, andere klatschen im Rhythmus. Ich denke bei mir: wie schön für die Alten, das es dieses Bürgerzentrum gibt. Und dann wird mir urplötzlich klar: was heißt hier diese Alten. Es ist unsere Generation, die hier versammelt ist.
*
Manfred Peter schickt mir einen Text mit markanten Marx-Zitaten, die er aus Anlass des 150jährigen Erscheinens des Kapitals ins Spanische übersetzt hat. Er schreibt:
Ich bin dabei, Marx-Texte zu vermitteln. Die Ignoranz gegenüber Marx hat eher zugenommen. Man hat in Kolumbien buchstäblich alles abgeschafft, was nach Theorie und nach Reflexion „riechen“ mag. Es gibt weder öffentliche Verkehrsmittel noch Postdienst. Was privatisiert werden konnte, das wurde dem Geschäft überlassen. Selbst der Bürgerkrieg war privatisiert worden. Der Friede ist nunmehr auch zum Geschäftsmodell verkommen. Ein rasender Abstieg ins Bedeutungslose. Entsprechend verhält sich die Jugend.
Die Universität hat ihre Funktion weitgehend entsorgt: Vorher ging es um Indoktrination, jetzt werden Karrieren geschmiedet. Ziel ist ein Doktorhut.
Dagegen zu halten ist aussichtslos. Alte Bekannte sind nicht wiederzuerkennen; viele machen Jogging zum Lebensinhalt. Das ist ihre Alternative.
Man ist hier gegen Trump, weiß aber nicht warum. Wegen der Mauer wahrscheinlich.
*
Stöbere in alten Bücherbeständen herum und stoße auf das von Franz Borkenau herausgegebene Marx-Buch. Es enthält Textausschnitte aus diversen Werken von Marx. Ich hatte mir das Buch 1967, also vor 50 Jahren, gekauft, als ich noch Schüler am Hessen-Kolleg war. Zu dieser Zeit hatte ich noch keinen der blauen MEW-Bände. Die ersten drei kaufte ich mir 1968 in Prag in einem Kulturinstitut der DDR.
Ich schlage zufällig eine Textstelle aus dem 1. Band des Kapitals auf und staune über die literarische Qualität der Marxschen Ausführungen. Dort heißt es u.a.:
Diese ursprüngliche Akkumulation spielt in der politischen Ökonomie ungefähr dieselbe Rolle wie der Sündenfall in der Theologie. Adam biß in den Apfel, und damit kam über das Menschengeschlecht die Sünde. Ihr Ursprung wird erklärt, indem er als Anekdote der Vergangenheit erzählt wird. In einer längst verflossenen Zeit gab es auf der einen Seite eine fleißige, intelligente und vor allem sparsame Elite und auf der andren faulenzende, ihr alles, und mehr, verjubelnde Lumpen. Die Legende vom theologischen Sündenfall erzählt uns allerdings, wie der Mensch dazu verdammt worden sei, sein Brot im Schweiß seines Angesichts zu essen; die Historie vom ökonomischen Sündenfall aber enthüllt uns, wieso es Leute gibt, die das keineswegs nötig haben. Einerlei. So kam es, dass die ersten Reichtum akkumulierten und die letztren schließlich nichts zu verkaufen hatten als ihre eigne Haut. Und von diesem Sündenfall datiert die Armut der großen Masse, die immer noch, aller Arbeit zum Trotz, nichts zu verkaufen hat als sich selbst, und der Reichtum der wenigen, der fortwährend wächst, obgleich sie längst aufgehört haben zu arbeiten… Sobald die Eigentumsfrage ins Spiel kommt, wird es heilige Pflicht, den Standpunkt der Kinderfibel als den allen Altersklassen und Entwicklungsstufen allein gerechten festzuhalten. In der wirklichen Geschichte spielen bekanntlich Eroberung, Unterjochung, Raubmord, kurz: Gewalt, die große Rolle. In der sanften politischen Ökonomie herrschte von jeher die Idylle, Recht und „Arbeit“ waren von jeher die einzigen Bereicherungsmittel… In der Tat sind die Methoden der ursprünglichen Akkumulation alles andre, nur nicht idyllisch.
Schaut man sich die Schlichtheit der neoliberalen Dogmen der heutigen Ökonomen an, fragt man sich unwillkürlich, was aus dieser einst stolzen Wissenschaft geworden ist: pure Ideologie.
*
Gehen zu Fuß über die Flora, das Rheinufer ins Wallraf-Richartz-Museum. Wir waren einige Monate nicht hier, aber es ist jedes Mal ein Erlebnis. Immer wieder gibt es Neuentdeckungen. Diesmal gefällt mir Die Brücke von Chatou (1908) von Maurice de Vlaminck besonders. Wir beschränken uns auf die Abteilung Moderne im 3. Stock, wo wir fast alles versammelt finden, was uns interessiert. Wir sind mit einem weiteren Besucher allein in der Abteilung; erst ganz zum Schluss kommt eine Schulklasse hinzu, aber die Kinder stören nicht. Vielmehr staune ich, wie aufmerksam sie sind. Sie sind ganz bei der Sache.
Nach dem Museumsbesuch fahren wir mit dem Taxi zurück nach Nippes. Der türkische Taxifahrer erzählt uns, heute sei der Tag des Abschiedspiels von Lukas Podolski. Er habe den Lukas einmal gefahren. Dieser habe ihn damals gefragt: Warum fährst Du nicht die Autobahn, das geht schneller? Daraufhin habe er ihm gesagt, das wäre ein Umweg und außerdem viel teurer. Daraufhin habe dieser gesagt: Mach dir doch keinen Kopp. Ich bezahle doch alles! So sei er gewesen: geradeaus und schnörkellos. Heute gäbe es viele Spieler, die würden kariert daherreden. Mit Lukas habe man sich ganz normal unterhalten können. Ein guter Junge, meint er abschließend.
*
Habe den Steppenwolf von Hermann Hesse zu Ende gelesen. Die Hauptfigur – Harry Haller – befindet sich in einer tiefen Lebenskrise. Drastisch schildert Hesse uns dessen Gemütszustand, ja Überdruss an der Welt und dem bürgerlichen Normalleben. Eine Schlüsselstelle für mich, die ich auch wegen der literarischen Qualität und Intensität zitieren möchte, lautet: H. durchlebt Tage des Seelensterbens, jene argen Tage der inneren Leere und Verzweiflung, an denen uns, inmitten der zerstörten und von Aktiengesellschaften ausgesogenen Erde, die Menschenwelt und sogenannte Kultur in ihrem verlogenen und gemeinen blechernen Jahrmarktsglanz auf Schritt und Tritt wie ein Brechmittel entgegengrinst, konzentriert und zum Gipfel der Unleidlichkeit getrieben im eigenen kranken Ich – wer jene Höllentage geschmeckt hat, der ist mit solchen Normal- und Halbundhalbtagen gleich dem heutigen sehr zufrieden, dankbar sitzt er am warmen Ofen, dankbar stellt er beim Lesen des Morgenblattes fest, dass auch heute wieder kein Krieg ausgebrochen, keine neue Diktatur errichtet, keine besonders krasse Schweinerei in Politik und Wirtschaft aufgedeckt worden ist, dankbar stimmt er die Saiten seiner verrosteten Leier zu einem gemäßigten, einem leidlich frohen, einem nahezu vergnügten Dankpsalm, mit dem er seinen stillen, sanften, etwas mit Brom betäubten Zufriedenheitshalbundhalbgott langweilt, und in der laudicken Luft dieser zufriedenen Langeweile, dieser sehr dankenswerten Schmerzlosigkeit sehen die beiden, der öde nickende Halbundhalbgott und der leicht angegraute, den gedämpften Psalm singende Halbundhalbmensch, einander wie Zwillinge ähnlich.
Es ist eine schöne Sache um die Zufriedenheit, um die Schmerzlosigkeit, um diese erträglichen geduckten Tage, wo weder Schmerz noch Lust zu schreien wagt, wo alles nur flüstert und auf Zehen schleicht. Nur steht es mit mir leider so, dass ich gerade diese Zufriedenheit gar nicht gut vertrage, dass sie mir nach kurzer Dauer unausstehlich verhaßt und ekelhaft wird. Wenn ich eine Weile die laue fade Erträglichkeit sogenannter guter Tage geatmet habe, dann wird mir in meiner kindischen Seele so windig weh und elend, dass ich die verrostete Dankbarkeitsleier, dem schläfrigen Zufriedenheitsgott in zufriedene Gesicht schmeiße und lieber einen recht teuflischen Schmerz in mir brennen fühle als diese bekömmliche Zimmertemperatur. Es brennt alsdann in mir eine Wut auf dies abgetönte, flache, normierte und sterilisierte Leben und eine rasende Lust, irgend etwas kaputt zu schlagen, etwa ein Warenhaus oder eine Kathedrale oder mich selbst oder einigen Vertretern der bürgerlichen Weltordnung das Gesicht ins Genick zu drehen. Denn dies haßte, verabscheute und verfluchte ich von allem doch am innigsten: diese Zufriedenheit, diese Gesundheit, Behaglichkeit, diesen gepflegten Optimismus des Bürgers, diese fette gedeihliche Zucht des Mittelmäßigen, Normalen, Durchschnittlichen.
Viele Passagen des Romans sind von einer ungewöhnlichen Intensität und Subtilität, und man kann wohl zurecht vermuten, dass viel Hermann Hesse in der Figur Harry Hallers steckt. Vielleicht hat Hesse durch die Arbeit am Steppenwolf seine eigene persönliche Lebenskrise bewältigt, in der er zum Zeitpunkt der Abfassung des Romans steckte. Der Roman wurde vor allem in den 60er Jahren zu einem Kulttext der kulturrevolutionären Studentenbewegung – vor allem durch seine explizite Antibürgerlichkeit und dem Bekenntnis zur ungehemmten Sinnlichkeit.
*
Ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Herrliches, klares Wetter an diesem Sonntagmorgen. Wir machen uns um 9.00 Uhr in voller Fahrradkluft mit unseren Rennrädern auf; den Rhein entlang bis zu den Kranhäusern; direkt am Rhein weiter bis zur Rodenkirchener Brücke; durch den Grüngürtel bis Marienburg. Wir durchfahren das Villenviertel Kölns: prunkvolle Häuser hinter hohen Mauern. Unvorstellbar, dass man hier einige der z.Zt. 15.000 Flüchtlinge unterbringen wird.
*
Besuchen die Ausstellung Kosmischer Kommunismus im Museum Ludwig. Gezeigt werden Werke von Otto Freundlich, der uns vorher nicht bekannt war. F. war ein Künstler, der sehr konzeptionell arbeitete. Obwohl Autodidakt, war er theoretisch stets auf dem neuesten Stand; er veröffentlichte einige kunstphilosophische Essays, die in Fachkreisen anerkannt waren.
Otto Freundlich vertrat die Idee eines humanistisch verpflichteten Kunstschaffens. Seine Kompositionen formulieren und repräsentieren das Ideal eines sozialen Gefüges, in dem das Einzelne im Dialog mit dem Ganzen steht. Kunst und Gesellschaft basieren für ihn auf einer gemeinsamen ethischen Grundlage. Danach ist sie eine alle Menschen verbindende Sprache, die besonders durch Malerei, Skulptur und Architektur zum Ausdruck gebracht wird. Kunstwerke sollen daran erinnern, dass die Menschheit die Aufgabe hat, eine soziale Einheit zu werden.
Visuell greifbar wird Freundlichs Utopie in seinen Gemälden und Gouachen durch den bewusst konzipierten Zusammenklang von Form und Farbe – der Offenheit aller auf dem Bilde befindlichen Flächen füreinander“. Eines seiner bekanntesten Werke ist Die Geburt des Menschen. Inmitten geschwungener, farbenfroher Kreise erblickt man eine menschliche Figur, die einen Stift o.ä. in der Hand hält. Vielleicht das Symbol für die menschliche Schaffenskraft. Die farblich differenzierten Kreise gehen ineinander über und betonen die Verbindung aller natürlichen und kulturellen Sphären des Seins.
Im bildhauerischen Werk wird der politische Anspruch F.s explizit: Der Titel seiner ersten Monumentalskulptur Ascension (1929) verweist auf den Gedanken des Aufstiegs – den potentiellen Aufstieg einer benachteiligten Klasse, den Aufschwung des Geistes und die Entfaltung des Menschen. Die eigene Wahrnehmung soll sich für die gemeinsame Aufgabe, das Soziale neu zu denken, öffnen.
Die Ausstellung hat uns stark beeindruckt. Wir gehen anschließend in die vielbesuchte, parallel stattfindende Richter-Ausstellung. Viele schöne, bunte Bilder. Eine Versammlung von Farbklecksen, die eine große Anziehungskraft haben. Mir sagen die Bilder wenig; man kann sich alles Mögliche dazu vorstellen. Ich werde nie begreifen, worin nun die Weltbedeutung dieser Bilder liegen soll. Sie sind schön anzuschauen; aber mehr vermag ich darin nicht zu sehen.
*
Ich arbeite an einem Text über den Zusammenhang von Sprache und Erinnerung. Zu selten wird in unserer Disziplin untersucht, wie Sprache mit den verschiedenen Formen des Erlebens verflochten ist. Und gerade das Erleben von Zeit ist diesbezüglich besonders stiefmütterlich behandelt worden. Es geht um den Einfluss, den die sprachliche Artikulation aufs Erinnern hat; sie ist eng verwandt mit dem sprachlichen Verfeinerungsprozess der Phantasie.
Erinnerungen sind wie ein Steinbruch, dem wir einzelne Elemente entnehmen, wobei wir tunlichst darauf achten, dass das Erinnerte das Selbstbild, das wir von uns haben, nicht beschädigt. Im Gegenteil. Zu vermuten ist, dass wir unsere Erinnerungen dazu benutzen, unser Selbstbild zu konturieren oder zu skulpieren. Im Unterschied zum Traum, der sich mehr oder weniger von der Wirklichkeit loslöst, sind Erinnerungen Teil des gelebten Lebens. Man erinnert sich über Gerüche, Gegenstände, Personen oder Situationen. Meist sind es aktuelle Anlässe, die Erinnerungen auslösen; Ereignisse, die sich in der Vergangenheit abgespielt haben und die einem plötzlich wieder bewusst werden. Dabei steht uns die Vergangenheit nicht als ein Kontinuum zur Verfügung. Die Erinnerung verfährt stets selektiv. So wählt aus, was unser gegenwärtiges Interesse weckt. Es ist, als würde ein äußerer Reiz auf das Unbewusste einwirken und uns etwas wieder ins Bewusstsein rufen, an das wir schon gar nicht mehr gedacht haben. Aber ist das, was uns da wieder bewusst wird, dasselbe, was wir einst erlebt haben? Auch wenn wir noch so sehr davon überzeugt sind, etwas sei so gewesen, wie wir es erinnern, so können wir dessen nicht gewiss sein. Wir neigen dazu, Sperriges und Unangenehmes auszusparen; Gefühle von Scham und Schuld zu glätten. Vor allem aber: wir gehen mit unserem heutigen Verständnis an die Dinge heran und können sie nie mehr so sehen, wie wir sie vor langer Zeit gesehen haben. Wir haben zwischenzeitlich neue Erfahrungen gemacht. Man ist der gleiche Mensch wie damals und doch ein ganz anderer.
Erinnerung ist keine simple Wiederholung dessen, was wir schon einmal erlebt haben. Sie konstruiert das Vergangene stets neu; baut es um. Auf diese Weise überwindet der Mensch seine Gebundenheit an das Hier und Jetzt; indem er träumt, phantasiert, wünscht oder empfindet, überschreitet er seine konkrete Existenz. Er lebt zwar hier und jetzt; aber zugleich auf anderes hin. Er hat Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und gerade letztere zeichnet sich dadurch aus, dass sie noch offen ist; sie lässt sich noch gestalten.
Ich frage mich des Öfteren: Welche Bilder entstehen in einem, sobald wir uns erinnern? Und: Wie lassen sich scheinbar belanglose Alltagsgeschichten in möglichst spannende Erzählungen weiter entwickeln, umformen, ins Phantastische wenden? Könnte man daraus zusammenhängende Episoden konstruieren? Und worin besteht der Zusammenhang von Erinnern und Sprache? Nun gibt es zweifellos viele Episoden, an die wir uns erinnern, ohne dass wir sie in der Form einer Geschichte erzählen. Kann man daher trotzdem von einer Schlüsselrolle der Sprache im episodischen Gedächtnis sprechen? Wer sich erinnert, verarbeitet ein Erlebtes; er holt etwas aus sich hervor, das irgendwo wie in einem abgesperrten Verlies verborgen war und beginnt, sich erneut damit zu befassen, jedoch auf eine neue, nie dagewesene Weise. Aber auf welche Weise geschieht dies? Unsere Gegenwartsempfindung verfügt über eine poröse Struktur und setzt sich aus unzähligen Details zusammen; wenn man so will, aus Haupt- und Nebensachen, aus all den Aktivitäten, die wir verrichten. Jeder Versuch, auch nur den vergangenen Tag als ein zusammenhängendes Ganzes zu schildern, würde sich zu einem unbeherrschbaren Unterfangen auswachsen. Viele Abläufe ließen sich gar nicht mehr erinnern. Andere sind schlicht verschwunden – abgetaucht ins Unterbewusste; wir haben sie schlicht vergessen. Wäre dem nicht so und wir würden den ganzen Ballast an Erlebtem ständig mit uns herumschleppen – wir wären unfähig, uns zu einer sinnvollen Handlung aufzuraffen, da wir ständig damit beschäftigt wären, eine Struktur in unsere Lebensgewohnheiten zu bringen. Das alles erledigt die Arbeit unseres Gehirns, das uns das Vergessen und Verdrängen ermöglicht, indem es Wichtiges von Unwichtigem trennt.
Worauf es beim Schreiben ankommt ist: eine literarische Form zu finden, die dem Erlebten Rechnung trägt.
*
Mein jüngerer Bruder Klaus und ich haben uns entschlossen, ein gemeinsames Buch zu schreiben. Die Idee zu diesem Buch entstand, als wir uns einmal wieder darüber unterhielten, wie wir eigentlich zum Schreiben (Joke) bzw. Malen (Klaus) gekommen sind. Daraus wurde ein Buch über unsere Herkunft und den Aufbruch aus dem Arbeitermilieu, in dem wir aufgewachsen sind. Wir staunten nicht schlecht, wie viele Erinnerungen, Briefe oder Dokumente im Laufe der Arbeit an dem Buch auftauchten, die wir oft schon längst vergessen hatten. Sie berühren einen auf seltsame Weise neu: plötzlich steht einem das Erlebte wieder vor Augen, und man wird erneut in den Sog der Ereignisse von damals hineingezogen. Uns überraschte vor allem, wie früh wir uns bereits mit Themen auseinandergesetzt haben, die uns bis heute umtreiben. Davon zeugt insbesondere der Briefwechsel zwischen uns, in dem es fast immer um Politik, Kunst und Literatur geht und der sich jetzt schon über Jahrzehnte erstreckt.
Vor allem die Briefe aus der Zeit um 1968 geben einen Eindruck von der Dynamik und Dramatik der gesellschaftlichen Veränderungen wieder. Aber 1968 war auch ein entscheidendes Datum für den persönlichen Aufbruch: ich machte als Erster in unserer Familie das Abitur auf dem Zweiten Bildungsweg und begann mein Studium.
Klaus war der Erste von uns, der auf dem „normalen“ Weg das Abitur machte und studierte. Wir beide waren keine herausragenden oder gar fleißigen Schüler; aber uns war bewusst, dass wir uns nur über den Weg der Bildung weiterentwickeln konnten. Dabei profitierten wir von den Bildungsreformen der 1960er Jahre, die es Arbeiterkindern erleichterten, das Abitur zu machen.
Bildung war die Voraussetzung dafür, dass wir begannen, uns für Dinge zu interessieren, die uns zuvor verschlossen waren. Das gilt insbesondere für die Literatur und Malerei. Bei uns zu Hause gab es keine Bücher oder Bilder an den Wänden. Dass wir einmal selbst schreiben oder malen würden, war aus der Sicht von damals ziemlich utopisch. Wir versuchen in dem Buch, unsere Wege dorthin nachzuvollziehen. Unsere Erinnerungen erzählen wir in Form von Reflexionen und Geschichten; wohl wissend, dass dies nur Mosaiksteine sind und die Wirklichkeit viel komplexer und widersprüchlicher war.
Mit unserem Buch wollen wir denjenigen, die aus bildungsfernen Schichten kommen, Mut machen, sich nicht von den tatsächlichen oder vermeintlichen Bildungsbarrieren abschrecken zu lassen.
*
Rede mit Valentin, dem Schauspieler, über meinen Text Erinnerung und Sprache. Er kommt von sich aus auf mich zu, als er seinen Dienst in der Kneipe beendet hat. Ich merke sofort: er hat den Text verstanden. Und dann schildert er, dass sein Vater ihm immer neue, teils sich widersprechende Schilderungen seiner Zeit in Rumänien liefert: mal war er im Widerstand; dann wieder Teil des Regimes. Darüber möchte er ein Theaterstück schreiben.
*
Lese auf der Veranstaltung Die totalitäre Erfahrung, die von der Kölner Akademie der Künste der Welt organisiert wurde, einen Text über Heinz Langerhans. Er war einer meiner Professoren; Schüler von Karl Korsch, bei dem er mit Bert Brecht ein Seminar über das Kapital von Marx besuchte. Gemeinsam mit Korsch wurde er 1926 aus der KPD ausgeschlossen. Während der Nazizeit ging er in den Untergrund; wurde verhaftet, kam ins Zuchthaus und ins KZ. Ihm gelang die Flucht ins Exil über Belgien, Frankreich und in die USA, wo er Korsch, Brecht, Leo Friedmann, Ruth Fischer und viele Weggenossen aus dem Frankfurter Institut für Sozialforschung wiedertraf. Mitte der 60er Jahre kam er nach Deutschland zurück und wurde Professor für internationale Beziehungen an der Uni Gießen. Aus dieser Zeit kannten wir uns.
Viele schätzten L.s intellektuelle Fähigkeiten, seine scharfen Analysen mit teils frappierenden Prognosen über die politischen Entwicklungen der Zeit; z.B. sagte er den 2. Weltkrieg ziemlich präzise voraus. Ergreifend die Schilderungen seines Verhältnisses zu Korsch: zunächst war es ein Lehrer-Schüler-Verhältnis; später kehrte es sich um. L. teilte nicht die Ansicht von Korsch, man müsse die Marxschen Schriften noch einmal genau studieren usw. L. war der Meinung, die alte Arbeiterbewegung sei passé und damit auch die Theorie. Beides müsste völlig neu begründet werden.
Anlass der Tagung war, dass man Teile des Langerhans-Nachlasses in einem Archiv aufgefunden hat. Das könnte dazu beitragen, einige Lücken der Exilgeschichte der Arbeiterbewegung zu schließen. Nur ein Beispiel: Langerhans vertrat die These, dass die antifaschistische Exilbewegung längst Teil der Konterrevolution geworden war, weil sie den stalinistischen Terror ignorierte oder gar beschönigte. Er meinte, die Nazis hätten die Arbeiterbewegung macht- und sozialpolitisch nur deshalb für ihre späteren kriegerischen Zwecke weitgehend integrieren können, weil der Stalinismus sie von innen heraus zerstört habe, indem er die Kommunistische Internationale dem Diktat Stalins („Aufbau des Sozialismus in einem Lande“) unterworfen habe. Das sei einer der Gründe dafür gewesen, weshalb der Faschismus nahezu ungehindert an die Macht gekommen sei.
Das wird noch interessante Diskussionen geben, wenn erst einmal das gesamte Werk von Langerhans veröffentlicht worden ist; denn immerhin war er einer der Wenigen, die das Ganze hautnah erlebt und permanent reflektiert haben.
Viele der Details über ihn kannte ich bisher nicht. Interessant z.B. die Einschätzung, insbesondere von Leo Friedmann, L. sei eigentlich ein Dichter; vor allem Brecht sei von seinen Gedichten stark beeindruckt gewesen– wegen der Direktheit, Härte, aber auch Poesie seiner Sprache. Nach dem Krieg wurden seine Gedichte, die er teilweise in der Haft geschrieben hatte, von westdeutschen Verlagen abgelehnt. In einem der Ablehnungsschreiben hieß es, er sei ein Unzeitgemäßer. So lautete dann auch der Titel meines Vortrags.
*
Lese noch einmal Fragen Sie mehr über Brecht. Eine Zusammenstellung der Gespräche, die der DDR-Germanist Bunge mit dem Brecht-Freund Hanns Eisler über mehrere Jahre geführt hat. Die Gespräche regen mich an, wieder in dem Arbeitsjournal von Brecht zu stöbern. Unter dem 16.2.1943 findet sich ein Eintrag über Heinz Langerhans. Brecht, der gegenüber Dritten meist sehr kritisch urteilt, schreibt über H. L.: Langerhans sympathisch wie eh. H. erzählt ihm, dass im KZ Texte von B. gelesen wurden. Brechts trockener Kommentar: Kulturnation.
*
Am Rande eines Jazz-Konzerts in der Kneipe an der Deichbrücke unterhalten wir uns mit einem der Musiker. Ein pensionierter Richter, der schon als Student mit Jazzgruppen gespielt hat. Aus dieser Zeit kennt er Monty Sunshine und Chris Barber. Er hat sie teilweise auf Tourneen begleitet. Chris Barber sei mittlerweile 87 Jahre alt und spielt immer noch. Ein netter, interessanter Mann, mit dem wir später noch ein Bier trinken. Ein weiterer Mitspieler kommt hinzu. Ich erzähle ihnen, dass mein Bruder Gerhard, der zur See fuhr, Ende der fünfziger Jahre die ersten Jazzplatten aus den USA oder England mitbrachte und welch Kulturschock diese bei uns zu Hause ausgelöst haben. Der Schriftsteller Dieter Wellershoff habe einmal geschrieben, die Jazzmusik habe seiner Generation den Marschtritt ausgetrieben. Und siehe da: einer der Musiker kennt D.W.
Die Drei-Mann-Band spielt diesen wunderbaren New-Orleans-Stil und viele der bekannten Bluesstücke. Sehr professionell; man merkt, dass sie schon viele Jahre zusammen spielen.
*
Zu meiner Freude entdecke ich auf dem Bolzplatz am Pumpwerk einen der geflüchteten afghanischen Jungen, mit dem ich mich vor einem Jahr unterhalten habe. Er und sein Bruder sind nach wie vor in Wilhelmshaven und sprechen mittlerweile ganz gut deutsch. Beide machen einen stabilen Eindruck. Ich hatte oft an sie gedacht, wenn ich von den tatsächlichen oder drohenden Abschiebungen nach Afghanistan gelesen habe.
*
Gestern bin ich über zwei Stunden durch Wälder und Wiesen gestreift; auch fernab der offiziellen Wege. Die Wiesen üppig wie selten: der Klee steht bis zu 30 cm hoch; aber auch Margeriten, Löwenzahn, Butter- und Kornblumen, Mohn u.a.m. stehen in voller Blüte. Bei meinem Gang über eine der Wiesen schrecke ich ein Reh auf; in gesichertem Abstand bleibt es stehen. Auch ich bleibe stehen; wir schauen uns eine Weile an und setzen unseren Weg fort.
*
Der unsägliche G 20-Gipfel in Hamburg ist zu Ende. Angeblich hat er über 130 Millionen Euro gekostet. Allein 30.000 Polizisten waren aufgeboten worden, um für die Sicherheit der Politiker zu sorgen. In den Medien wird fast ausschließlich über Gewaltaktionen berichtet. Bilder, die bleiben werden: brennende Autos; Reifen; Mülltonnen. Dazu eingeschlagene Fensterscheiben. Und sogar Plünderungen hat es im Schanzenviertel gegeben; ausgerechnet dort, wo es eine Straße des Kreativen Kapitals gibt.
In den Abschlusserklärungen zum Gipfel stehen lauter Kompromissformeln oder vage Absichtserklärungen. Lohnt sich dafür der Aufwand? Wohl kaum. Aber Frau Merkel hat ihre schönen Fotos und kann sich als große Macherin inszenieren, die die Probleme der Welt löst: Klimawandel; Freihandel; Afrika usw. Hatten wir doch alles schon einmal vor Jahren in Heiligendamm.
Zum Schluss gibt es noch ein Foto, das sie inmitten von Polizisten und Feuerwehrleuten zeigt. Sie ist einfach allgegenwärtig, und das ist genau der Eindruck, den die Medien erzeugen: Macht euch keine Sorgen, Mutti hat alles im Griff. Schlaft ruhig weiter.
*
Nach dem Strandaufenthalt geht es in die Kneipe An der Deichbrücke, von uns Dunkelkneipe genannt, weil es drinnen schummrig und verraucht ist. Auch hat die Kneipe einen zweifelhaften Ruf aus früheren Zeiten, weil hier die Gestrandeten des Wilhelmshavener Nachtlebens landeten: Seeleute; Taxifahrer; Prostituierte u.a. Der Wirt Dieter hatte vor kurzem sein 50jähriges Dienstjubiläum, das mit einem großen Fest gefeiert wurde. Die Presse berichtete ausführlich über das Ereignis. Stolz zeigt er uns die Bilder und Berichte.
Wir sitzen stets draußen vor der Kneipe und schauen auf den vorbei fließenden Verkehr. Mittlerweile kennen wir die meisten Leute und werden herzlich begrüßt.
Bei einer Unterhaltung mit einem älteren Gast fällt der Name Uwe Reehse, z.Zt. Bürgermeister in Wilhelmshaven. Ich frage, ob der früher Fußballer war. Und siehe da: Es ist tatsächlich der ehemalige Torwart von TSR Olympia Wilhelmshaven, den ich 1963, als ich bei Kickers Emden spielte, erlebt habe. Später treffe ich ihn am Rande eines Rockkonzerts und spreche ihn an. Er ist sichtlich überrascht, als ich ihm auch noch das Ergebnis von damals nenne: 3:1 für den TSR Olympia.
*
Habe ein Gedicht mit dem Titel Verheißung für die Aktion Kölner Lyriker gegen rechts geschrieben. Der Text beruht teilweise auf Bibelstellen:
Wie lange warten wir schon
auf einen neuen Himmel
und eine Erde
wo Gerechtigkeit wohnt
wie uns verheißen ward?
Wann wird unser Mund voll Lachens sein
und unsere Zunge die Ankunft der Flüchtigen rühmen?
Zwischenzeitlich bringen wir unsere Jahre hin
wie ein Geschwätz
und es stellt sich die Frage:
Worauf warten wir?
*
Ich bitte meinen alten Deutschlehrer, mir die Situation in Katalonien zu erklären. Er schreibt mir:
Katalonien ist nie aus dem Schatten des Bürgerkriegs herausgetreten. Sehr „spanisch“ ist jene Mentalität, die Interessen und Vorteile verschmäht, nur um den Schatten eines Schicksals zu erjagen. Nun wandern Banken und Unternehmen aus der Region ab. Die Bindung an die EU bleibt ungeklärt. Die Bevölkerung ist längst integriert, durchmischt mit „Einwanderern“ aus anderen Regionen, aber auch aus Nordafrika und aus Lateinamerika. Die an diesem Diskurs nicht teilnehmen, sind zum Schweigen verurteilt; sie werden mit sozialer Ausgrenzung bestraft.
Die Bourgeoisie Kataloniens hat systematisch den Status der Opferrolle ausgebaut.
— Kein Spanisch mehr in den Schulen.
— Keine Verhandlungen über eine generelle Lösung
( a. Föderation statt Autonomie; b. eigene Finanzhoheit)
Die einzige Option heißt NATIONALSTAAT CATALUNYA
Linke und extreme Rechte sind sich einig in dieser Rhetorik. Spanien insgesamt ist ein in Demokratie unerfahrenes Land, Katalonien macht da keine Ausnahme.
Nunmehr kommt noch der europaweite Populismus zu Hilfe, im besten Moment.
Klein aber fein, NOSALTRES SOLS, wir unter uns, heißt die Parole.
Ich bin traurig und resigniert.
herzlich aus Barranquilla (Kolumbien).
*
Mache eine Führung durch Nippes mit, was ich schon länger wollte, seit wir in diesem Stadtteil wohnen. Man erfährt viel Wissenswertes und geht ab jetzt mit anderen Augen durch die Straßen. So gibt es beispielsweise in der Thüringer Straße zwei Stolpersteine zur Erinnerung an das kommunistische Ehepaar Safarowsky. Der Nippesser Geschichtsverein setzt sich dafür ein, dass ein kleiner Weg am Nippesser Tälchen nach ihnen benannt wird.
*
Die ersten Zugvögel ziehen wieder ab. Wie jedes Jahr schauen wir ihnen wehmütig nach und wünschen ihnen eine gute Heimkehr. Jetzt beginnen sie, die Tage, die überfließen von Zeit: die Tage des Lesens und der Besinnung.
*
Habe dem Fotokünstler Rob Herff mein Gedicht Dem Lärm der Wolken lauschen geschickt. Er hatte mir Tage zuvor faszinierende Wolkenaufnahmen gezeigt, die er an der Nordsee aufgenommen hat. Zu meinem Gedicht schreibt er:
Du weißt, dass ich Deine Leidenschaft für die Wolken teile. Ich habe Dein Gedicht als Start in den Tag genutzt und schätze es sehr. Die Auseinandersetzung damit hat mich entschleunigt und belebt zugleich. Also vielen, lieben Dank dafür.
Schon der Titel bricht mit tradierten Vorstellungen und bürstet kräftig gegen ‚den Strich‘ der allgemeinen erwartbaren Metaphern. Diesen Weg setzt Du überzeugend in jeder Strophe fort. An einigen Stellen war ich betroffen, an anderen musste ich schmunzeln, der Schluss geht unter die Haut. Über allem scheint ein Schleier von Wehmut zu liegen. Der Sprachfluss erinnert an den Wellengang am Strand (ich habe es laut gelesen und aufgezeichnet).
Deine Metaphern erschaffen eine eigene, vielschichtige Bildmächtigkeit, in der das Offensichtliche, das Verborgene und Deine Gedanken miteinander ringen. Diese Anmutung gibt sich mal zart, mal salzig und bitter – gelegentlich auch düster. Diese Facetten und das Bewusstsein für die Endlichkeit der Dinge sowie der eigenen Existenz machen Dein Gedicht zu einem lebendigen Stück Lyrik, wie ich finde.
Tatsächlich sehe ich in Deinen ‚Bildern‘ schon auch Überschneidungen zu meinen eigenen Arbeiten. Als das Bild im Anhang im WW aufgenommen war, war ich beeindruckt von der ‚Unhörbarkeit‘ der Tumultes am Abendhimmel.
Wir können ja einmal über ein gemeinsames Projekt nachdenken, wenn Du willst.
Nun denn – so kann es weitergehen im neuen Jahr.
Bildquelle: pixabay, User GDJ, CC0 Creative Commons