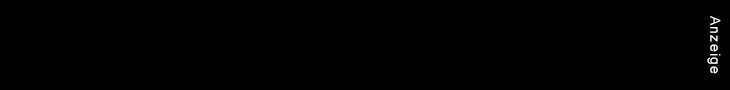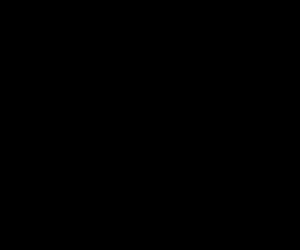Am Morgen nach der für die SPD so verheerenden Bayernwahl mutmaßt die Süddeutsche Zeitung, nun wachse in der Partei der Druck, die Koalition in Berlin zu verlassen. Es ist unwahrscheinlich, dass die Zeitung über nacht diesen Druck hat messen, mit hunderten Sozialdemokrat*innen schon hat sprechen können; einzig der ewige Kevin hat sich bereits so geäußert, wie er sich schon immer äußert und worauf er seine Politkarriere gründet.
Ihm und seinen Gesinnungsgenoss*innen sei gesagt, dass sich Flucht aus der Verantwortung bisher noch nie für eine politische Partei ausgezahlt hat. Die Wahlergebnisse der FDP sind kein Gegenbeweis; diese Partei dümpelt in derselben Größenordnung herum, die ihr schon immer zugestanden wurde – mit Ausnahme der Zeit des zu Recht vergessenen Vizekanzlers Rösler aus dessen Entourage Christian Lindner gerade noch rechtzeitig abgesprungen war.
Altkanzler Schröder hat mit dem gut sozialdemokratischen Satz „erst kommt das Land, dann die Partei“ seine SPD einer politischen Folter unterzogen und ihr bis heute nachwirkenden Schaden zugefügt. Trotzdem bleibt der Satz richtig. Den innerparteilichen Gegner*innen der Großen Koalition in Berlin kann man die Sorge um die SPD nicht absprechen. Aber ihre Analyse ist falsch.
So, wie die SPD sich jetzt darstellt, wird sie durch eine Flucht in die Opposition nicht gerettet werden können. Es ist nicht diese Koalition das Problem, das Problem ist die SPD selbst.
Es sind auch nicht mehr die Schäden, die Gerhard Schröder und Franz Müntefering zu verantworten haben. Das ist 13 Jahre her und der Verweis darauf hat etwas vom Ausruhen auf früheren Lorbeeren – nur als Paradox. Die SPD ruht sich auf alten Fehlern aus und bemerkt die neuen gar nicht. Dagegen hilft auch keine Oppositionsrolle. (Der Autor hat in den 80er und 90er Jahren Opposition erlebt: es ist schon eine Lust, frei von der Leber weg alles kritisieren und die schönsten Forderungen erheben zu können; gleichwohl bedeuten 16 Jahre bundespolitische Wirkungslosigkeit eine gewaltige Frustration – milde ausgedrückt). Die damalige Oppositionszeit war durchaus genutzt worden zur – heute würde man in SPD-Kreisen sagen: „Erneuerung“. Sieben Jahre nach der Abwahl Helmut Schmidts hatte die Partei ein neues, das Berliner Grundsatzprogramm. Gegenstand war – verkürzt gesagt – der durchaus plausible Versuch, soziale Verantwortung, wirtschaftlichen Erfolg und Umweltschutz gleichermaßen umsetzen zu können. Willy Brandt hatte als Chef der noch funktionierenden Sozialistischen Internationale und mit dem Nord-Süd-Bericht die Aufmerksamkeit auf die globale Ungleichheit gelenkt und Hans-Jochen Vogel hatte nach 1982 fulminante aber erfolglose friedenspolitische Wahlkämpfe und Oppositionsjahre angeführt. Es gibt auch Beispiele des Misslingens aus jener Zeit; trotzdem kann man rückblickend das alles getrost Erneuerung nennen.
Heute ist „Erneuerung“ bloß ein Wort ohne Inhalt und damit bedrohlich: statt mehr als 16 Jahre Opposition kann so auch das Ableben der weltweit ältesten demokratischen Partei herbeigeführt werden.
„Erst das Land“ – das dürfte die SPD ruhig etwas modifizieren und sagen „Erst die Menschen, dann die Partei“. Geglaubt würde das aber erst, wenn wieder deutlich würde, was es heute und in Zukunft bedeutet, in einem sozialen Bundesstaat zu leben. Welches Maß an gesellschaftlicher Ungleichheit ist damit noch vereinbar? Welche Balance zwischen individueller Risikobereitschaft und sozialer Sicherheit bedeutet dieser soziale Bundesstaat, darauf den ins Grundgesetz geschrieben zu haben, war die SPD früher stolz gewesen. Was bedeutet Arbeit in Zukunft? Ob man politisch die Mietwohnung oder die Eigentumswohnung favorisiert – unter den nicht neuen Bedingungen des kapitalisierten und wesensmäßig knappen Bodens, schließt beides eine große Zahl Menschen von bezahlbarem Wohnen aus. Eine gründliche Reform des Bodenrechts wäre auch eine – radikalere – Antwort als die – ehrenwerte – Rettung des sozialen Wohnungsbaus und die soeben angekündigte Abgabe bundeseigener Grundstücke an Kommunen zum Zwecke des Wohnungsbaus.
Europa und dessen Militarisierung sind Themen, die dringend der Debatte bedürfen; offenbar aus Furcht vor weiteren Niederlagen lässt die SPD beides rechts liegen. Dabei kann man sicher nicht nur in Frankreich mit Europa mobilisieren und reüssieren. Zum anderen ist die Frage, welcher weltweite Einfluss, welche Rolle Europas es eigentlich gemeint ist, mit denen ständig Aufrüstung begründet wird, außerordentlich interessant.
Gute Beziehungen zu Russland gelten inzwischen fast schon als unmoralisch. Und unmoralische Außenpolitik will niemand. Aber auf welche Moral soll deutsche Außenpolitik gründen? Ist der alltägliche Reflex gegen zweifelhafte Staatslenker moralisch oder ist ein beharrliches Kämpfen für gute Nachbarschaft und friedliche Stabilität der moralische Dienst, den deutsche Außenpolitik zu leisten hat? Fragen, über die schon lange nicht mehr diskutiert wird – dementsprechend unbedarft sind die Antworten, die im heutigen Mainstream gegeben werden. Natürlich muss ein offenes Wort über Migration gesprochen werden. Dass sie vielen Leuten Angst macht, und dass Angst und Ungleichheit die politischen Seismographen eher nach rechts ausschlagen lassen, sind offensichtliche Tatsachen. Die politische Position, gleichzeitig Teil der Willkommenskultur und Beicht-mutter der Ängste vor den Fremden zu sein, ist sicher die schwierigste. Dem zieht die SPD es vor, ihre Position lieber ganz zu verschweigen.
Alle diese Lücken hat die SPD – nach Schröder – offen gelassen. Bayern beweist, dass die personell erneuerten (!) Grünen alle diese programmatischen Vakui auszufüllen beginnen. Sie setzen sich auf den Platz, den die SPD verlassen hat. Und das kann man ihnen nicht verdenken. Sie beweisen, dass der Bedarf an einer SPD des Berliner Programms von 1989 weiterhin besteht. Und die SPD beweist, dass sie diese Partei derzeit nicht ist.
Was wäre wenn diese SPD die Koalition in Berlin verlässt? Natürlich kann man darüber zunächst nur spekulieren. Aber es liegt gelegentlich in der Luft, dass ein erneuter Jamaika-Versuch mit einer anderen CDU-Spitze unternommen und gelingen würde. In dieser Jamaika-Koalition würden sich die Grünen als sozial-ökologisches Gewissen profilieren, die FDP das Wirtschaftswachstum und -wie immer – die Steuerfreiheit der Zahnärzte auf ihre Fahnen schreiben und die Union wäre im Kanzleramt mit dem ganzen Rest beschäftigt. Wenn gilt, dass die SPD die oben genannten Lücken offen gelassen hat, mit welcher Oppositionsstrategie könnte sie sie unter diesen Umständen füllen?
Vor allem: was sollen die Leute denken, denen die SPD mit dem Eintritt in die Koalition bestimmte Versprechen gemacht hat? Europa-, sozial- und wohnungspolitische Versprechen sowie das, für eine stabile Regierung in instabiler Zeit zu sorgen? Diese Leute dürften alle schwer enttäuscht werden – es wären die, die bisher noch nicht von der SPD enttäuscht wurden, oder die die Enttäuschungen tapfer verwunden haben (In Bayern also jene legendären 9,7% vom letzten Sonntag; der Rest, der noch den völligen Untergang verhindert).
Nach wie vor kann eine politische Situation, eine inhaltliche Unvereinbarkeit auf einem auch den Bürger*innen zentral wichtigen Gebiet entstehen, die die SPD zum Austritt aus der Berliner Koalition zwingen könnte. Das allerschlimmste aber, was die Partei machen kann, wäre die Koalition aus dem erkennbar einzigen Grund platzen zu lassen, dass sie sich einen parteiegoistischen Vorteil erhofft, also dem Kevin-Syndrom zum Opfer fällt. Außer dem Juso-Vorsitzenden würde es überbordenden Applaus von Oskar Lafontaine und Sarah Wagenknecht geben, die sich auf das böse Erwachen der SPDler nachdem der Rausch der Erleichterung ausgeschlafen sein wird, schon freuen.
Niemand sagt, dass es in der Koalition leicht ist. Zuletzt hat etwa die SPD-Umweltministerin einen Weg gewiesen, wie man zugleich loyal zu Koalitionsabsprachen stehen und doch eine eigene
Überzeugung deutlich machen kann, als sie nämlich deutlich wider besseres Wissen für nur 30% Emisionsverringerung in Brüssel eintreten sollte und schließlich auch mit mehr, 35% zurück kam.
Anders agiert der Vizekanzler, der sich in der Rolle der grauen Eminenz zu gefallen scheint. Er hat einmal während der Koaltionsverhandlungen gesagt, dass ihm dort sehr deutlich vor Augen gestanden habe, warum er Sozialdemokrat sei. Spätestens nach dem Ende der Verhandlungen hätte es geholfen, wenn Olaf Scholz etwas von seiner Begeisterung über seine eigenen Überzeugungen einer breiteren Öfffentlichkeit zu vermitteln. Oder seine „schwarze Null“ – jeder hätte verstanden, dass es sinnlos ist, Steuern zu erhöhen, wenn man die vorhandenen Einnahmen schon nicht sinnvoll ausgeben kann – aber die mit dem Austeritätsgeruch behaftete, schäuble’sche Parole einfach zu übernehmen, dürfte Erneuerungserwartungen deutlich gedämpft haben.
Beide Beispiele zeigen das Potential, das theoretisch vorhanden ist: die SPD kann in der Regierung deutlich machen, wo und warum sie anders handeln wird, wenn sie die Macht dazu hätte. Sie kann selbst bei Übereinstimmungen – Beispiel schwarze Null – ihre womöglich anderen Gründe zu Gehör bringen und sie kann etwas von der Begeisterung über die eigenen Überzeugungen vermitteln, die es selbst bei einer so kontrollierten Persönlichkeit wie Olaf Scholz zu geben scheint. Zugleich muss sie aufhören, von Erneuerung zu reden. Sie muss es tun. Der Generationswechsel ist quasi vollzogen, der Parteivorstand und die Minister*innen-Riege ist deutlich jünger als zuletzt. Jetzt müssten die von der Ochsentour gestählten Führungsfiguren aber etwas offenbar Ungewohntes an den Tag legen. Auf der Ochsentour etwa von der Juso- zur Parteivorsitzenden oder vom Vizejusochef zum Vizekanzler – lernt man das politische Überleben. Jetzt muss die Begeisterung für die eigenen Überzeugungen hervortreten. Leute, ihr macht das nicht, weil ihr nun einmal Politiker*innen geworden seid, sondern weil ihr für die Sache – besser: für die Leute brennt. Euch interessieren deren Sorgen und alles andere kommt erst sehr viel später.
Zu denjenigen, deren Sache sich die SPD wieder zu eigen machen muss, gehören alle prekär Lebenden und alle, die um ihren Status bangen – das sind diejenigen von denen und für die die SPD dereinst gegründet wurde. Es sind diejenigen, die sich in die Wahlenthaltung und zur AfD abgewendet haben. Wieso sollten diese Leute ausgerechnet zu einer machtlosen SPD zurückkehren?
Andererseits mag es Milieus geben, die der Fürsprache durch die SPD nicht bedürfen. Die darf man als qualitative Volkspartei denn auch ruhig vernachlässigen – beispielsweise Unternehmensvorstände oder Börsenspekulanten und sonstige Menschen mit Einkommen, denen keine entsprechende Leistungen gegenüberstehen. Seit einer Reihe von Jahren ist dank einer von der Ebertstiftung beauftragten großen Milieustudie bekannt, dass die SPD in nahezu allen erfassbaren sozialen Milieus verankert ist (war?) aber überall nur bis höchstens zu einem guten Drittel. Inhaltliche Klarheit in der Interessenvertretung könnte auch eine Konzentration auf alle, die die SPD leidenschaftlich vertreten will, bedeuten.
Themen liegen auf der Straße, manche haben es durch die SPD bis in den Koalitionsverrtag geschafft. Die Genesung sozialdemokratischer Politik braucht vielleicht nur noch gestalterische Risiko- und kluge politische Konfliktbereitschaft.
Bildquelle: Wikipedia, gemeinfrei