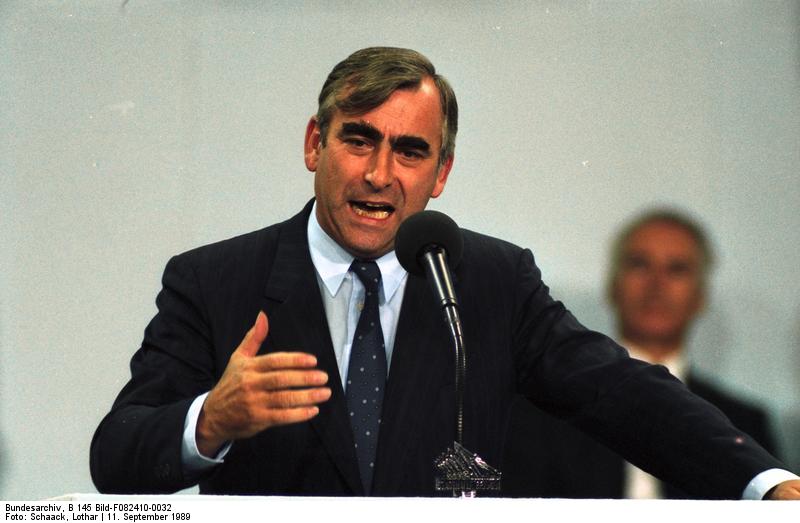Millionen Menschen sind oft von privaten und politischen Ängsten gepeinigt. Was sind die Gründe für die kollektiven Gefühlslagen der Deutschen? Seit dem Zweiten Weltkrieg kennt Deutschland „Angstwellen“, die heranrollen und langsam wieder abebben. Bei der Zuwanderung bleibt aber eine Mehrheit cool.
 „Da war plötzlich heute morgen ein verdächtiges Geräusch,“ berichtete Erika Potschka atemlos den Polizeibeamten in Bornheim / Rheinland. „Ich dachte sofort an einen Einbrecher, vielleicht einer von den Flüchtlingen aus dem Container am Ortsrand“, erklärte sie den Beamten, die zunächst nichts fanden. Als sie dann den Dachboden inspizierten, sahen sie den „Einbrecher“ durch eine offene Dachluke entwischen: Es war das Eichhörnchen „Fritz“ das tagsüber in der Tränenkiefer im Garten hauste. Wie die Beamten nebenbei erfuhren, hatte die alte Dame für den Fall einer Zwangsbelegung ihres Hauses durch Flüchtlinge alle Familienmitglieder aufgefordert, bei ihr einzuziehen. Das sei niemals geplant oder auch nur diskutiert worden, beruhigten sie die Polizisten. Das Beispiel zeigt, welche absurden Ängste eine geschürte Hysterie auslösen kann.
„Da war plötzlich heute morgen ein verdächtiges Geräusch,“ berichtete Erika Potschka atemlos den Polizeibeamten in Bornheim / Rheinland. „Ich dachte sofort an einen Einbrecher, vielleicht einer von den Flüchtlingen aus dem Container am Ortsrand“, erklärte sie den Beamten, die zunächst nichts fanden. Als sie dann den Dachboden inspizierten, sahen sie den „Einbrecher“ durch eine offene Dachluke entwischen: Es war das Eichhörnchen „Fritz“ das tagsüber in der Tränenkiefer im Garten hauste. Wie die Beamten nebenbei erfuhren, hatte die alte Dame für den Fall einer Zwangsbelegung ihres Hauses durch Flüchtlinge alle Familienmitglieder aufgefordert, bei ihr einzuziehen. Das sei niemals geplant oder auch nur diskutiert worden, beruhigten sie die Polizisten. Das Beispiel zeigt, welche absurden Ängste eine geschürte Hysterie auslösen kann.
So wie Frau Potschka haben Millionen Deutsche irreale und reale Ängste. Im Ausland sind diese, bisweilen panischen Reaktionen, als „German Angst“ bekannt. Schon unsere niederländischen Nachbarn mokieren sich darüber, dass die Deutschen nur mit einem Sturzhelm auf das Fahrrad steigen. Ein bekannter französischer Journalist, der lange Zeit in Bonn arbeitete, analysierte: „Die Deutschen befürchten immer gleich das Schlimmste“.
Die Angst vor der Zuwanderung wird künstlich befeuert

Was sind nun die Ursachen dafür, dass unsere Landsleute weniger gelassen sind, als die Menschen in unseren Nachbarländern? Eine Ausstellung im Bonner „Haus der Geschichte“ mit dem Titel „Angst“ versucht, diesen Gefühlslagen auf die Spur zu kommen. Immer wieder gibt es in Teilen der Bevölkerung Angstwellen z.B. vor atomarer Bedrohung, Digitalisierung und Globalisierung. Seit 2015 gibt es sie durch die Zuwanderung von Armuts- und Kriegsflüchtlingen. Der Klimawandel rangiert derzeit wohl berechtigt an der Spitze der deutschen kollektiven Ängste. Obwohl die Zuwanderung von Armuts- und Kriegsflüchtlingen von Medien und interessierten Politikern befeuert wird, bleibt der größte Teil unserer Landsleute mehrheitlich cool. Viel mehr Sorgen machen sie sich über den politischen Extremismus und künstliche Intelligenz, die Arbeitsplätze kostet.
In der Politik verführt der Machterwerb dazu, die latenten Ängste vor den Fremden zu schüren. In der Realität zeigt sich das Zusammenleben wesentlich positiver. Dabei bewertet eine Mehrheit der Deutschen nach dem Integrationsbarometer des Sachverständigenrates „Deutsche Stiftung für Integration und Migration“ ganz im Gegensatz zu der oft lautstark geführten öffentlichen Debatte, dass die Migration das Land kulturell und wirtschaftlich bereichert (64%). Dementsprechend haben die Zuwanderungen in den Jahren 2015 und 2016 ein spontanes, freiwilliges Engagement ausgelöst, dass es in der Bundesrepublik vorher so nicht gab. Nach einer Untersuchung der Bertelsmann Stiftung waren 8 Millionen Bürgerinnen und Bürger an der Erstversorgung der Flüchtlinge beteiligt. Ihr Motto: Nichts tun ist keine Lösung. Der Sänger und Schauspieler Herbert Grönemeyer meinte in einem Interview: „Ich halte die Situation mit den Geflüchteten für einen Glücksfall. Wir sind nun gezwungen, Empathie zu entwickeln und ich finde es äußerst beeindruckend, wie viele Menschen in Deutschland das getan haben und sich nach wie vor um Geflüchtete kümmern. Das macht mir tierisch Mut und darin sehe ich eine Riesen-Chance. Aber die Politik hat diese einzigartige Situation, in der etwas sehr Identitätsstiftendes für die Gesellschaft drin steckt, schleifen lassen.“
Nichts tun ist keine Lösung

„Wir schaffen das“ sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, als sie im September 2015 für die im Budapester Bahnhof vegetierenden Menschen, darunter viele ohne Nahrung, sanitäre Anlagen und ärztliche Versorgung, die Grenzen offen ließ. Sie hatte es aber versäumt, die Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und über die Folgeprobleme zu informieren. Das führte zu einem Riss durch die Gesellschaft. Zahlreiche von ihnen sind noch heute in ca. 60.000 Initiativen und Integrationsprojekten aktiv. Man kann, ohne in Pathos zu verfallen, von einem helfenden Deutschland sprechen. Die konkrete Hilfe, ohne die ehrenamtliche Integrationsarbeit, ist kaum zu bewältigen. Man assistiert bei Behördengängen, Einstieg in die Arbeitswelt, der Kinderbetreuung, der Kleiderhilfe und bei der Wohnungssuche. Für die verdienstvolle Arbeit fehlte es bisher an bundesweiter öffentlicher Anerkennung. Stattdessen wurden die Helfer herablassend als „Gutmenschen“ oder „Durchschnittsspießer“ bezeichnet. Alle mit der schnellen Zuwanderung auftauchenden Probleme, wie bezahlbaren Wohnraum, Engpässe in den Schulen und Kitas sowie bei den einfachen Arbeitsplätzen, fanden regelmässig in den Medien und sozialen Netzwerken ihre Niederschläge und Hasskommentare. Jede Straftat, eines meist jugendlichen Ausländers, konnte man in den Boulevardblättern als Aufmacher in den ersten Seiten lesen. Den Machern ging es um die Steigerung der Auflage. Dass die Kriminalität seit Jahren zurück geht, erreichte die ängstlichen Menschen, wie z.B. Frau Potschka, nicht. Sie ließ sich eine Sicherheitstür für 5.000,- € einbauen und trägt immer, wenn sie ausgeht, ein Pfefferspray in ihrer Handtasche. Die Sicherheitsbranche boomt wie nie. Auch für sie ist die Angst ein gutes Geschäft. Die Erzählung über Deutschland als ein helfendes Land fehlt bis heute.
Wir brauchen Leuchttürme
Es gibt zahlreiche Formen von allgemeinen bis individuellen Ängsten, von der Spinnenphobie bis zu den Dränglern und abrupten Abbiegern auf der Straße. Am häufigsten grassieren die Ängste vor dem Verlust des Arbeitsplatzes, vor schwerer Krankheit auch in der Familie, oder vor Konflikten in der Partnerschaft.
Es macht wenig Sinn, die privaten und politischen Ängste akkurat zu trennen, denn die Ängstlichen vermischen alles. Mit Belehrungen und Informationen ist ihnen kaum beizukommen. Elementare Krisen wie Krankheit oder Scheidung, aber auch der tägliche Wahnsinn im Stau führen zu Streß und gefährden damit die Gesundheit.
Wie kann man nun die privaten und politischen Ängste bei sich selbst bekämpfen? Durch mutige Vorbilder in der Familie oder im Bekanntenkreis. Jedes Land braucht Leuchttürme in der Gesellschaft.
Als kürzlich in Christ Church, Neuseeland, ein rechtsextremer Terrorist 50 Betende in einer Moschee erschoß und zahlreiche fliehende Menschen schwer verletzte, trauten sich viele muslimische Frauen nicht mehr mit einem Kopftuch aus dem Haus. Am Tag nach der Terrorattacke hatte die Premierministerin Jacinda Ardern beim Besuch der Angehörigen der Opfer einen schwarzen Hidschad angelegt, ein berührendes Signal, das um die Welt ging.
Wer braucht die Angsthasen?
Die individuellen Ängste werden schon beim Kind durch Enge im Denken durch das Elternhaus verursacht. Sie führen zu innerer Not und Verklemmtheit. Ein erwachsener Mensch kann Prägungen nur noch verstärken oder abmildern, sagt der Bremer Neurowissenschaftler Gerhard Roth. Selten ist ein Fall, wie der von Maria Burkhard, die ein Richter in Frankfurt / Oder wegen fortgesetzter Hetze gegenüber Flüchtlingen in der Nachbarschaft zu 4 Wochen Sozialarbeit in einem Flüchtlingsheim verurteilte. Sie ging nach diesem Zeitraum weiter dorthin, um freiwillig zu arbeiten. Frau Burkhard hatte unter den Fremden Freunde gefunden. Angst ist auch ein Schutzmechanismus. Er wohnt seit Urzeiten in uns Menschen. Damals wie heute geht es oft um Fliehen oder Standhalten. Heute sind diese Reflexe oft ein schlechter Ratgeber. Diese unbewussten Motive schlummern in uns. Schon die Kinder müssen lernen, die eigenen Gefühle zu verstehen und dabei richtig zu reagieren. Nur so begreifen sie, diffuse Ängste von realer Furcht zu unterscheiden. Die ängstliche Erika Potschka orientierte sich am Nachbarn. Der hatte ihre Sorgen nur verstärkt. Sie ist auch ein williges Opfer von rechtsextremer oder nationalistischer Gesinnung. Schon 2015 sagte die ehemalige AfD-Vorsitzende Frauke Petry „Wir brauchen die Ängstlichen um Mehrheiten zu bewegen.“ In Finnland, dort wo nach eigener Einschätzung die glücklichsten Menschen Europas leben, wurden „Die Finnen“, eine rechtsextreme Partei, als zweitstärkste Fraktion in das Parlament gewählt. Ihre zentrale Botschaft war die Angst vor den Flüchtlingen. Ihre größten Erfolge hatte die Partei dort, wo es keine Fremden gab. Für uns alle bedeutet das, überall dort, wo die Ansteckungsgefahr besteht, das Gespräch zu suchen. So bleiern es klingt: Wir dürfen die Hoffnung nie aufgeben.