Für die Demokratie gibt es bessere Regierungskonstellationen als Große Koalitionen. Aber wenn eine Große Koalition die einzige Konstellation ist, die Regieren möglich macht, dann wäre es den Wählern gegenüber ungehörig, diese Chance zu vertun. Zumal die anstehende Große Koalition so klein ist, dass sie gerademal gut die Hälfte der Stimmen hinter sich gebracht hat. Diese Art von Großen Koalitionen können in einem Sieben-Parteien-Parlament eher Regel als Ausnahme werden, so lang die eine der kleineren Parteien, die FDP, keine Verantwortung übernehmen will und die andere, die AFD, mit dieser Verantwortung nicht betraut werden sollte.
Die SPD muss sich entscheiden, ob sie dem Rechnung tragen und sich erneut auf ein Bündnis mit der CDU/CSU einlassen will. Jusos, der linke Flügel und manche Landesverbände wie der größte unter ihnen, NRW, wehren sich heftig. Befallen von einer regelrechten Groko-Phobie. Nicht alle, aber viele ihrer Argumente unterliegen allerdings einer politischen Lebenslüge, einer bequemen dazu. Einseitig muss da die Groko, die letzte und die von 2005 bis 2009, als Grund für die mangelnde Wählerakzeptanz der SPD her halten. Dieser Selbstbetrug ersetzt die Analyse, die immer versprochen war, aber nie stattgefunden hat, um sich endlich einmal ehrlich zu machen über den Zustand der SPD.
Es gibt viele strukturelle Gründe, die auch in anderen europäischen Ländern zu besichtigen sind. Die Auflösung der Milieus, aus denen sich Sozialdemokratie speiste, der Reiz linker und rechter Populisten, die Sozialdemokratisierung konservativer Parteien, die Angela Merkel in Perfektion betrieben hat.
Eine Partei der Egotrips
Aber es gibt für die deutsche Sozialdemokratie auch hausgemachte Ursachen, die seit Jahren unter den Teppich gekehrt werden: personelle Fehlentscheidungen, vergiftete Umgangsformen, Selbstherrlichkeiten, der Verzicht vieler, sich für das Wohl der gesamten Partei einzubringen. Eine Partei der Egotrips.
Statt einseitig die Groko und die Dominanz Angela Merkels für das Wahlergebnis von 23.3 Prozent im Jahr 2009 verantwortlich zu machen, wäre es hilfreich und ehrlich, einmal Revue passieren zu lassen, wie sich die Partei in diesen Jahren präsentiert hat. Von der Wahl 2005 bis zu der Wahl 2009 vier verschiedene Parteivorsitzende: bis zum 31. Oktober 2005, die Koalitionsverhandlungen waren noch gar nicht abgeschlossen, Franz Müntefering. Der trat zurück, weil er Andrea Nahles, die ihm der Parteivorstand als Generalsekretärin vorsetzte, nicht ertragen wollte. Mit politischen Inhalten, mit Politik hatte das weniger zu tun als damit, dass die Partei den autoritären Führungsstil Münteferings nicht mehr zu tragen bereit war.
Platzeck wurde düpiert
Auf Müntefering folgte im November 2005 Matthias Platzek. Der damalige Ministerpräsident von Brandenburg spürte schnell, dass Müntefering zwar den Parteivorsitz abgegeben hatte, aber als Vizekanzler und Arbeitsminister weiterhin den Takt vorgeben wollte. Er düpierte Platzek vor der Vorstandsklausur der Partei im Januar 2006 in Mainz, als er über „Focus“ ankündigte, das Rentenalter auf 67 Jahre anzuheben. „Kein Herzensanliegen der Partei“, reagierte der SPD-Vorsitzende hilflos und resigniert. Müntefering, der den Parteivorsitz mal als „schönstes Amt nach Papst“ bezeichnet hatte, tat alles, dass es seine Nachfolger nicht nur als schön empfanden. Platzek war der Dominanz des Sauerländers nicht gewachsen. Gesundheitlich angeschlagen gab er im April 2006 auf.
Auch mit dessen Nachfolger Kurt Beck legte sich Arbeitsminister und Vizekanzler Müntefering an, erlaubte sich zum Schaden der Partei einen monatelangen Streit um die von Beck, der Partei und der Koalition gewollte Verlängerung des Arbeitslosengelds I, musste sich schließlich einem Parteitagsbeschluss und den Vorgaben der Koalitionsvereinbarungen beugen. Die Niederlage wusste er mit einem edelmütigen Motiv zu überspielen: Er zog sich im November 2007 als Vizekanzler und Minister zurück, um seine Frau Ankepetra zu pflegen.
Kampagne gegen Beck
Von da an setzte eine Kampagne gegen den gewiss nicht immer glücklich agierenden Vorsitzenden Beck ein. Journalisten, die es wissen wollten oder auch nicht, wurden mit bösen Sottisen aus dem Umfeld Münteferings, ob mit oder ohne sein Wissen, über den Provinzpolitiker gefüttert. Der verstrickte sich zudem in ein Glaubwürdigkeitsproblem der SPD, das die hessische Landesvorsitzende Andrea Ypsilanti ihrer Partei beschert hatte. Vor den Landtagswahlen im Januar 2008 hatte sie eine Zusammenarbeit mit der Linken ausgeschlossen und strebte genau diese nach der Wahl an, nachdem die SPD der CDU knapp unterlegen war. Eine monatelange Debatte war die Folge, der hessische Landesverband drohte zu zerbrechen und Beck schlug sich – vermutlich unbedacht – in einem Hintergrundgespräch auf die Seite von Ypsilanti. Ausgerechnet im Wahlkampf der Stadt Hamburg. Ein Danaer-Geschenk, für das sich der damalige Hamburger Bürgermeisterkandidat Michael Naumann mit bösen Spitzen gegen den SPD-Vorsitzenden bedankte.
In dieser Situation geriet Beck, der sich die Spitzenkandidatur für die Bundestagswahlen offen halten wollte, weiter unter Druck. Im September, als er sich dazu durchgerungen hatte, Frank Walter Steinmeier als Spitzenkandidat für 2009 vorzuschlagen, warf er hin, weil gestreut wurde, der Verzicht auf die Kandidatur sei keine souveräne Entscheidung Becks gewesen, sondern man habe ihm die Pistole auf die Brust gesetzt. Und wie ein Phönix aus der Asche übernahm der alte Vorsitzende Müntefering wieder das Kommando im Willy-Brandt-Haus. Mit Mitarbeitern, die das Klima gegen die zuvor amtierenden Parteichefs vergiftet hatten.
Einblick in das Schlangennest
Wer auch nur peripheren Einblick in dieses Schlangennest hatte, hätte diese Partei als führende Kraft stärken mögen? Und umgekehrt: Wer sich als Parteimitglied dieses vier Jahre währende Desaster vor Augen führt, der muss blind sein, wenn er sich einredet, das katastrophale Wahlergebnis von 23.8 Prozent im Jahr 2009 sei das bloße Ergebnis einer vorausgegangenen Großen Koalition gewesen.
Wenn auch aus anderen Gründen, so ist das niederschmetternde Wahlergebnis vom September 2017 ebenfalls nicht monokausal auf die GroKo und die Dominanz von Merkel zurückzuführen.
Zwar gab es im Parteivorsitz mit Sigmar Gabriel seit 2009 Kontinuität. Die aber wurde zunehmend durch dessen Sprunghaftigkeit überlagert. Eine solide sozialdemokratische Regierungsarbeit wurde in der Groko ab 2013 zunehmend weniger wahrgenommen, weil sie zum einen das Feuerwerk ihrer Ideen – wie der Mindestlohn – allzu früh verschossen hatte und außer Stande war, neue Ideen nachzulegen. Zum anderen erlebten die Menschen zwar einen lang agierenden, aber immer übel launiger daher kommenden Parteivorsitzenden Gabriel. Bei seinen Mitstreitern in der engeren Parteiführung staute sich zwar der Unmut an, aber er reichte nicht zum Mut, den Parteichef zu bändigen.
Über weite Strecken der Legislaturperiode schien es und ließ Gabriel es scheinen, als sei die wichtigste Frage der Republik, ob er die Courage habe, 2017 als Kandidat anzutreten. Zunehmend stieß er zudem die Mitstreiter in der Parteiführung vor den Kopf. Die distanzierten sich, ohne jedoch den Schneid zu haben, Tacheles zu reden. Das Lied der SPD über ihren Vorsitzenden war nur Klage. Aber niemand hatte den Mumm, ihm entgegen zu treten.
Gabriels Rückzug aus Gefallen an sich selbst
So hat es schon eine besondere Ironie, dass sich Gabriel Anfang 2017 selbst aus dem Verkehr zog. Als Kanzlerkandidat und als Parteivorsitzender. Allerdings weniger als Dienst an der Partei als aus Gefallen an sich selbst. Er wollte die Verantwortung für das Desaster nicht mehr tragen, das er der Partei beschert hatte: rechtzeitig und zu einem vernünftigen Zeitpunkt zu erklären, ob er antreten wolle. Die Kandidatenfrage bescherte er der Partei wieder einmal als Sturzgeburt, so wie schon die Kandidatur Peer Steinbrücks 2012 als Sturzgeburt über die Partei gekommen war.
Gejubelt über den Verzicht Gabriels haben die Genossen 2017, weil sie ihn los wurden, statt mal kritisch zu hinterfragen, warum er den Parteivorsitz weggeworfen hat, um sich auf das Image bringende Amt des Außenministers einzurichten.
Der Befreiung von Gabriel folgte ein Schulz-Hype, der von den Verantwortlichen in der Partei an keiner Stelle hinterfragt worden ist. Die irreale hundert Prozent Zustimmung auf dem Parteitag im vergangenen März wurde unzulässigerweise auf die Wähler hochgerechnet. Schulz hatte weder ein Team noch einen Plan. Das Feuerwerk, die Bewegung, die seine Nominierung in die Politiklandschaft gebracht hatte, ließ er verglimmen, weil er inhaltlich nichts hatte, um diesen Hype am Brennen zu halten. Hinzu kam, dass ihm die Wahlniederlagen in Schleswig-Holstein und NRW im Mai zusätzlich den Wind aus den Segeln nahmen. Niederlagen, die aus unterschiedlichen Gründen selbst verschuldet waren. Aber statt in sich zu gehen mit Kritik an der eigenen Regierungsarbeit unter Ministerpräsidentin Hannelore Kraft pflegte die NRW-SPD das Vorurteil, ihr Scheitern sei Ergebnis der Großen Koalition in Berlin gewesen.
Genossen müssen sich ehrlich machen
Die SPD muss sich endlich ehrlich machen, dass es nicht nur Grokos sind, die für ihre Wählerakzeptanz verantwortlich zeichnen. Der fromme Glaube, die Partei könne sich nur in der Opposition erneuern, erinnert an die Mahnung Willy Brandts, die „Weltmacht“ SPD beschäftige sich zu häufig mit sich selbst und überschätze ihre Möglichkeiten. Heute mehr denn je. Die Groko ist keine verlockende Vorstellung. Aber immer noch wünschenswerter als Neuwahlen, die vermutlich vor allem der AFD mehr Stimmen bringen. Ganz unabhängig von der Frage, mit wem die SPD als Spitzenkandidat in eine solche Wahl ziehen sollte. Bei einem Nein des Parteitags zu Koalitionsverhandlungen wäre die gesamte Spitze, die solchen Verhandlungen zugestimmt hat, geschädigt; der Parteivorsitzende wäre weggefegt. Das nächste Desaster zeichnete sich ab.
So unerfreulich das für viele in der Partei sein mag, in dem aufgefächerten Parteienspektrum der Republik bedarf es eines doppelten Kraftakts der SPD: Sich erneuern und mitgestalten.
Bildquelle: pixabay, User Gellinger, CC0 Creative Commons

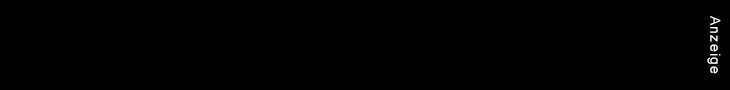



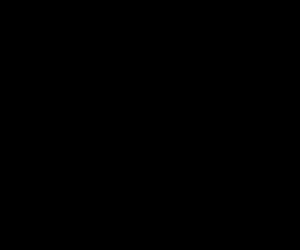












Genau so ist es und genau so war es. Der Artikel sollten auf dem Bonner Parteitag am Samstag verteilt werden!