Gelebte Demokratie ist in diesen Tagen ein Qualitätsmerkmal der SPD. Es zeichnet die Sozialdemokraten aus, dass und wie sie auf einem Sonderparteitag um die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen gerungen haben, es ehrt sie auch, das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen ihren Mitgliedern zur Abstimmung vorzulegen. In krassem Gegensatz dazu stehen allerdings die Personalentscheidungen, die der Parteivorsitzende Martin Schulz von oben herab verkündet. Das hat nichts mit Neuanfang und Erneuerung zu tun, sondern ist ein Rückfall, der die Basis vor den Kopf stößt und der vorbildlichen Debatte der letzten Monate viel von ihrer Glaubwürdigkeit nimmt.
Martin Schulz macht es zum zweiten Mal. Noch am Abend der verlorenen Bundestagswahl vom 24. September sagt er nicht nur, dass es mit der SPD keine Neuauflage der Großen Koalition geben und dass die SPD in die Opposition gehen werde, sondern er teilt en passant auch mit, dass Andrea Nahles den Vorsitz der SPD-Fraktion übernehme.
Das roch schon sehr nach Gutsherrenart, wird jetzt aber noch einmal übertroffen mit dem höchsten Parteiamt. Das will Schulz – nach eigenen Wahlergebnissen von 100 und 80 Prozent – vorzeitig zurück- und an Andrea Nahles übergeben. Selbstherrlich, überheblich und prinzipienlos. Ein Unding, selbst wenn die Stimmung an der Basis nach einem Wechsel sein mag: Parteivorsitzende werden nicht ernannt, sondern gewählt. Das ist ein ehernes Prinzip der innerparteilichen Demokratie.
Ob abgesehen vom schlechten Stil die auserwählte Person die richtige ist, mit der die SPD erstmals in ihrer über 150jährigen Geschichte eine Frau an ihre Spitze wählen will, ist schwer auszumachen. Während Andrea Nahles nach dem Sonderparteitag in Bonn zur Kämpferin stilisiert wurde, die dem Parteivorstand die knappe Mehrheit für Koalitionsverhandlungen gerettet habe, weckte ihre Ausdrucksweise auch Unbehagen. „In die Fresse“… „bis es quietscht“… „bätschi“ bleibt wohl noch eine Weile reflexhaft mit der Nennung ihres Namens verbunden.
Welchen Einfluss die Personalien auf das Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag haben, lässt sich nicht vorhersehen. Ist da mehr Erleichterung über den Rückzug von Martin Schulz vom Parteivorsitz, oder mehr Empörung über sein Streben ins Ministeramt, seine Wortbrüchigkeit, sein mehrfaches Umfallen? Als Stimmvieh jedenfalls lässt sich die SPD-Basis nicht behandeln. Und so sind neben den inhaltlichen Schwächen des Koalitionsvertrages und den Zumutungen in der Kabinettsliste neue hausgemachte Ärgernisse im Spiel, die dem NoGroKo-Lager in die Hände spielen. Wer eben noch geneigt war, dem ungeliebten Regierungsbündnis zähneknirschend zuzustimmen, könnte sich nun eines Besseren besinnen. Das Argument, die Erneuerung der Partei sei auch in der Regierung möglich, hat jedenfalls kräftig an Überzeugungskraft eingebüßt.
Bildquelle: pixabay, User fsHH, CC0 Creative Commons

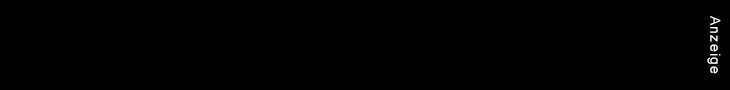



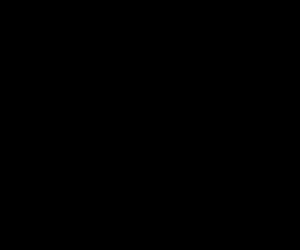











Haltung ist durch nichts zu ersetzen. Eine Umkehr vom Gang in die Opposition in die (auch vom Wähler) ungeliebte, immer kleiner werdende „grosse Koalition“ war schwierig darzustellen, letztlich aber wahlergebniskonform und auch ein gutes Stück verantwortungsvoll. Der persönliche Anspruch von Martin Schulz ist aber offenbar ein anderer: das gewünschte Amt geht über alles hinaus, was vorher formuliert (Inhalte, Erneuerung) wurde. Mittlerweile hat sich das Rad weiter gedreht und Martin Schulz wurde offenbar durch Reaktionen von der Basis eingefangen. Wenn nicht jetzt, also ab sofort und auch weniger egozentrisch die programmatische und personelle Erneuerung der SPD angegangen wird, sehe ich buchstäblich schwarz für diese Partei. Ganz nebenbei bedient man die von Populisten gepflegten Stereotypen. Die Wortwahl von Andrea Nahles mag manchmal anstrengend sein, die Legitimation für das Amt des Parteivorsitzenden steht noch aus. Aber nach dem Abgang von Martin Schulz ist die Chance auf eine Erneuerung der Partei gestiegen. Schade, dass er das selber erst so spät bemerkt hat.