Willy Brandt ist schon lange tot. Vergessen ist der im Oktober 1992 im rheinischen Dorf Unkel verstorbene einstige SPD-Vorsitzende , Bundeskanzler und Friedensnobelpreisträger nicht in der SPD und man hat dein Eindruck, dass die Suche nach einem Nachfolger des großen alten Mannes immer wieder neu aufgenommen wird. Man bräuchte ihn wieder, einen wie Willy, der die Jungen, die Mürrischen, die wegen der Klimakatastrophe Protestierenden auf sich zieht, der den Nachdenklichen ein neues politisches Zuhause geben könnte, weil er selber nie fertige Antworten parat hatte, weil er selber nachdenklich war und faszinierend auf Junge wie Alte, auf Frauen wie Männer wirkte. Bei ihm hat es ja gestimmt, die Sache mit den Visionen, da musste man nicht zum Arzt. Man denke an seine Ostpolitik, an Wandel durch Annäherung. Er setzte sich mit einem wie Kurt-Georg Kiesinger an den Tisch der Großen Koalition, weil er mitregieren, am Ende gestalten wollte, auch wenn ihm dann mal der Halbsatz mit „dem alten Nazi“ rausrutschte, von dem er, der vor den Nazis geflohen war, sich nichts sagen lassen wollte. Einen wie Willy Brandt werden sie aber nicht finden, die Sozialdemokraten. Gerade heute, da die SPD schon längst keine Volkspartei mehr ist, sondern Gefahr läuft, ernsthaft um ihre Existenz kämpfen zu müssen. In Umfragen rangiert die älteste deutsche Partei gerade noch- je nach Institut- zwischen 11 und 14 Prozent der Stimmen.
156 Jahre alt ist die einst stolze SPD. Wenn ich Hans-Jochen Vogel früher in Bonn fragte, wie es denn weitergehen solle mit der SPD, die gerade wieder auf Talfahrt war, antwortete er. „Wir haben schon andere Krisen überlebt, Bismarcks Sozialistengesetz, die Nazis, die Kommunisten.“ Stimmt, aber damals war die SPD zumindest die stärkste Oppositionspartei, sie war personell gut aufgestellt. Nach dem Rücktritt von Brandt standen die von ihm so genannten Enkel bereit, die Macht zu übernehmen, die Schröders, die Lafontaines, die Engholms, Scharpings, Renate Schmidt, Johannes Rau und wie sie alle geheißen haben mögen. Und heute gibt es ein Trio, das der Partei vorsteht und nach dem schmählichen Ende von Andrea Nahles den Übergang zu einer neuen Spitze organisieren soll. Keiner aus dem Trio, weder Malu Dreyer, noch Manuela Schwesig oder Thorsten Schäfer-Gümbel will selber die Führiung übernehmen, auch einer wie Olaf Scholz hat Nein gesagt, wobei die Frage gewesen wäre, ob ihn überhaupt jemand gerufen hätte.
Wer alles die SPD geführt hat
Ja, die Führungsfrage wird gestellt und man denkt automatisch an all die, die mal SPD-Chef waren, die abtraten oder zurücktreten mussten, weil man es ihnen nicht mehr zutraute. Gerade habe ich das Buch „Machtverschiebung“ des Journalisten und früheren Berliner Bürochefs der FAZ, Günter Bannas, gelesen, ein Kenner der politischen Szene in Bonn wie in Berlin. In dem Kapital „Stets in der Krise- die SPD“ zählt er auf, wer alles die Partei geführt hat. In den ersten 40 Jahren der Bundesrepublik gab es vier SPD-Vorsitzende: Kurt Schumacher, den die Nazis fast zum Krüppel gemacht hatten, Erich Ollenhauer, ein eher biederer Genosse, Willy Brandt, der von Berlin geschickt wurde, um der SPD zu Regierungsruhm zu verhelfen, und Hans-Jochen Vogel, der erfolgreicher OB in München war, ehe er Minister in den Kabinetten von Brandt und Helmut Schmidt wurde, und der 1987 Brandt als Parteivorsitzender ablöste. In den 30 Jahren danach, schreibt Bannas, „wurde der Parteivorsitzende elf Mal ausgewechselt, die kommissarischen Vorsitzenden nicht mitgerechnet: Björn Engholm, Rudolf Scharping, Oskar Lafontaine, Gerhard Schröder, Franz Müntefering, Mathias Platzeck, Kurt Beck, noch einmal Müntefering, Sigmar Gabriel, Martin Schulz und Andrea Nahles“. Zeiten gab es, erinnert der Autor an die nicht immer ruhmreiche Vergangenheit der Sozis, „in denen die SPD ihre Vorsitzenden auswechselte wie Abstiegskandidaten in der Bundesliga ihre Trainer, allein zwischen 2004 und 2009 fünf Mal.“ Bannas kennt sich aus, nicht nur in der Politik, er ist Fuball-Fan des 1. FC Köln und hat vor Jahresfrist den Abstieg seiner Kölner miterlebt wie vor einigen Wochen wieder mal einen Trainerwechsel in der Domstadt.
Es gab Zeiten, da die SPD stärkste Partei war, den Bundespräsidenten, den Bundeskanzler und den Bundestagspräsidenten stellte. 1998 hatte die Partei mit ihrem damaligen Kanzlerkandidaten Gerhard Schröder 40,9 Prozent der Stimmen gewonnen und den alternden Helmut Kohl als Kanzler abgelöst. Knapp 20 Jahre später hatte sich ihr Stimmenanteil halbiert. Ein Sinkfug, der sich über Jahre hinzog, man rutschte unter die 30 Prozent-, dann unter die 20 Prozentmarke, in Ländern wie Bayern haben die Genossen bei der letzten Landtagswahl sogar die 10-vh-Hürde verfehlt. Bei den Landtagswahlen im Osten im Herbst droht ihnen der weitere Abstieg. Zur Erinnerung noch dies: die SPD hat mal in neun von sechzehn Bundesländern den Regierungschef gestellt, in Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, NRW, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein. Und auch in Hessen war sie mal vorn. Lang her.
Die eigenen Kanzler heruntergemacht
Heute sieht sich die Partei, gegen die selbst eine Angela Merkel allein nicht viel ausrichten konnte, weil die SPD den Bundesrat dominierte, in einer Existenzkrise, in die sie sich aber auch zum Teil selber hereingeredet hat. Denn auch das muss man erwähnen: die SPD hat immer wieder das Kunststück fertgiggebracht, sich und ihre Kanzler und Minister um ihre Erfolge zu reden. So machte sie den Kanzler Gerhard Schröder und dessen Agenda-Reformen verantwortlich für den Abstieg der Partei, der sich ja auch in erheblichen Mitgliederverlusten niederschlug. Ohne Schröder in Schutz nehmen zu wollen, die Agenda-Reformen geschahen vor dem Hintergrund von fünf bis sechs Millionen Arbeitslosen, die Reformen werden in vielen Teilen der Welt kopiert, ja man hat die Deutschen teils um ihre angeblich moderne Struktur ihrer Arbeits- und Wirtschaftswelt beneidet. Nicht so die SPD, die mit dem Finger auf ihren ehemaligen Kanzler zeigte. Aber das hat sie damals auch mit einem wie Helmut Schmidt gemacht und lange gebraucht, bis sie dessen Leistungen in ein rechtres Licht rückte.
Eine Doppelspitze soll es richten, aber wer kann es, wem traut man es zu? Dass einer wie der NRW-SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty sich gemeldet hat, kann man als mutig bezeichnen, wenn man es positiv sehen will. Der Mann sollte erstmal zu Hause für Ordnung sorgen. Kutschaty kommt aus Essen und dort werden die Verhältnisse in der örtlichen SPD als ziemlich chaotisch beschrieben. Hat man nicht erst die Kommunalwahl verloren? In Essen ist ein CDU-Politiker Oberbürgermeister geworden. Nichts gegen Thomas Kufen, aber Essen war mal eine SPD-Hochburg wie Duisburg und Dortmund, fast hätte ich gesagt wie Oberhausen, aber die Stadt haben die Genossen ja auch an die Konkurrenz verloren. Wie sie auch NRW verloren haben. Armin Laschet regiert unbedrängt, er wird gar nicht gefordert von der Opposition, auch nicht von Herrn Kutschaty. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die Grünen in NRW keine große Rolle spielen.Das alles soll die Arbeit von Laschet nicht schmälern.
Jetzt hat sich eine Frau zu Wort gemeldet, die zu den Großen der Partei gehört: Gesine Schwan, die Professorin, würde mithelfen, der SPD wieder auf die Beine zu stellen. Die Dame ist 76 Jahre alt, hat zweimal für die SPD vergeblich für das Amt des Bundespräsidenten kandidiert. Diese Frau, die die Grundwerte-Kommission der Partei leitet, hat mit ihrer Äußerung im „Spiegel“ keinerlei weitere Ansprüche angemeldet, sie will also nicht Kanzlerin werden, aber sie würde ihr Ansehen und ihren guten Ruf einsetzen, damit es der SPD wieder besser gehen würde. Keine schlechte Argumentation der Professorin für Politik, die ich vor wenigen Monaten in einem Hörsaal der Uni Bonn hören durfte, als sie über Zeitgeschichte redete. Eine Stunde sprach sie frei, voller Emotion, sie riss mit ihrer Art der Darstellung die Zuhörerinnen und Zuhörer mit und erhielt am Ende riesigen Beifall. Gesine Schwan geht es auch nicht darum, unbedingt Parteivorsitzende werden zu wollen, aber sie würde in einem Spitzen-Team mitarbeiten, die SPD aus dem Tal der Tränen zu führen. Sie traut sich das zu, mit Gesine Schwan könnte die SPD auch wieder in Kontakt kommen zu Wissenschaftlern, Künstlern und Studenten. Das alles ist ja über die Jahre auch verloren gegangen.
Vorwürfe gegen die Doktormutter von Giffey
Franziska Giffey, die Familienministerin aus Berlin, hat ebenfalls anklingen lassen, dass sie sich für die Führung der alten SPD zur Verfügung stellen würde. Ihr Problem sind Plagiatsvorwürfe wegen ihrer Doktorarbeit. Ich frage mich schon länger, warum die Vorwürfe gegen Frau Giffey erhoben werden. Wenn sie -um es salopp zu sagen- schlampig zitiert hat, wäre es doch Sache ihrer Doktormutter gewesen, diese Mängel bei der Bewertung ihrer Dissertation entsprechend zu würdigen, sie hätte ihrer Arbeit ein Mangelhaft verpassen können. Hat die Doktormutter nicht gesehen, was die selbst ernannten Plagiatsjäger von VroniPlag erkannt haben wollen, dass nämlich die Arbeit voller Fehler sei? Immer vorausgesetzt, Franziska Giffey hat “ nach bestem Wissen und Gewissen“ gearbeitet, wie sie selbst behauptet, und nicht systematisch und in voller Absicht gemogelt. Nochmal: Was sagt die Doktormutter zu solchen Vorwürfen? Und: Könnte Frau Giffey nicht den Doktortitel einfach an die Universität zurückgeben? Übrigens hat Frau Giffey, als die Plagiatsvorwürfe öffentlich gemacht wurden, die Freie Universität zu Berlin gebeten, ihre Doktorarbeit zu prüfen. Ob sie mit Hilfe ihres Anwalts die Sache in ihrem Sinne erledigen kann, ist ungewiss. Der Hinweis einer amerikanischen Zitierwise als Begründung für Fehler und Versäumnisse in der Dissertation jedenfalls wirkt einigermaßen hilflos.
Und wenn Franzsiska Giffey also im Strudel der Ereignisse untergeht? Fast möchte man rufen: Freiwillige vor. Nur, einer wie der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil will nicht für das SPD-Spitzenamt antreten. Ich kann ihn verstehen. Weil ist ein durchaus erfolgreicher Regierungschef in einem großen Land. Soll er das riskieren, wenn er in Berlin in die Bresche springen würde? Wer weiß, ob die SPD ohne Weil Niedersachsen halten kann? Juso-Chef Kevin Kühnert wird genannt. Aber kann sich jemand ernsthaft vorstellen, dass der die SPD führen kann? Dass er ein Amt in der erweiterten Spitze der Partei übernehmen soll, ja, aber in die Fußstapfen eines Willy Brandt treten?Simone Lange, Flensburger OB, wird genannt, sie hatte gegen Andrea Nahles achtbar verloren. Lars Klingbeil könnte antreten, der Generalsekretär, ein eher blasser Politiker, dem Kritiker den verlorenen Europa-Wahlkampf anlasten. Vorstellbar wäre eine Kandidatur von Boris Pistorius, Innenminister in Niedersachsen, dort ziemlich erfolgreich, beliebt in der Partei. Heiko Maas, der Außenminister in der Groko, wäre denkbar, allerdings hat er als Außenamtschef bisher einiges vermissen lassen, zum Beispiel ein Konzept, um Russland wieder an den europäischen Tisch zu bringen. Katharina Barley, die jetzt im Europa-Parlament sitzt, darf man nicht übersehen, sie gilt als ehrgeizig, einer wie Hubertus Heil, der Arbeitsminister im Kabinett Merkel, hat schon abgewunken.
Sachsens SPD-Chef Martin Dulig hat mit Blick auf das Spitzen-Personal seiner Partei nicht gerade fröhlich ein Fazit gezogen: „Wir sind da etwas ausgebrannt.“ Wer will ihm da widersprechen? Allerdings dürfte Dulig damit auch seine Sachsen-SPD mit einbezogen haben. Die könnte, wenn sie Pech hat, bei den Landtagswahlen im Freistaat unterhalb der zehn-Prozent-Hürde landen. Regierungsfähigkeit sieht anders aus.
Sehnsüchtig blickt man auf die Grünen
Sehnsüchtig und voller Neid blickt die SPD auf die Grünen, die einen Lauf haben, wie es neudeutsch heißt. Die Grünen haben jeden innerparteilichn Streit begraben, sie haben sich untergehakt, sie treten gemeinsam auf, sie präsentieren den Live-Style, sie lächeln alle an und alles Schwierige weg, sie sind keine Verbots-Partei mehr, keine Besserwisser. Und sie haben das dafür nötige Personal. Annalena Baerbock und Robert Habeck, das ist ein Glücksfall für die Grünen. Dazu der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, der das Kunststück fertig gebracht hat, ein altes CDU-regiertes Land in grüne Hände zu nehmen. Grün-Schwarz regiert in Land der Bastler, Tüftler und Autobauer, Schwarz-Grün regiert in Hessen mit Volker Bouffier und Tarek Al-Wazir. Hessen war mal eine SPD-Hochburg.
Nein, die SPD hat weder einen Habeck noch eine Baerbock, keinen wie Kretschmann. Und doch soll eine Doppelspitze die Lösung aller Probleme sein. Die SPD sollte sich an die Zeit von Willy Brandt und Helmut Schmidt erinnern, zu der auch noch Herbert Wehner zählt. Die bildeten ein Triumvirat, was nicht bedeutete, dass sie Freunde gewesen wären, aber sie haben zusammengehalten, um der Idee der SPD zum Erfolg zu verhelfen. Die Idee von der Freiheit, der Solidarität, der gerechteren Gesellschaft, der Toleranz. Die SPD war dann am stärksten, wenn sie Rechte und Linke in der Führung hatte. Man denke an Erhard Eppler, der einem wie Schmidt auf die Nerven ging, aber er musste ihn ertragen und umgekehrt. Seeheimer und Parteilinke müssen ihre Kämpfe beenden, nur zusammen können sie zu alter Stärke zurückfinden. Sozialdemokraten müssen endlich aufhören, sich gegenseitig nicht mal den Dreck unter den Fingernägeln zu gönnen. Integration wäre das Lösungswort.
Wenn man sich beim gerade zu Ende gegangenen evangelischen Kirchentag in Dortmund bedienen würde, käme man möglicherweise zum Angriffsmotto: Aufstehen gegen Rechts, gegen Rechsradikale, aufstehen und Haltung zeigen, Zivilcourage gegen den Hass und die Hetze, die Verrohung der Sprache, wie es Kölns OB Reker gerade beklagt hat. Wir dürfen doch den Neonazis, Nationalisten, Fremdenfeinden, Antisemiten nicht den besten Staat überlassen, den wir je hatten in der deutschen Geschichte, ein Werk unserer Großmütter und Großväter, geschaffen auf den Trümmern der Nazi-Ideologie und des Zweiten Weltkriegs. Krempeln wir die Ärmel hoch gegen die Salvinis, Trumps, Erdogans, Gaulands und kämpfen für Europa. Wenn das kein Thema für eine SPD ist?! Der Feind steht rechts, hat Armin Laschet vor einiger Zeit den Reichskanzler Karl Josef Wirth vom Zentrum zitiert. Wirth hatte nach der Ermordung des Reichsaußenministers Walther Rathenau am 24. Juni 1922 im Reichstag eine emotionale Rede gehalten: „Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt. Da steht der Feind und darüber ist kein Zweifel: dieser Feind steht rechts.“
Streiten Seite an Seite
Bei der anstehenden Personalentscheidung sollen die Mitglieder beteiligt werden, man sollte sie befragen. Es sind immerhin noch rund 440000-früher waren es mal eine Million. Eine solche Befragung könnte die Partei beleben, könnte Stimmung in die müde Bude SPD bringen. Es geht dabei auch um die Zeit nach der Groko, die irgendwann in naher Zukunft zu Ende geht. Und dann muss diese SPD-Führung von vorn anfangen. Es wird dauern, zu tief war der Fall. Aber das Ziel muss sein: Seite an Seite zu streiten für die Sache der ältesten deutschen Partei. Das kann nur gelingen, wenn alle anpacken.
Bildquelle: Rawife via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

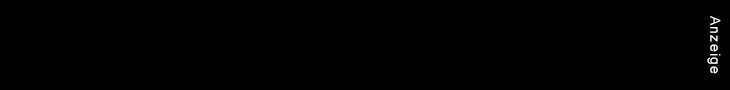



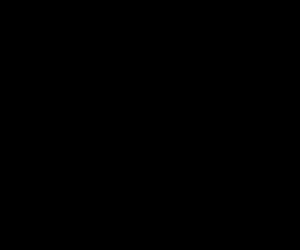












Prima Kommentar.