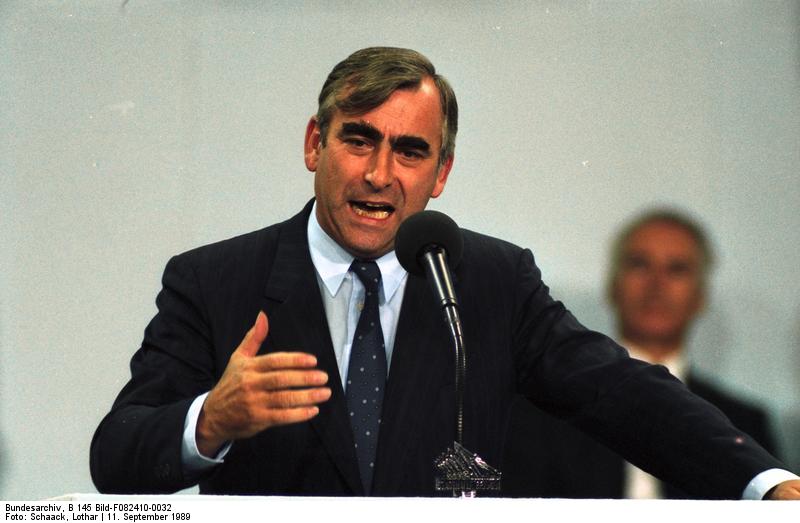Die nationale und internationale Politik wird seit Monaten vom Corona-Virus dominiert. Die GroKo in Berlin und die 16 Länderregionen sind fast ausschließlich mit den COVID-19-Herausforderungen beschäftigt. Noch sind wir nicht über den Berg, so die Bundeskanzlerin in ihrer jüngsten Regierungserklärung, und dürfen uns nicht in falscher Sicherheit wiegen.
Bei den Entscheidungen über politische Maßnahmen bilden die Analysen, Erkenntnisse und Empfehlungen der Experten aus der Virologie, Medizin und anderen Bereichen der Wissenschaft die wichtigste Grundlage. Im internationalen Vergleich steht Deutschland mit seinem Gesundheitssystem gut da. Die Wertschätzung des gesamten Medizinsektors war noch nie so hoch wie in dieser Corona-Phase.
Höchste Priorität für die Pharmaforschung
Das gilt nicht zuletzt für den Pharmabereich, denn allen Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft ist inzwischen klar: COVID-19 wird erst dann keine Gefahr für Leib und Leben der Menschen mehr sein, wenn ein wirksamer Impfstoff und Medikamente verfügbar sein werden. Nach den aktuellen Einschätzungen von Experten, wird dies frühestens Ende 2020, wahrscheinlich jedoch eher Anfang 2021 zu erwarten sein. Zahlreiche intensive und aufwändige Aktivitäten von Forschern in wissenschaftlichen Institutionen und Unternehmen sind längst angelaufen. In breiten Kreisen der Öffentlichkeit herrscht indessen nur wenig Kenntnis darüber, wie schwierig und langwierig sich solche Prozesse in der Pharmaforschung gestalten. Bis zum Einsatz eines Impfstoffes und von Medikamenten gegen COVID-19 sind große Investitionen erforderlich – Investitionen, deren Erfolge nicht garantiert werden können.
Regierung im Aufwind
In
Krisenzeiten schart sich das Volk hinter den Regierenden. Diese Erfahrung aus
früheren Zeiten betätigt sich auch in dieser COVID-19-Phase. Die aktuellen
demoskopischen Befunde spiegeln dies deutlich wider.
Das Ansehen der Bundeskanzlerin sowie der Minister der Fachressorts Gesundheit
und Wirtschaft sowie Soziales und Arbeit ist in den vergangenen Wochen deutlich
gestiegen. Eine große Mehrheit der Wählerinnen und Wähler bekundet die
Zustimmung zu den gesundheits-, finanz-, sozial- und wirtschaftspolitischen
Entscheidungen und Maßnahmen. 47 % der Bevölkerung trauen der Union zu, mit den
Problemen am besten fertig zu werden; 13 % halten die SPD für kompetent genug.
Den anderen Parteien wird durchweg eine wesentlich geringere Kompetenz
zugebilligt.
Aus einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach ergeben sich folgende Ergebnisse: 90 % der Anhänger von CDU und CSU, 81 % der Anhänger von der SPD sind der Meinung, dass die Bundesregierung in der Corona-Krise eine gute Arbeit macht.
Diese Einschätzungen schlagen sich auch in den Ergebnissen der sogenannten Umfrage „Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre,..“ nieder: Die CDU/CSU bewegt sich aktuell zwischen 36 und 39 %. Auf 16 bis 19 % kommt die SPD. Deutlich abgeschwächt haben sich die Werte für die Grünen mit 15 bis 19 %. Die AfD verliert auch auf 9 bis 10 %, die Linke auf 7,5 bis 8 %. Relativ schwach ist mit 5 bis 7 % die Zustimmung für die FDP: Neben Christian Lindner wird kaum ein anderer Politiker der Liberalen in der Öffentlichkeit wahrgenommen.
Vor einem tiefen Rezessionstal
Diese demoskopische Zeitaufnahme wird sich noch bis zur Bundestagswahl im Herbst 2021 mehr oder weniger stark verändern. Dabei wird vieles davon abhängen, wie sich die Phase nach dem Ausstieg aus dem Lock down entwickeln wird. Das laufende Jahr wird die Wirtschaft in ein tiefes Rezessionstal stürzen. Aufgrund der großen Exportabhängigkeit deutscher Unternehmen wird es 2020 keine Impulse aus dem Ausland geben. Vor allem sind in der EU die meisten Mitgliedsstaaten durch Corona wirtschaftlich noch stärker gebeutelt als Deutschland. Hinzu kommt, dass die USA und China ebenfalls deutliche Einbrüche verzeichnen und ihre Volkswirtschaften kaum auf einen Wachstumskurs bringen können.
Die
deutsche Wirtschaft wird 2020 ein Minus von 5, möglicherweise sogar von bis zu
10 % des Bruttoinlandsprodukts erleiden. Die Milliarden-Programme der
Bundesregierungen, die bereits zur Stützung der Unternehmen beschlossen wurden
und die arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie z.B. das Kurzarbeitergeld reichen
als „Erste Hilfe“ für viele Firmen und Arbeitsplätze, doch keineswegs für alle.
Die Zahl der Insolvenzen und der Arbeitslosen wird im Verlauf des Jahres
deutlich ansteigen. Der Weg aus dem tiefen Virus-Tal wird auf jeden Fall
außerordentlich schwierig und mühsam. Die politische Diskussion der nächsten
Monate wird sich deshalb darauf konzentrieren, mit welchen Maßnahmen der Kurs
aus der Rezession gefunden und gesteuert werden kann. Vereinzelte Vorschläge
aus den GroKo-Parteien deuten auf große Unterschiede hin: Während aus der Union
Steuersenkungen – vor allem zur Förderung von privaten Investitionen –
gefordert werden, schlägt die SPD-Vorsitzende Esken eine Vermögensabgabe vor.
Auch Finanzminister Scholz ist für eine Neujustierung des Steuersystems „mehr
in Richtung Gerechtigkeit“; er lehnt „Steuersenkungen für Spitzenverdiener“ ab,
setzt sich jedoch für die „Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen“ ein.
Die Automobilbranche setzt auf Kaufprämien für neue umweltfreundliche Fahrzeuge,
der Maschinenbau auf bessere Abschreibungsbedingungen.
EU vor der größten Bewährungsprobe
Andere – wie etwa die EU-Kommission – fordern Programme für die Digitalisierung, den Ausbau der Infrastruktur, den „Green Deal“ usw. in Höhe von vielen hundert Milliarden Euro. Die Staats- und Regierungschefs der EU haben bei ihrem „Video-Gipfel“ (23.4.) das Paket, das die Finanzminister geschnürt haben, gebilligt. Es umfasst immerhin 540 Mrd. € für zinsgünstige Kredite und Kurzarbeit sowie mehr Spielraum für die Europäische Investitionsbank. Die EU-Kommission wurde beauftragt, Vorschläge für ein weiteres Paket zu machen, das einen Wiederaufbaufonds für die Volkswirtschaften der EU beinhalten und ein Volumen von bis zu 1 Billion € haben soll. Die Finanzierung wird über den EU-Haushalt für 2021 bis 2027 angestrebt, damit die fruchtlose und kontroverse Diskussion über die Euro-Corona-Bonds beendet werden kann. Denn eine Vergemeinschaftung der Schulden wird vor allem von Deutschland und den Niederlanden abgelehnt; sie wäre im übrigen mit dem deutschen Haushaltsrecht und unserer Verfassung nicht vereinbar. Bundeskanzlerin Merkel hat dies erneut deutlich gemacht, zugleich aber die Bereitschaft zu höheren Beiträgen für den EU-haushalt signalisiert. „Die EU ist Teil unserer Staatsraison und unsere Schicksalsgemeinschaft“, drauf wies die deutsche Regierungschefin nochmals hin; deshalb müssten die Europäer „füreinander in diesen Zeiten unverschuldeter Not einstehen, gemeinsam handeln und so die gigantische Herausforderung meistern.“ Für diesen Kurs hat Merkel die volle Unterstützung der GroKo, vor allem auch von ihrem Finanz- und Außenminister. Zur Finanzierung des deutschen Anteils an einem European Recovery Program würde sich das Instrument des Solidaritätsbeitrags anbieten, der bisher für den Aufbau der Neuen Bundesländer erhoben wird und in Zukunft als EU-Soli umgesetzt werden könnte.
CDU: Auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden
Vor dem Hintergrund der Corona-Krise hat die Diskussion über die Wahl eines neuen CDU-Bundesvorsitzenden an Fahrt verloren. Am 25. April sollte der Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer auf einem CDU-Sonderparteitag gewählt werden. Dieser wird nun nicht stattfinden. Ob er noch vor dem Parteitag, der für Anfang Dezember in Stuttgart geplant ist, abgehalten wird, ist noch nicht sicher, doch eher unwahrscheinlich.
Die „Warmlauf-Phase“ von Armin Laschet, Friedrich Merz und Norbert Röttgen wird also wesentlich länger als ursprünglich geplant dauern. Der NRW-Ministerpräsident hat sich in der COVID-19-Krisenzeit bislang stark engagiert – mit vielen Vorschlägen und Empfehlungen, die er insbesondere medienwirksam in Pressekonferenzen, Talkshows, Interviews usw. darstellen konnte. Dadurch ist sein Bekanntheitsgrad weit über die Landesgrenzen von NRW hinaus gesteigert worden. Unterstützung erhielt Laschet dabei vor allem von Karl-Josef Laumann, dem NRW-Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit. Der wichtigste Strippenzieher in der NRW-Staatskanzlei ist Staatssekretär Nathanael Liminski (Chef der Staatskanzlei).
Dagegen mussten sich Friedrich Merz und Norbert Röttgen stark zurückhalten. Nach heutiger Einschätzung wird Armin Laschet, der zudem von Jens Spahn offen unterstützt wird, als Favorit für den Vorsitz der Bundes-CDU gehandelt. Die CDU-Delegierten aus NRW bringen rund 25 % auf die Abstimmungswaage. Aus einigen anderen Landesverbänden gibt es durchaus Sympathie-Bekundungen für Laschet, doch sprechen sich der starke CDU-Verband in Baden-Württemberg sowie vor allem Christdemokraten aus den ostdeutschen Ländern für Friedrich Merz aus. Wen die rund 1.000 Delegierten Ende diesen Jahres zum neuen CDU-Chef wählen werden, ist derzeit noch nicht sicher.
In den nächsten Monaten wird die politische Szenerie vor allem von den Schritten in die Normalität bestimmt werden. Merz wird dabei mit seinen wirtschafts- und finanzpolitischen Vorschlägen punkten und seine Position noch verbessern können, zumal er dabei insbesondere auf die Unterstützung des CDU-Wirtschaftsrates und der Mittelstandsunion setzen darf. Die Kommunalwahlen, die im September in NRW stattfinden werden, sind ein gewisser Stimmungstest für die CDU und insbesondere auch für Armin Laschet. In der SPD haben sich in der Corona-Krise Olaf Scholz und Hubertus Heil als kompetente Politmanager profiliert, während die Parteivorsitzenden Walter Borjans und Saskia Esken sehr blass blieben.
Laschet oder Söder?
Anfang 2021 wird darüber entschieden, wer bei der Bundestagswahl im Herbst des Jahres als Kanzlerkandidat die Union in die Bundestagswahl führen wird. Sicher ist, dass Angela Merkel auf keinen Fall mehr antreten wird, obwohl gerade in der jüngsten Corona-Phase ihr Ansehen noch einmal stark gewachsen ist. In bundesweiten Umfragen liegt Markus Söder mit großem Vorsprung an der Spitze, wenn es um die Kanzlerkandidatur geht. Er betont bislang beharrlich, dass er mit seiner CSU bei der Aufstellung des Kanzlerkandidaten der Union ein entscheidendes Wort mitreden wird, dass aber sein „Platz in Bayern“ ist. Bis zur endgültigen Kür wird noch viel Wasser den Rhein und die Isar hinunterlaufen. Deshalb gilt auch, ein derzeit eher noch unwahrscheinliches Szenario als vollends irreal außer Betracht zu lassen. Bei der Bundestagswahl 2002 trug die damalige CDU-Bundes-vorsitzende Angela Merkel dem CSU-Vorsitzenden und Ministerpräsidenten des Freistaates Bayern die Kanzlerkandidatur an. Und das, obwohl Edmund Stoiber bundesweit nicht gerade das höchste Ansehen genoss. Da in NRW im Jahre 2022 die nächste Landtagswahl stattfinden wird, muss Armin Laschet diesen Termin in sein Kalkül miteinbeziehen: Bei einer Niederlage bei der Bundestagswahl würde sich die Ausgangsposition für NRW ziemlich verschlechtern.
Für seine Kanzlerkandidatur benötigt Laschet deshalb auf jeden Fall die uneingeschränkte Unterstützung von Söder. Mit der strategischen Mehrheit der Union könnte Laschet über die Koalition nach 2021 entscheiden. Nach heutigem Stand wird er ein Bündnis mit den Grünen anstreben, zu denen er bereits vor langer Zeit die „Pizza-Connection“ pflegte. Doch eine Fortsetzung der GroKo mit der CDU,CSU und SPD kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Denn diese Koalition bewährt sich gerade jetzt in der Corona-Krisenzeit. Da niemand voraussagen kann, wie lange diese Krise andauert und ob unser Land im Jahre 2021 durch die tiefste Rezession gehen wird, ist auch eine GroKo-Neuauflage denkbar.
Bildquelle: Pixabay, Bild von Gerd Altmann(geralt), Pixabay License